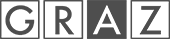Seit 1. Jänner 2022 regelt ausschließlich das Steiermärkische Sozialunterstützungsgesetz die Existenzsicherung jener Menschen, die diese aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können. Dazu werden Leistungen für Lebensbedarf, Wohnen und Krankenhilfe gewährt. Mit der Neufassung Gesetzes werden alle Bezieherinnen und Bezieher weniger Geld erhalten. Ob Menschen mit Behinderungen oder Allererzieherinnen - durch die Senkung der Beträge bei gleichzeitig stark steigenden Lebenskosten wird nicht nur die Armut zunehmen, es werden auch neue Kosten für die Stadt anfallen, die zur Kompensation von Notlagen notwendig sind.
Das betonte Bürgermeisterin Elke Kahr in einer Pressekonferenz am heutigen 10. Oktober 2025, in der sie gemeinsam mit dem Sozialamt der Stadt Graz, vertreten durch Andrea Fink, Walter Purkarthofer und Eva Seiler, die Auswirkungen der Novelle vorstellte. Kahr: „Niemand geht es besser, wenn es anderen schlechter geht. Daran muss man denken, wenn solche Entwürfe als Verbesserung dargestellt werden. Vor allem Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern laufen bei Umsetzung der Novelle Gefahr, ihre Wohnungen aufgrund fehlender Mittel zu verlieren. Die bereits bestehende Kinderarmut wird zunehmen. Unterm Strich bekommen alle weniger, selbst jene, bei denen von Seiten des Landes Verbesserungen in Aussicht gestellt wurden, zum Beispiel Alleinerzieherinnen und Menschen mit Behinderung."
Ein statistischer Blick mit aktuellen Zahlen
Die Leistungen der Sozialunterstützung (SU) werden an sogenannte Bedarfsgemeinschaften (Haushalte) gewährt. Wie setzen sich diese in Graz zusammen? Im August 2025 (Statistik des Landes Steiermark) haben:
- 9.438 Personen in insgesamt 4.669 Haushalten Sozialunterstützung bezogen.
- Von ihnen waren 2.678 Männer, 3.254 Frauen und 3.506 Kinder. Das entspricht nur 3,08 Prozent aller, die in Graz ihren Hauptwohnsitz haben.
- Von den dzt. 9.438 Personen sind lediglich 3.393 Personen zur Arbeitssuche verpflichtet. Alle anderen sind außerhalb der Erwerbsfähigkeit (z.B. Kinder, Pensionsalter, Erkrankung, Kinderbetreuung). Das entspricht 1,11 Prozent der Grazer Bevölkerung (Hauptwohnsitz).
- Rund 37 Prozent der Beziehenden waren also Kinder. 938 Personen waren junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren, 4392 Personen waren im erwerbsfähigen Alter, 602 Personen außerhalb des erwerbsfähigen Alters.
- Von den 9.438 Beziehenden sind 3.712 Österreicher:innen, 880 Angehörige eines anderen EU-Staates und 4.845 Drittstaatsangehörige.
Haushaltstypen
Die Statistik zeigt, dass Einpersonenhaushalte 58 Prozent aller Haushalte ausmachen, nämlich 2.737. In 831 Haushalten leben Alleinerziehende mit einem oder mehreren Kindern, in 341 Haushalten Paare mit Kindern, 760 Haushalten bestehen aus Paaren ohne Kinder und anderen Konstellationen. Paare mit 4 oder mehr Kindern machen mit 107 nur 2,2 Prozent aller beziehenden Haushalte aus. Das ist ein sehr kleiner Teil aller beziehenden Haushalte.
Verfügbarkeit am Arbeitsmarkt
Mit der beabsichtigten Novelle zum Sozialunterstützungsgesetz streicht der Landesgesetzgeber die Absicht hervor, arbeitsfähige Bezugsberechtigte in den österreichischen Arbeitsmarkt zu bringen. Es ist aber hervorzuheben, dass lediglich 3.393 Personen in Graz von dieser Regelung betroffen sind, das entspricht etwa einem Drittel der SU-Bezieher:innen oder 1,11 Prozent der Grazer Bevölkerung. Rund zwei Drittel aller Bezugsberechtigten haben also so gut wie keine Möglichkeit, ihre wirtschaftliche Situation durch Aufnahme einer Beschäftigung zu verbessern. Die Mehrheit der Bezieher:innen besteht - entgegen oft kolportierter Annahmen - also nicht aus jungen, arbeitsfähigen Menschen, die überhaupt keiner Beschäftigung nachgehen und ausschließlich von Sozialunterstützung leben.
Einkommen
45,83 Prozent aller Bezieher:innen (4.325 Personen) sind sog. „Aufstocker". Sie bekommen SU ergänzend zu sonstigen - sehr niedrigen - Einkommen (z. B. Gehalt aus Erwerbsarbeit, AMS-Leistungen, Unterhalt, Kinderbetreuungsgeld oder Pension).
Wen wird die Novelle treffen und warum?
Die mit der Novelle vorgesehenen Änderungen und Maßnahmen werden zu erheblichen Leistungskürzungen aller Betroffenen führen und Auswirkungen auf alle Lebensbereiche der Bezugsberechtigten haben. Das bringt allein schon die Reduzierung des Höchstsatzes von 100 Prozent des Ausgleichszulagenrichtsatzes auf 95 Prozent mit sich. Besonders tragisch werden die Auswirkungen jedoch für jene sein, die ihre Einkommenssituation aktiv kaum verbessern können, vor allem Alleinerziehende. Die (bereits auf 95 Prozent des Ausgleichszulagenrichtsatzes reduzierten) Höchstsätze für Minderjährige werden stärker degressiv gestaltet und damit nochmals verringert (siehe Tabelle).
| Derzeit pro Kind | Künftig pro Kind | |
| 1 Kind | 21 % | 25 % |
| 2 Kinder | 21 % | 20 % |
| 3 Kinder | 21 % | 15 % |
| 4 Kinder | 17,5 % | 12,5 % |
| 5 oder mehr Kinder | 17,5 % | 12 % |
Auch der Alleinerziehenden-Zuschlag wird verringert:
| Derzeit | Künftig | |
| 1. Kind | 12 % | 9 % |
| 2. Kind | 9 % | 6 % |
| 3. Kind | 6 % | 3 % |
| Jedes weitere Kind | 3 % | 3 % |
Die Wohnkostenpauschale wird von 20% auf 15 Prozent herabgesetzt. Berechnungsbasis ist auch hier der auf 95 Prozent des Ausgleichszulagensatzes reduzierte Höchstsatz. Damit erfolgt eine zweifache Verminderung der Wohnkostenpauschale!
Vor allem Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern laufen mit der Umsetzung der geplanten Novelle Gefahr, ihre Wohnungen aufgrund fehlender Mittel zu verlieren. Die bereits bestehende Kinderarmut wird dadurch zunehmen, bereits jetzt sind in den Wohnungseinrichtungen der Stadt Graz ca. 140 Kinder untergebracht (Übergangswohnungen, Wohnhaus für Frauen). 80% Dieser Kinder leben in Alleinerzieher:innen-Haushalten.
Zu den betroffenen Gruppen zählen auch Personen mit Behinderungen und Geflüchtete. Zuschläge für Bezugsberechtigte mit Behinderung bleiben mit 18 Prozent bleiben zwar gleich, jedoch reduziert sich der Zuschlag de facto durch die allgemeine Höchstsatzreduzierung (95 Prozent) auf 13 Prozent. Somit erleben wir hier in Zeiten einer Rezession mit stark steigenden Lebenshaltungskosten (täglicher Einkauf, Wohn- und Energiekosten) eine massive Reduzierung der Unterstützungsleistungen für die Bevölkerungsgruppen mit dem größten Schutzbedürfnis.
Einer möglichen Kostenersparnis für die Stadt von voraussichtlich etwa 3 Mio. Euro stehen große Belastungen für viele Betroffene sowie längerfristig erhebliche Mehrkosten für die Kommune aufgrund notwendiger Kompensationsmaßnahmen (alternative Wohnversorgung, mehr freiwillige Leistungen ohne die früher übliche 60-Prozent-Kostenbeteiligung durch das Land z. B. bei „Armenbegräbnis") gegenüber. Denn bei Zusatzleistungen zur Vermeidung besonderer Härte wird die gesamte Last den Gemeinden aufgebürdet. Eine Kostenaufteilung (60 Prozent Land, 40 Prozent Stadt) wie bisher gibt es nicht mehr.
Verstärkte Sanktionen bei arbeitsmarktrelevanten Verfehlungen
Mit verstärkten Sanktionen in Form von Leistungskürzungen soll lt. Argumentation des Landes eine „Eindämmung der Ausnutzung des Sozialsystems" und eine „Prävention von Sozialleistungsmissbrauch durch strengere Strafen" bewirkt werden. Damit wird den Anspruchsberechtigten unterstellt, sich in der Mehrzahl Sozialleistungen erschleichen zu wollen. Angesichts der Tatsache, dass höchstens 36 Prozent aller SU-Bezieherinnen überhaupt in die Beschäftigung gebracht werden könnten, handelt es sich hier um überschießende Maßnahmen. Leistungskürzungen gemäß & 7 StSUG aufgrund von Verfehlungen der arbeitsunwilligen Personen bis hin zur Leistungseinstellung für mindestens drei Monate inklusive Wegfall des geschützten Wohnbedarfs bedeuten auch, dass Kinder mit betroffen sein können, was in der Praxis zu weiteren Belastungssituationen und auch Mehrkosten für die Allgemeinheit führen würde.
Zusammenfassung
- Mit dem neuen Sozialunterstützungsgesetz verlieren alle Bezieherinnen und Bezieher. Das wird vor allem die Kinderarmut und erhöhen und die Situation von Alleinerzieherinnen erschweren.
- Der Anteil an SU-Bezieher:innen an der Grazer Bevölkerung mit Hauptwohnsitz ist sehr gering.
- Kinderreiche Familien machen einen sehr kleinen Teil aller beziehenden Haushalte aus.
- Nur etwa ein Drittel der SU-Bezieher:innen kommen überhaupt für die Vermittlung einer Erwerbsarbeit in Frage. Das entspricht 1 Prozent der Grazer Bevölkerung.