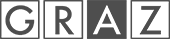Folge 91: Rathaus-Schulführung: Was viele über das Grazer Rathaus noch nicht wussten
Das Grazer Rathaus ist voller Geschichten - und viele davon kennt kaum jemand. In dieser Folge erzählt Gernot Wolf aus der Abteilung für Kommunikation über die Schulführungen und was Kinder (und auch Erwachsene) dabei lernen: wie es zu drei Rathäusern gekommen ist, warum es 101 Stufen gibt und wo Kinder heute Demokratie erleben können. Ein unterhaltsamer, akustischer Rundgang durch ein Gebäude, das mehr kann als repräsentieren.
Das Grazer Rathaus und seine Geschichte kennen wir alle - oder doch nicht so ganz?
In dieser Folge nehme ich euch mit zu einer Schulführung ins Rathaus. Und ich verspreche euch: Da wird es einige Aha-Momente geben, vielleicht auch für eingefleischte Grazerinnen und Grazer.
Gernot:
Ja, hallo. Ich bin der Gernot Wolf von der Abteilung für Kommunikation, dem Referat Protokoll, und wir sind unter anderem für die Schulführungen zuständig.
Simone:
Lieber Gernot, was wissen die Grazerinnen und Grazer eigentlich nicht über das Rathaus?
Gernot:
Ich glaube ganz, ganz viel. Ich glaube, dass auch der eine oder andere Kollege, der im Rathaus arbeitet, das eine oder andere nicht weiß. Und ich werde euch heute ein bisschen etwas zeigen.
Also die erste Frage, die ich auch den Kindern immer stelle, ist: Wie viele Rathäuser glaubt ihr, hat Graz überhaupt? Und da wird der eine oder andere Grazer wahrscheinlich auch nicht wissen, wie viele wir schon gehabt haben.
Wir hatten nämlich schon drei Rathäuser. Das erste war gar nicht am Hauptplatz, sondern 1450 in der damaligen Judengasse, heute Jungferngasse, und ist erst dann mit dem zweiten Rathaus 1550 auf den Hauptplatz gekommen.
Und jetzt stehen wir vor dem dritten Rathaus, das 1803 gebaut wurde - und das werden wir uns heute anschauen.
Simone:
Warum haben sie das zweite dann abgerissen?
Gernot:
Ich glaube, die Probleme haben wir heute noch: Es ist dann immer zu klein.
Das erste war sehr klein, da war unten noch ein Gasthaus drinnen. Das zweite war optisch auch nicht einem Rathaus entsprechend, sondern hat eher ein bisschen ausgesehen wie ein Schulgebäude. Da war auch noch ein Gefängnis drinnen.
Es ist den Anforderungen einfach nicht mehr gewachsen gewesen. Und deswegen haben die Grazer gesagt: Wir bauen ein neues Rathaus - wir bauen das dritte Rathaus.
Es wurde dann im Laufe der Zeit ein paar Mal umgebaut, damit es so aussieht, wie wir es heute hier sehen. Aber der Grundstock wurde 1803 bis 1807 gelegt.
Simone:
Da lernen heute einige was. Gernot, gibt es da noch etwas oder gehen wir hinein?
Gernot:
Weißt du, was diese vier Figuren bedeuten, die wir da jetzt sehen?
Simone:
Ja, ich habe so eine Frage befürchtet.
Nein, mir sind die vier Figuren nicht einmal wirklich aufgefallen.
Oh mein Gott, ist das peinlich.
Gernot:
Also: Die vier Figuren sind eigentlich die vier Grundpfeiler, auf die Graz aufgebaut wurde.
Wir sehen den ersten Herrn mit einer Schriftrolle - der steht für den Handel.
Die Dame mit dem Globus steht für die Wissenschaft.
Dann haben wir eine Dame mit einer Tafel - die steht für die Kunst.
Und der Herr mit Hammer und Amboss steht für das Handwerk, für das Gewerbe.
Das sind so die vier Säulen, auf die Graz aufgebaut wurde - die vier Werte, für die Graz steht. Und die sind hier verewigt.
Es hat noch mehrere Figuren gegeben, die im Zweiten Weltkrieg abmontiert wurden.
Etwas ganz Wichtiges haben wir noch vergessen, bevor wir reingehen:
Über der Uhr kommt das Wappen - und ganz oben ist ein „Ritter", sagen die Kinder immer. Das ist aber der Rathausmann. Und dieser Rathausmann ist der Glücksbringer für alle, die in das Rathaus hineingehen.
Der beschützt uns alle. Also kann gar nichts passieren, wenn wir weitergehen.
Simone:
Auch der ist mir noch nie aufgefallen.
Gernot:
Der ist wirklich ganz weit oben. Auf den schaut man normalerweise nicht.
Foyer & Einstieg in die Führung
Simone:
Du machst die Schulführungen. Bedeutet das, diese Führung machst du immer mit den Kindern? Können da alle Schulen kommen?
Gernot:
Die Schulen können sich anmelden. Wir gehen seit 2025 aktiv auf die dritten Klassen zu.
Wir haben gegenüber den Vorjahren fast verdreifacht: Wir hatten voriges Jahr 129 Schulen mit knapp 3.000 Kindern bei uns im Rathaus.
Wir haben ganz gut zu tun.
Wir sind jetzt hier im Foyer des Rathauses, im Eingangsbereich. Und hier sieht man ein schönes Metallmodell. Das ist für sehbehinderte Menschen - damit auch sie wissen, wo sie gerade sind.
Solche Modelle gibt es vor allen Grazer Sehenswürdigkeiten - Kunsthaus, Oper - und natürlich auch hier im Rathaus.
Simone:
Wir gehen hinein...
Gernot:
Gleich das nächste Highlight: Direkt im Eingangsbereich hängt ein Gemälde. Darauf sind auch die drei Rathäuser abgebildet - das erste in der Judengasse, das zweite am Hauptplatz mit dem Gefängnis im zweiten Stock, und das dritte Rathaus, in dem wir uns jetzt befinden.
Und natürlich wieder der Rathausmann mit dem Wappen.
Und wir stehen hier auch „auf Graz": Der Bodenbelag ist ein Fotobodenbelag der Stadt Graz.
Damit geht es dann mit den Kindern los - sie sollen auf dem Bild das Rathaus suchen. Das können wir jetzt auch einmal machen.
Simone (sucht)
Da ist zu viel grün, das kanns nicht sein
Gernot:
Tipp: In der Nähe der Mur.
Unverkennbar mit dem großen, dreieckigen Platz. Und man sieht auch, wie groß das Ganze ist: Wir haben knapp 13.000 Quadratmeter Grundfläche - also mehr als zwei Fußballfelder.
Über 300 Personen arbeiten hier drinnen.
Die berühmten breiten Stufen
Simone:
Jetzt gehen wir die Stufen rauf. Da kenne ich eine Geschichte - die sind ja, glaube ich, breiter?
Gernot:
Genau. Und auch die Höhe ist nicht so, wie man es von normalen Stufen kennt.
Der Grund: Früher durften einige Grazer Bürger mit dem Pferd hinaufreiten.
Auch die Gänge sind so breit, dass man dort ein Pferd abstellen konnte.
Einige wohlhabende Grazer sind mangels Lift auf das Pferd umgestiegen.
Wir sind jetzt über die großen Stufen heraufgegangen in den dritten Stock - alle 101 Stufen. Die Kinder dürfen die immer abzählen. Das ergibt manchmal spannende Ergebnisse.
Aber es sind tatsächlich 101 Stufen.
Pionierinnengalerie
Gernot:
Wir sind jetzt im dritten Stock, in der Pionierinnengalerie. Sie ist seit 2012 hier im Rathaus.
Es gibt in jedem Stockwerk eine Galerie - aber die im dritten Stock ist etwas Besonderes, weil es hier um Gleichstellung und Frauenrechte geht.
Viele Frauen, die für Graz etwas Bedeutendes getan haben, sind hier abgebildet.
Ein Beispiel: fünf Damen des ersten Grazer Damen-Bicycle-Clubs von 1893.
Damals war es nicht selbstverständlich, dass Frauen Fahrrad fahren durften.
Es hieß, es sei schlecht fürs Herz, unhygienisch beim Schwitzen, und mit Rock sowieso unmöglich.
Die fünf Frauen haben sich trotzdem Räder besorgt - und irgendwann war es so normal, dass keiner mehr geschaut hat.
Das Rathaus ist offen - jede:r kann sich die drei Galerien anschauen.
Gemälde von Graz 1635
Wir gehen den dritten Stock entlang und kommen zu einem besonderen Gemälde: Graz im Jahr 1635, gemalt von Paul Schulz nach einem Kupferstich von Holler.
Man sieht:
- einen Burggraben
- die Burg am Schlossberg
- die Flößerei am heutigen Griesplatz
- das Kälmerne Viertel rund um den Hauptplatz
- Pferde, die Flöße zurückzogen
- die Burgrinne Gösting
- das damalige Schloss Eggenberg mit Nebengebäuden
Sehr spannend für Schulklassen.
2. Stock & Galerien
Wir sind einen Stock hinuntergegangen, in den zweiten Stock.
Hier ist wieder eine neue Galerie - diesmal eine Fotoausstellung.
Die Galerien im ersten und zweiten Stock wechseln regelmäßig. Nur die im dritten Stock bleibt gleich.
Willkommens-Tür & Kinderparlament
Auf dem Weg zum Büro der Bürgermeisterin gibt es eine Tür mit „Willkommen" in vielen Sprachen.
Viele Kinder entdecken hier ihre Muttersprache - eine schöne Idee des Kinderparlaments.
Der Gemeinderatssaal
Die Flügeltüren öffnen sich - ein beeindruckender Blick in den schönsten Raum des Hauses.
Der Saal wurde in der Corona-Zeit umgebaut, orientiert am historischen Original, aber technisch modern: Videoprojektoren, Kameras, Live-Übertragungen.
Der Lampenschirm hat 48 Leuchten - eine pro Gemeinderat.
Hier vermitteln wir Kindern Demokratie, Mitbestimmung und politische Abläufe.
Sie können sogar eine kleine Gemeinderatssitzung nachspielen - mit Rednerpult, Mikrofon und Fragen.
Kindergästebuch
Einzigartig in Österreich: das Kindergästebuch der Stadt Graz, als Ergänzung zum Goldenen Buch.
Schulklassen tragen sich ein und beantworten zwei Fragen:
- Was mögt ihr besonders an Graz?
- Was wünscht ihr euch für Graz?
Der Balkon
Hinter den Büros der Stadträt:innen und der Bürgermeisterin gibt es zwei Türen, die zu einem der schönsten Balkone von Graz führen - mit Blick auf Schlossberg und Hauptplatz.
Führungen für Erwachsene gibt es auch, allerdings nicht so häufig wie für Schulen.
Der Balkon ist nur im Rahmen einer Führung zugänglich.
Schulführungen kann man am besten über die Homepage der Stadt Graz buchen - einfach im Suchfenster „Schulführung" eingeben.
Ich freue mich über jede Klasse, die kommt.
Von der Stadt Graz gibt es was für die Ohren:
Mit dem Podcast „Grazgeflüster" wird das breite Informationsspektrum der Stadt Graz um einen weiteren digitalen Baustein erweitert. Die Themen aus dem Magistrat und den Dienststellen sind bunt gemischt, die Tipps praktisch, knackig verabreicht und hilfreich, die Geschichte der Stadt launig erzählt. Alle zwei Wochen gibt‘s eine neue Folge.
Den Stadt Graz Podcast gibt es kostenlos auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu abonnieren.
Einfach draufklicken, um auf die jeweilige Plattform zu kommen.
- Spotify
- Apple Podcasts
- Amazon Music/Audible
- Deezer
- Podcast Index
- Player FM
- Podcast Addict
- Podchaser
- TuneIn
- Listen Notes
Es geht aber auch ganz einfach über Ihren Browser oder auf einem RSS-Reader.
Hier finden sie außerdem weitere Podcasts über die/von der Stadt Graz:
- Wirklich wissen: Berichte aus dem Kontrollamt Graz.
- Das ist amtlich.: Der Familienpodcast aus Graz.
Folge 90: Wer hilft, wenn zu Hause in der Familie alles zu viel wird?
Elternsein ist wunderschön - und manchmal einfach wahnsinnig herausfordernd. Wenn Babys nicht schlafen, Kinder trotzen, Teenager rebellieren oder man als Familie an seine Grenzen kommt, ist das völlig normal. Und niemand muss damit allein bleiben. Heute erklärt Jutta Gollner vom Amt für Jugend und Familie, wie die Kinder‑ und Jugendhilfe Graz unterstützt, bevor Probleme groß werden - und was passiert, wenn sie zu groß werden.
Jutta Gollner/Teaser
Wir wollen uns auch klar davon abgrenzen: Wir sind nicht die Polizei. Es geht uns nicht darum, Eltern für irgendetwas zu bestrafen. Wir wollen da sein, wenn es schwierig wird, wenn es Probleme gibt und wenn wir im Sinne des Kinderschutzes Unterstützung anbieten können - aber auch müssen. In manchen Phasen müssen wir Unterstützung anbieten, und sie muss auch angenommen werden.
Jingle/Simone Koren-Wallis
Wenn Babys nicht schlafen oder essen wollen, Kinder trotzig sind, Teenager in die Pubertät kommen und rebellieren oder man als Familie einfach an seine Grenzen kommt: Das ist völlig normal. Und niemand muss damit allein bleiben. Heute sprechen wir darüber, wie die Kinder- und Jugendhilfe Graz unterstützt, bevor Probleme groß werden - und was passiert, wenn die Probleme überhandnehmen.
Jutta Gollner
Mein Name ist Jutta Gollner. Ich bin seit nunmehr 26 Jahren im Amt für Jugend und Familie beschäftigt, und die letzten elf Jahre bin ich als Leitung der Kinder- und Jugendhilfe Graz‑Südost tätig.
Simone Koren-Wallis
Liebe Jutta, beschreibt mir einmal eure Arbeit - was macht ihr?
Jutta Gollner
Ganz zusammengefasst ist die Aufgabe der Kinder‑ und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern. Ein großes Thema ist der Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie die Beratung und Unterstützung der Eltern. Das heißt, wir sind stark in der Prävention tätig, im Schutzbereich und in der Unterstützungstätigkeit.
Simone Koren-Wallis
Es heißt ja Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, ihr versucht zu helfen, wo es geht, oder? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
Jutta Gollner
Genau. Unser Ansatz ist ja: helfen, bevor Hilfe wirklich schon gebraucht wird. Darum auch der starke Präventionsbereich. Vielen Eltern ist gar nicht bewusst, dass Angebote, die sie nutzen, Angebote der Kinder‑ und Jugendhilfe sind - etwa Geburtsvorbereitungskurse, Elternberatungen oder Kurse, die über die Homepage abgerufen werden können. Sie helfen Eltern dabei, in die Rolle der Elternschaft hineinzuwachsen, mit all den Anfangsschwierigkeiten, die es gibt.
In den Elternberatungen wird das Kind gewogen und gemessen, medizinische Fragen werden geklärt und es gibt viele Unterstützungsangebote. Fachkräfte sitzen mit den Eltern zusammen, es gibt etwas zu trinken und meist auch zu essen. Die Eltern können sich austauschen, die Kinder spielen, und bei Bedarf gibt es fachliche Inputs: Stillen, Zahnen, Schlafgewohnheiten, Wickel- und Tragetechniken. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass Eltern sich kennenlernen, sich privat treffen, gemeinsam spazieren gehen oder den Spielplatz besuchen. So kann man auch der sozialen Isolation entgegenwirken, die viele junge Eltern erleben.
Wir haben eine hohe Frequenz bei den Elternberatungen. Das Angebot ist für viele der erste Schritt, uns kennenzulernen.
Simone Koren-Wallis
Für mich ist das etwas sehr Wichtiges. Wie du gesagt hast: Ihr seid eine Hilfe. Vielleicht kennen euch manche noch als Jugendamt - und das war früher ja irgendwie negativ assoziiert, oder?
Jutta Gollner
Ja, das stimmt. Und diese Assoziationen wollen wir durchbrechen. Wir sprechen nicht mehr vom „Jugendamt", sondern bewusst von der Kinder‑ und Jugendhilfe, wo die Betonung auf „Hilfe" liegt. Wir sind nicht die Polizei. Wir bestrafen niemanden. Wir wollen da sein, wenn es schwierig wird und wenn wir im Sinne des Kinderschutzes Unterstützung anbieten können oder müssen. In manchen Fällen müssen Angebote auch angenommen werden.
Simone Koren-Wallis
Vielleicht kommen wir gleich zu Zahlen, Daten, Fakten. Wie viele Fälle habt ihr?
Jutta Gollner
In Graz haben wir rund 50.000 Kinder und Jugendliche. Wir betreuen etwa 2.600 Familien. Rund 930 Kinder und Jugendliche erhalten Unterstützung im ambulanten Bereich. Daneben haben wir circa 580 Kinder und Jugendliche in voller Erziehung - also Kinder, die nicht zu Hause leben können. Sie leben in Wohngemeinschaften oder bei Pflegeeltern.
Pro Jahr haben wir leider auch ungefähr 22 Obsorgeanträge - das heißt, wir müssen gegen den Willen der Eltern die Unterbringung eines Kindes bei Gericht beantragen.
Simone Koren-Wallis
Und jetzt ist ganz wichtig: Ihr sagt ja nicht einfach „Das Jugendamt hat das Kind weggenommen". Sobald das Kind nicht mehr zu Hause lebt, versucht ihr ja schon wieder, es in die Familie zu integrieren, oder?
Jutta Gollner
Genau. Unsere Grundhaltung ist: Der erste Tag der Unterbringung ist auch der erste Tag der Rückführung. Auch wenn wir Kinder gegen den Willen der Eltern unterbringen müssen, verlieren Eltern nicht ihre Bedeutung. Eltern bleiben Eltern. Wir bleiben an ihnen dran, unterstützen sie dabei, Fähigkeiten zu erwerben, die notwendig sind, um eine Rückführung zu ermöglichen.
Wenn eine Rückführung nicht möglich ist, wollen wir zumindest, dass es regelmäßige Kontakte gibt. Eltern bleiben Teil des Lebens ihrer Kinder.
Simone Koren-Wallis
Es gibt ja auch Fälle, in denen man sich als Nachbar:in fragt: „Geht es dem Kind dort gut?" Was tut man da?
Jutta Gollner
Im besten Fall: hinschauen. Wahrnehmen. Sich Gedanken machen. Schon die Sorge um ein Kind reicht aus, Kontakt mit der Kinder‑ und Jugendhilfe aufzunehmen. Für die Familie entsteht damit nichts Schlimmes. Wir treten an die Familie heran, machen uns ein Bild und machen Unterstützungsangebote bekannt.
Oft sind Eltern erleichtert. Sie hätten selbst nicht so schnell Hilfe gesucht, obwohl sie merken, dass vieles schwerfällt.
Simone Koren-Wallis
Die Hemmschwelle ist oft groß: „Ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr." Das ist ja nicht leicht zuzugeben.
Jutta Gollner
So ist es. Daran arbeiten wir. Auch mit Kooperationspartnern - Kindergärten, Schulen, Fachkräften. Pädagog:innen ermutigen Eltern oft: „Schauen Sie, es gibt die Kinder‑ und Jugendhilfe. Nehmen Sie Kontakt auf." Sie können sogar Brücken bauen, indem sie ein erstes gemeinsames Gespräch organisieren.
Manchmal können sich Sorgen schnell klären. Manchmal braucht es länger. Aber es ist wichtig zu wissen: Man muss nicht alles allein können.
Simone Koren-Wallis
Es gibt aber auch Menschen, die zu schnell anrufen - zum Beispiel weil Kinder einfach laut sind.
Jutta Gollner
Das gibt es. Bei uns ist jede Information eine Meldung. Wir prüfen sie. Oft geht es aber nur darum, dass jemand sich vom Lärm gestört fühlt. Kinder singen, hüpfen, spielen - sie sind laut. Das ist normal. Und Kinder müssen gesehen und gehört werden dürfen.
Simone Koren-Wallis
Wie ist das mit Öffnungszeiten? Viele glauben ja, Ämter sind nur von 8 bis 12 offen.
Jutta Gollner
Ganz und gar nicht. Wir haben einen Bereitschaftsdienst - einzigartig in Österreich. Er ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche, auch an Sonn- und Feiertagen erreichbar. Unter der Nummer 872 30 43.
Zusätzlich kann man in jeder Dienststelle der Familien- und Sozialarbeit eine Meldung abgeben - schriftlich, telefonisch oder persönlich. Auch anonym.
Simone Koren-Wallis
Wünschst du dir, dass mehr Menschen euer Angebot bewusst wahrnehmen?
Jutta Gollner
Ja. Ich wünsche mir, dass Eltern wissen: Es gibt eine Stelle, an die man sich wenden kann. Familien sind Expert:innen für ihr eigenes Leben - aber manchmal kommt man allein nicht weiter. Manche haben familiäre Unterstützung, andere nicht. Gerade im städtischen Bereich fehlt sie oft.
Bevor etwas eskaliert oder Beziehungen leiden, wäre es gut, die Scheu zu überwinden und zu schauen: Welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es? Ich muss nicht alles allein wissen, können oder schaffen.
Viele Herausforderungen sind völlig normal: Müdigkeit, Trotzphasen, Schwierigkeiten am Morgen, Kinder, die nicht in den Kindergarten oder in die Schule wollen. Das kennt fast jede Familie. Manchmal geht es schnell vorbei, manchmal dauert es länger. Und dann lohnt es sich, Unterstützung zu holen.
Folge 89: Pflege daheim - was nun? Was tun?
In dieser Folge geht's darum, wie man sich im Albert‑Schweitzer‑Trainingszentrum auf ein Leben und Pflegen zu Hause im Alter vorbereiten kann. Judith Goldgruber und Christina Krenn von den GGZ erklären, welche Fähigkeiten man dort erlernt - und warum dieses Angebot für pflegende Angehörige so wertvoll ist.
Simone Koren-Wallis
Wir werden alle irgendwann alt - hoffentlich zumindest. Und da habe ich dieses Mal einen richtig tollen Tipp.In dieser Folge geht es um Informieren, Lernen und Trainieren für ein Leben zu Hause im Alter, beziehungsweise für die Pflege zu Hause. Und zwar im Albert-Schweitzer-Trainingszentrum. Was man dort lernt und warum dieses Angebot so wichtig ist, das hört ihr jetzt.
Judith Goldgruber
Mein Name ist Judith Goldgruber. Ich arbeite in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Geriatrischen Gesundheitszentren. Das Albert-Schweitzer-Institut für Geriatrie und Gerontologie leite ich seit seiner Gründung 2014. Wir betreiben unter anderem das Trainingszentrum für pflegende Angehörige, um das es heute gehen wird.
Christina Krenn
Ich bin Christina Krenn, Physiotherapeutin hier im Geriatrischen Gesundheitszentrum auf der Station. Seit einigen Jahren mache ich gemeinsam mit einer Kollegin aus der Ergotherapie Kurse im Trainingszentrum für pflegende Angehörige.
Simone Koren-Wallis
Ich bin heute hier im Albert-Schweitzer-Trainingszentrum. Wenn man diesen Raum betritt, spürt man sofort, dass das ein ganz besonderer Ort ist.Darum möchte ich mit einer einfachen, aber vielleicht auch sehr persönlichen Frage starten: Was macht dieses Trainingszentrum für euch zu so einem besonderen Platz?
Christina Krenn
Für mich ist besonders, dass hier - abseits der klinischen Arbeit auf den Stationen - ein ganz anderer Austausch passiert. Zwischen Fachpersonal und pflegenden Angehörigen, aber auch unter pflegenden Angehörigen selbst. Man kann Erfahrungen austauschen, Wissen weitergeben und pflegende Angehörige in ihrem täglichen Tun bestärken.
Judith Goldgruber
Das Trainingszentrum ist das Innovationsbaby des Albert-Schweitzer-Instituts und 2018 „auf die Welt gekommen".Pflegende Angehörige sind eine ganz wesentliche Gruppe innerhalb der Pflege in Österreich - nicht wegzudenken. Wenn wir von pflegenden Angehörigen sprechen, reden wir von rund einer Million Menschen. Sie sind der größte Pflegedienst Österreichs, und das muss man sich immer wieder bewusst machen.Rund um das Trainingszentrum und die informelle Pflege basieren auch all unsere Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Insofern ist es ein ganz wichtiger Lernort - und auch eine Spielwiese.
Simone Koren-Wallis
Lernort trifft es gut. Vielleicht darf ich den Raum kurz beschreiben. Wir stellen hier quasi eine Wohnung nach.Was gibt es hier alles?
Judith Goldgruber
Es ist eine Wohnung, wie sie überall in Graz sein könnte - mit normalem Mobiliar und „versteckter" Technik. Technologie, die ein längeres Verbleiben im eigenen Haushalt ermöglicht.Uns ist wichtig, dass pflegende Angehörige, aber auch Senior:innen selbst, unverbindlich hereinschauen können: Wie könnte so eine unterstützende Wohnung aussehen? Wäre das etwas für mich zu Hause? Viele Menschen wünschen sich ein Leben zu Hause im Alter und keinen Umzug ins Pflegeheim. Wenn man gut beraten und informiert ist, Dinge ausprobiert hat und sie sich zu Hause entsprechend einrichtet, steigen die Chancen, diesen Wunsch auch zu verwirklichen.
Es gibt keine fixen Öffnungszeiten, sondern individuelle Termine für die Besichtigung der Musterwohnung. Ein zweites großes - und eigentlich das zentrale - Angebot ist das Kursprogramm für pflegende Angehörige. Niederschwellige Kurse, in denen Pflege- und Betreuungstätigkeiten für zu Hause erlernt werden, sodass man sich unterstützt und gut gerüstet für den Pflegealltag fühlt.
Christina Krenn
Viele besuchen die Kurse auch vorsorglich für sich selbst. Rüstige Senior:innen, die sagen: „Ich will mich rechtzeitig informieren, denn man wird ja nicht jünger."
Simone Koren-Wallis
Das finde ich großartig. Weil die Personen sich schon anschauen, was allein mit der Technik alles möglich ist.
Was heißt hier eigentlich Technik?
Judith Goldgruber
Hilfsmittel aller Art - von ganz einfachen Helferlein bis hin zu etwas mehr Hightech: ein smarter Medikamentenspender, ein mobiler elektrischer Türgong für die Terrasse, Smart-Home-Lösungen wie Licht- oder Jalousiensteuerung per Sprache.Bis hin zu einer barrierefreien Küche, die auch im Rollstuhl nutzbar ist: unterfahrbar, mit absenkbaren Oberschränken. Das ist schon mehr Hightech, aber sehr alltagstauglich.Daneben gibt es viele einfache Hilfsmittel, etwa Sockenanziehhilfen, die sehr beliebt sind.Ein besonders geschätztes Element ist der automatische Herdabschalter. Er lässt sich in jede handelsübliche Küche nachrüsten und schaltet den Herd automatisch ab, wenn etwas vergessen wird - ein wichtiger Schutz vor Bränden.
Christina Krenn
Grundsätzlich gibt es kaum ein Problem, für das es kein Hilfsmittel gibt. Wenn etwas zu Hause nicht mehr so gut gelingt, lohnt sich der Weg ins Orthopädiegeschäft oder eine gezielte Recherche. Für fast alles gibt es Lösungen. Ein Highlight in unseren Kursen ist die Sockenanziehhilfe: simpel, günstig und sehr entlastend, weil man sich nicht bücken muss.
Simone Koren-Wallis
Die hätte ich in meiner Schwangerschaft gebraucht.
Christina Krenn
Vieles ist gar nicht kompliziert. Manchmal reicht ein Schuhlöffel - man muss nur wissen, wie man ihn richtig einsetzt. Genau das zeigen wir.
Judith Goldgruber
All diese Hilfsmittel kann man im Leichter-Leben-Raum ansehen und ausprobieren - gleich gegenüber. Ziel ist immer: ausprobieren, anfassen, informieren und dann gegebenenfalls für zu Hause anschaffen.
Simone Koren-Wallis
Notrufsysteme sind ebenfalls Thema. In der Musterwohnung gibt es eine Notrufuhr, die in den Kursen gemeinsam getestet wird.
Notruftaste wird ausprobiert.
Notruftaste gedrückt. Notruf aktiv. Notruf gesendet. „Hier ist das Rote Kreuz, die Rufhilfe. Ist alles in Ordnung?"
Danke, ist nur ein Test aus dem Albert Schweitzer Trainingszentrum.
Das live zu erleben, nimmt vielen die Hemmschwelle.
Simone Koren-Wallis
Wie laufen die Kurse ab?
Judith Goldgruber
Ein Praxiskurs besteht aus zwei Abenden à drei Stunden. Alle Referent:innen kommen direkt aus der Albert-Schweitzer-Klinik und bringen jahrelange Praxiserfahrung mit.Es wird praktisch gearbeitet: Rollenspiele, Kommunikationstraining, Üben am Bett, im Rollstuhl oder in der Küche - damit die Handgriffe sitzen, wenn man sie zu Hause braucht. Tag der offenen Tür: am 11. Februar, von 14 bis 17 Uhr, findet der Tag der offenen Tür statt - unter dem Motto „Schau auf dich". Selbstfürsorge ist gerade für pflegende Angehörige ein zentrales Thema.Man kann das gesamte Kursangebot kennenlernen, mit Referent:innen sprechen und Kooperationspartner:innen treffen.
Simone Koren-Wallis
Wer kann kommen?
Judith Goldgruber
Jede:r darf kommen. Und es ist wichtig, sich Hilfe zu holen, wenn man sie braucht.Es gibt einen kostenfreien Basiskurs. Spezialkurse kosten 75 Euro, wovon die Steiermärkische Sparkasse 50 Euro übernimmt. Der Selbstbehalt beträgt somit - unter sehr großzügigen Bedingungen - 25 Euro.Neue Kurse starten wieder im Februar. Die Plätze sind begehrt - eine rasche Anmeldung wird empfohlen.
Folge 88: Die Geschichte von Graz und warum keiner weiß, wie alt Graz wirklich ist
Wie alt ist Graz wirklich? Die Antwort überrascht! In dieser Folge tauchen wir mit Historiker und Archivar Wolfram Dornik aus dem Stadtarchiv tief in die Vergangenheit ein - vom Schlossberg als Siedlungsplatz bis zu spannenden Rätseln der Stadtgeschichte. Reinhören und Graz neu entdecken!
„Graz Geflüster", der Podcast der Stadt Graz. Neues Jahr, neue Folge - und trotzdem blicken wir zurück. Und zwar weit zurück, um mehr über die Geschichte unserer Stadt zu erfahren und warum eigentlich niemand genau weiß, wie alt Graz wirklich ist. Bereit für ein Stück Geschichte? Los geht's!
Wolfram Dornik:
Ich bin Wolfram Dornik von der Abteilung Stadtarchiv der Stadtmuseum Graz GmbH. Ich bin Historiker und Archivar und seit über zehn Jahren bei der Stadt Graz.
Simone Koren-Wallis:
Natürlich wird auch im Jahr 2026 Geschichte geschrieben. Bevor das passiert, schauen wir heute weit zurück und teilen Informationen, die alle Grazerinnen und Grazer kennen sollten: die Geschichte unserer Stadt.
Lieber Wolfram, wir fangen ganz früh an: Seit wann gibt es Graz eigentlich?
Wolfram Dornik:
Das ist nicht so leicht zu beantworten. Ich kann kein genaues Jahr nennen - und das hat gute Gründe. Das Hauptproblem bei mittelalterlichen Quellen ist, dass viele gefälscht sind. Auch die Urkunde, die lange als Beleg für das Jahr 1128 galt, ist gefälscht. Das erkennt man daran, dass Personen darin genannt werden, die damals noch gar nicht gelebt haben, und die Umstände nicht zusammenpassen. Wahrscheinlich wurde die Urkunde im späten 12. Jahrhundert verfasst und mit 1128 datiert, um ihr mehr Authentizität zu geben.
Wir können nach heutigem Stand davon ausgehen: Irgendwann im späten 12. oder frühen 13. Jahrhundert wurde Graz zur Stadt. Aber besiedelt war das Gebiet schon lange davor - der Schlossberg war ein perfekter Siedlungsplatz: eine Erhöhung neben einem Fluss, umgeben von fruchtbarem Land. Auch die Hänge im Westen und Osten von Graz waren früh besiedelt. Die Nähe zu Flüssen hat man gemieden, weil sie damals nicht reguliert waren und große Überschwemmungsgebiete hatten.
Simone Koren-Wallis:
Also war Graz schon lange ein wichtiger Ort?
Wolfram Dornik:
Ja, sehr lange. Wir haben Funde aus der Jungsteinzeit, der keltischen und der römischen Zeit. Wahrscheinlich gab es eine Kernsiedlung im Bereich zwischen Stiegenkirche, Freiheitsplatz und Karmeliterplatz. Grabungen bei der alten Universität und im Landesarchiv bestätigen das. Auch die Sporgasse war bedeutend - sie war Endpunkt einer Straße, die von der Mur bis nach Ungarn führte. Graz lag also an einer historischen Kreuzung.
Simone Koren-Wallis:
Und woher kommt der Name „Graz"?
Wolfram Dornik:
„Gradetz" stammt aus dem Slawischen und bedeutet „kleine Burg". Wahrscheinlich gab es auf dem Schlossberg eine kleine Holzburg mit Palisaden, keine Steinburg. Die steinernen Festungen kamen erst später im Hoch- und Spätmittelalter.
Simone Koren-Wallis:
Was fasziniert dich persönlich an der Geschichte von Graz?
Wolfram Dornik:
Die historischen Kontinuitäten. Wenn man durch die Stadt geht, sieht man, wie lange Straßen wie die Sporgasse, Sackstraße, Herrengasse oder Murgasse schon existieren. Mit alten Plänen kann man diese Linien nachvollziehen - das ist für mich das Spannendste.
Simone Koren-Wallis:
Ich habe gelesen, dass wir bald 900 Jahre Graz feiern. Stimmt das jetzt oder nicht?
Wolfram Dornik:
Nein, die Urkunde von 1128 ist gefälscht. Aber: 1928 wurden das Stadtarchiv und das Graz Museum gegründet - als Ergebnis der damaligen Feierlichkeiten. Das heißt, wir feiern heuer ein 100-Jahr-Jubiläum dieser Institutionen. Und wir sollten auch die jüngere Geschichte nicht vergessen, etwa die Architektur des 20. Jahrhunderts und unsere heutigen Daten, damit man in 100 Jahren nachvollziehen kann, wie das Leben im frühen 21. Jahrhundert war.
Simone Koren-Wallis:
Vielen Dank, Wolfram! Wer mehr hören möchte, findet weitere Folgen des Stadt Graz Podcasts - zum Beispiel über den Schlossberg, das Stadtarchiv oder die Nachkriegszeit. Und eine Empfehlung: Die Ausstellung „Ins Ungewisse" zur Nachkriegszeit läuft noch bis Frühjahr im Graz Museum.
Simone Koren-Wallis:
Was tun, wenn die Heizkosten explodieren oder das Geld für das tägliche Leben einfach nicht mehr reicht? Wir zeigen euch heute, wie Sozialunterstützung in der Stadt Graz funktioniert, wenn das Leben aus der Bahn gerät. Bitte stellen Sie sich kurz vor.
Walter Purkarthofer:
Mein Name ist Walter Purkarthofer. Ich leite den Fachbereich Sozialunterstützung mit zwei Referaten. Das ist ein Team mit 47 Personen, und gemeinsam versuchen wir, Menschen in Armut zu helfen.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Menschen in Graz brauchen Sozialunterstützung?
Walter Purkarthofer:
Die Stadt Graz hat rund 300.000 Einwohner:innen. Durchschnittlich beziehen etwa 10.000 Menschen Sozialunterstützung. Zusätzlich gibt es Hilfen in besonderen Lebenslagen, Zusatzleistungen und den Graz-hilft-Fonds. Diese Angebote nehmen jährlich etwa 1.500 bis 2.000 Personen zusätzlich in Anspruch.
Simone Koren-Wallis:
Was sind „besondere Lebenslagen"?
Walter Purkarthofer:
Sozialunterstützung sichert die Basis: Lebensunterhalt, Krankenversicherung und Wohnbedarf. Besondere Lebenslagen entstehen durch Schicksalsschläge wie Krankheit, Scheidung oder unerwartete Ausgaben - etwa wenn Waschmaschine, Herd oder Kühlschrank kaputtgehen oder hohe Stromnachzahlungen anfallen. Sozialunterstützungsbeziehende haben meist keine Rücklagen. In solchen Situationen kann zusätzliche Hilfe beantragt werden.
Simone Koren-Wallis:
Muss man dafür bereits Sozialunterstützung beziehen?
Walter Purkarthofer:
Nein. Für Hilfe in besonderen Lebenslagen oder den Graz-hilft-Fonds muss man nicht Sozialunterstützungsempfänger:in sein. Viele wissen das nicht. Übrigens: Ein Drittel der Sozialunterstützungsbeziehenden sind Kinder, weil in Bedarfsgemeinschaften gerechnet wird.
Simone Koren-Wallis:
Ist es schwer, Hilfe zu beantragen?
Walter Purkarthofer:
Ja, für viele ist es ein großer Schritt. Die meisten versuchen zuerst, selbst über die Runden zu kommen oder sich Geld zu leihen. Oft kommen sie erst, wenn es fast zu spät ist - bei drohender Delogierung oder Exekution. Wir danken unserem Team, das rasch reagiert und versucht, das Schlimmste zu verhindern.
Simone Koren-Wallis:
Wie funktioniert die Antragstellung?
Walter Purkarthofer:
Viele Anträge kommen online. Wir entscheiden auf Basis von Fakten und haben Zugriff auf Registerdaten, um die Hilfsbedürftigkeit festzustellen. Je vollständiger die Unterlagen, desto schneller geht es. Die Stadt Graz deckt rund 60 % der Sozialunterstützungsleistungen in der Steiermark ab und erstellt jährlich etwa 15.000 Bescheide.
Simone Koren-Wallis:
Wie lange dauert die Bearbeitung?
Walter Purkarthofer:
Im Schnitt 26 Tage. Mit vollständigen Unterlagen oft nur eine Woche. Persönliches Vorsprechen ist nicht zwingend erforderlich.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es Geschichten, die besonders berühren?
Walter Purkarthofer:
Ja, viele. Etwa wenn wir eine Delogierung im letzten Moment verhindern oder Familien mit Kindern helfen können. Schön ist auch, wenn Menschen wieder Fuß fassen, Arbeit finden und einen Teil der Unterstützung zurückzahlen können.
Simone Koren-Wallis:
Kann das jede:n treffen?
Walter Purkarthofer:
Ja. Schicksalsschläge können jede:n in Armut bringen - von heute auf morgen.
Simone Koren-Wallis:
Was wünschen Sie Menschen in Not zu Weihnachten?
Walter Purkarthofer:
Frohe, besinnliche Weihnachten. Nach vorne schauen, nicht verharren. Es gibt Menschen, die helfen - und einen Weg aus der Armut.
Graz. Die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz.
Alle Rechte vorbehalten.
Folge 86: Vom Turm zum Wurm: Wie die Koralmbahn den Süden verbindet
Die Koralmbahn geht am 14.12.2025 in Betrieb. In nur 41 Minuten von Graz nach Klagenfurt - das verändert alles. Die Tourismuschefs der beiden Städte Dieter Hardt-Stremayr und Helmut Micheler sprechen über neue Ausflugsmöglichkeiten, internationale Vermarktung und warum die beiden Städte perfekt zusammenpassen. Ein Gespräch über Chancen und Ideen und das mit einer großen Portion Schmäh.
Einleitung
Die neue Koralmbahn verbindet Graz und Klagenfurt - und damit die Steiermark und Kärnten. Sie eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Ausflüge und gemeinsame Erlebnisse. Zwei Städte, ein Lebensgefühl - und wenn zwei Tourismuschefs aufeinandertreffen, gibt's auch ein bisserl Hassliebe.
Interview:
Ich habe lange in Klagenfurt gelebt und ganz ehrlich: Ich hätte mir so eine Verbindung damals schon gewünscht - Graz und Klagenfurt direkt verbunden. Jetzt, 2025, ist es soweit: Die Koralmbahn geht in Betrieb. Was bedeutet das für euch?
Dieter Hardt-Stremayr:
Das bedeutet eine unmittelbare Nähe zu Klagenfurt. Wir müssen erst mit dem Gedanken umgehen und schauen, wie es uns damit geht. Wenn ich Jahrzehnte zurückblicke: Wir hätten uns das damals gewünscht. Aber gleichzeitig wäre uns auch viel Abenteuer abhandengekommen - und vielleicht hätten wir weniger Ausreden gehabt, im schönen Graz zu bleiben. Jetzt müssen wir sehen, wie wir damit umgehen.
Helmut Micheler:
Das Gute ist: Ich darf weiterhin in Klagenfurt wohnen und habe jede Möglichkeit, ganz schnell nach Graz zu kommen. Und vor allem meinen lieben Kollegen Dieter viel öfter als bisher in Graz zu besuchen und gewisse Dinge mit ihm auszuhacken.
Simone Koren-Wallis
Es ist nicht nur beruflich spannend, sondern auch für den Tourismus ein Wahnsinn: In kürzester Zeit ist man von Graz in Klagenfurt - und umgekehrt. Was bedeutet das für den Tourismus?
Helmut Micheler:
Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass sich für uns ein Tagesgäste-Markt auftut, der 300.000 bis 400.000 zusätzliche Gäste bringen kann. Wir wissen, dass die Steirerinnen und Steirer den Wörthersee sehr lieben. Wir gehen stark davon aus, dass wir im Sommer viele von ihnen bei uns begrüßen dürfen.
Simone Koren-Wallis:
Und was bedeutet das für Graz? Wir haben ja keinen Wörthersee ...
Dieter Hardt-Stremayr:
Nein, der Schwarzlsee kann nicht mithalten, der Hilmteich auch nicht. In der Steiermark sage ich immer: Was dort als „See" bezeichnet wird, ist in Kärnten maximal ein größerer Teich. Da steht es 1:0 für Klagenfurt.<
Es gibt weltweit viele „Twin Cities", die herbeigeredet werden. Hier glaube ich, dass es Wirklichkeit werden kann, weil sich die beiden Städte gut ergänzen - eine etwas größer, eine etwas kleiner, charakterlich sehr unterschiedlich. Was mir sofort eingefallen ist: Die Nähe vom Uhrturm in Graz zum Lindwurm in Klagenfurt - in 41 Minuten. Natürlich auch umgekehrt. Ich glaube, es wird einen intensiven Austausch geben - von Bewohner:innen bis hin zu Besucher:innen. Wir haben das mit unserem Team schon ausprobiert: Ein gemütlicher Tagesausflug ist möglich. Natürlich hoffen wir, dass die Ausflüge hauptsächlich von Graz nach Klagenfurt gehen. Helmut hofft das Gegenteil. Aber gemeinsam haben wir die Chance, den Süden Österreichs mit seinen urbanen Zentren stärker zu präsentieren.
Helmut Micheler:
„Urbanzentrum" klingt gut - das hat Graz tatsächlich. Böse Zungen behaupten, es ist ein „Klagendorf" und kein Klagenfurt - aber wir haben den Wörthersee, bis nach Velden erstreckt sich das. Dieter hat recht: Wir ergänzen uns gut. Graz ist größer, mit vielen schönen Boutiquen und Geschäften. Wenn man von der kleinen Großstadt in die richtige große Großstadt möchte, ist das eine tolle Option.
Simone Koren-Wallis:
Was sich liebt, das neckt sich - passt das?
Helmut Micheler:
Ja, das passt. In meiner Studienzeit habe ich festgestellt: Die Steirerwitze, die wir in Kärnten erzählt haben, wurden in der Steiermark wortgleich umgekehrt erzählt. Diese freundliche Rivalität passt gut. Vielleicht sind die Villacher:innen beleidigt, weil wir uns künftig mit den Grazer:innen beschäftigen. Und gut, dass der Semmering noch auf sich warten lässt - sonst reden die Wiener auch noch mit.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es neue Ideen durch die Bahnverbindung?
Dieter Hardt-Stremayr:
Wir arbeiten an einem gemeinsamen Radprojekt entlang der Koralmbahn und darüber hinaus. Außerdem wollen wir international gemeinsam auftreten - in Tschechien, Polen und im oberitalienischen Raum. Für uns beide spannend, weil wir erstmals historisch gut erreichbar sind.
Und eines muss man neidvoll anerkennen: Klagenfurt hat ein größeres Stadion als Graz. Champions-League-Spiele abspenstig zu machen, ist unverzeihlich. Aber Stadionkonzerte in Klagenfurt - da kann Helmut 4.000 Hotelbetten zusätzlich anbieten. Das eröffnet neue Optionen.
Simone Koren-Wallis:
Advent in Graz muss ich den Grazer:innen nicht vorstellen, aber auch das eröffnet neue Möglichkeiten: Ein Adventbummel in Klagenfurt.
Helmut Micheler:
Unser Geheimtipp: Die Adventschifffahrt am Wörthersee und der neue Adventmarkt „Hafenknistern" im Lendhafen - modern, regional, mit Handwerk, guter Küche und Livemusik.
Dieter Hardt-Stremayr:
Und in Graz: Drei Tage Zeit nehmen, sonst gehen sich die 16 Märkte nicht aus. Alles liegt fußläufig beieinander, jeder Markt hat einen eigenen Charakter.
Simone Koren-Wallis:
Wie sieht es mit einem länderübergreifenden Klimaticket aus?
Dieter Hardt-Stremayr:
Das wird schwierig. Wahrscheinlich erst mit einem bundesweiten Klimaticket. Aber es gibt spannende Kombiangebote: Bahn + Bergbahn, Schifffahrt, Museumseintritt - alles zu attraktiven Preisen. Und aktuell kann man im ÖBB-Shop schon ÖV-Tickets für Graz und Klagenfurt zum Bahnticket dazukaufen.
Simone Koren-Wallis:
Was kostet die Fahrt Graz-Klagenfurt?
Dieter Hardt-Stremayr:
Sparschiene: 10 Euro.
Was wünscht ihr euch gegenseitig?
Beide: Alles Gute - und schönes Wetter.
Folge 85: Die Neutorlinie - Die neue Straßenbahnstrecke für Graz

Ab 29. November fährt die Straßenbahn auf der neuen Neutorlinie!
Warum sie die Innenstadt entlastet, welche neuen Haltestellen entstehen und was sich für Fahrgäste ändert, das erklärt der Stv. Betriebsleitung Straßenbahn Thomas Huber-Deutsch von der Holding Graz.
Simone Koren-Wallis:
Ende November ist es endlich soweit: Die neue Neutorlinie startet! Alle Infos zur Innenstadtentlastungsstrecke - warum sie so wichtig ist, welche neuen Linien und Haltestellen kommen und wie sie den Verkehr in Graz verändern wird - das gibt's jetzt im Stadt Graz Podcast.
Thomas Huber-Deutsch:
Ich bin Thomas Huber-Deutsch, Betriebsleiter-Stellvertreter für die Straßenbahn bei den Graz Linien. Ich finde es total aufregend, denn nach so langer Bauzeit geht es jetzt endlich los. Die neue Linie startet am 29. November. Und ich strahle nicht nur - du auch, oder?
Simone:
Ja, so ist es. Es ist ein schönes Gefühl, bald am Ziel zu sein von diesem langen Projekt. Wir haben uns viele Jahre Zeit genommen dafür. Wenn man sich die Historie anschaut: 2011 der erste Beschluss für die Südwestlinie mit der Innenstadtentlastung, mehrmals überarbeitet, dann 2017 das wirkliche Go für den Planungsbeschluss und jetzt - 2025 - acht Jahre später die Inbetriebnahme. Also man kann sich darauf freuen.
Thomas:
Man hört im Hintergrund noch Autos, denn wir schlendern gerade durch die Neutorgasse. Noch keine Straßenbahn - klar, weil sie fährt noch nicht.
Simone:
Was war überhaupt nötig, dass man sagt: Wir planen eine neue Straßenbahnlinie?
Thomas:
Die Grazer Straßenbahn hat als Stammstrecke die Herrengasse, wo alle Linien drüberfahren. Das bringt einerseits eine tolle Anbindung der Innenstadt, aber auch eine hohe Belastung. Was uns mehrmals im Jahr betrifft, sind Behinderungen in der Innenstadt - durch Demonstrationen oder Veranstaltungen wie Aufsteirern oder den Faschingsumzug. Wir freuen uns über diese Events, aber bisher mussten wir den Straßenbahnverkehr durch Busse ersetzen. Es gab keine Möglichkeit, die Herrengasse zu umfahren. Das war einer der Hauptgründe für die Innenstadtentlastung: den Straßenbahnverkehr fließen lassen, Umsteigen vermeiden und gleichzeitig Raum für zukünftige Verdichtungen schaffen.
Simone:
Das bedeutet: Ab Ende November gibt es auch zwei neue Straßenbahnlinien in Graz - die 16 und die 17. Bitte erklär das mal genau.
Thomas:
Die Linien 16 und 17 fahren auf den Strecken der heutigen Linien 6 und 7, aber über die neue Innenstadtentlastungsstrecke - über den Andreas-Hofer-Platz. Zu Beginn gibt es einen reduzierten Fahrplan, die Linien wechseln sich ab. Mit der Lieferung der neuen Alstom-Flexity-Straßenbahnen bis Ende 2026 wird der Zielfahrplan umgesetzt, sodass die Linien 16 und 17 öfter fahren und der Verkehr durch die Neutorgasse dichter wird.
Simone:
Welche neuen Haltestellen kommen dazu?
Thomas:
Zwei neue Haltestellen: Andreas-Hofer-Platz mit Anbindung zum Busbahnhof und als Alternative zum Hauptplatz, und „Bad zur Sonne/Stadtbibliothek" - fußläufig zum Südtiroler Platz. Beide Haltestellen sind 80 Meter lang, damit auch zwei lange Straßenbahnen problemlos halten können. Das ist wichtig, wenn wir bei einer Störung in der Herrengasse alle Straßenbahnen umleiten müssen.
Simone:
Das heißt, bei Sperren am Hauptplatz fahren dann alle Straßenbahnen zwischen Jakominiplatz und Hauptbahnhof über die Ausweichstrecke?
Thomas:
Genau. Wir können bei Veranstaltungen oder Störungen kurzfristig reagieren und die Straßenbahnen umleiten - ohne Schienenersatzverkehr und ohne Umsteigen. Das ist eine enorme Entlastung für Fahrgäste und für uns als Graz Linien.
Simone:
Es ist noch etwas mehr als eine Woche bis zum Start. Was ist bis dahin noch zu erledigen?
Thomas:
Einige Dinge: Aushangfahrpläne, Signale, Fahrpläne einspielen, Haltestellenansagen einpflegen, Weichensteuerungen testen. Alles muss perfekt funktionieren, damit der Betrieb reibungslos läuft.
Simone:
Da stecken ja auch viele Genehmigungen dahinter. Wer ist da alles beteiligt?
Thomas:
Bund, Land Steiermark und Stadt Graz bei Finanzierung und Beschlussfassung. Bei Genehmigungen: Eisenbahnbehörde, Landeshauptmann, Straßenpolizei, Wasserrecht für die Brücke. Es steckt viel mehr dahinter, als man denkt - von Gleisbau über Lärmschutz bis zu Ampelanlagen. Ein großartiges Projektteam hat das umgesetzt.
Simone:
Und die Probefahrten?
Thomas:
Die waren unspektakulär - und das ist gut so. Alles hat funktioniert, die Gutachter waren zufrieden. Jetzt warten wir noch auf die Betriebsbewilligung. Am 29. November geht's los - hoffentlich ganz unspektakulär für alle. Der beste Betrieb ist ein Betrieb ohne Störungen.
Folge 84: Schuleinschreibung: Wunschschule? Oder doch nur Glückssache?
Die Schuleinschreibung in Graz ist kein Lotteriespiel: Gabriele Wilfinger von der Abteilung für Bildung und Integration verrät, wie Eltern mit der Online-Vormerkung ihre Chancen auf die Lieblingsschule erhöhen. Warum Timing (fast) keine Rolle spielt, aber ein kleiner Satz im Formular alles verändern kann.
🎵 Jingle - Graz Geflüster - der Podcast der Stadt Graz
Simone Koren-Wallis:
Und plötzlich wird es ernst - die Kinder kommen in die Schule. Eine aufregende Zeit für Familien!
Aber wie funktioniert das eigentlich mit der Online-Vormerkung? Wann erfahre ich, ob mein Kind einen Platz in einer der vier Wunschschulen bekommt? Und was muss ich beachten?
Darüber spreche ich heute mit Gabriele Wilfinger von der Abteilung für Bildung und Integration.
Gabriele Wilfinger:
Mein Name ist Gabriele Wilfinger. Ich leite den Geschäftsbereich Bildungsservice - kurz „Abi-Service". Viele Eltern in Graz kennen uns bereits.
Simone:
Als Mutter einer mittlerweile achtjährigen Tochter weiß ich, wie stressig diese Phase sein kann. Gabi, wir sind gerade mitten in der Online-Vormerkung. Was genau ist das?
Gabriele:
Die Online-Vormerkung wurde eingeführt, um Eltern die Möglichkeit zu geben, bis zu vier Wunschschulen anzugeben - nach Priorität gereiht. So muss man nicht zwingend die nächstgelegene Schule wählen, sondern kann sich auch für andere passende Schulen entscheiden.
Simone:
Wie lange läuft die Vormerkung und wer kann sie nutzen?
Gabriele:
Sie ist jedes Jahr vom 3. bis zum 13. November geöffnet. Eltern mit Hauptwohnsitz in Graz, deren Kind im Jahr 2026 schulpflichtig wird, können das Online-Formular ausfüllen.
Wir bieten Unterstützung für alle, die Hilfe beim Ausfüllen benötigen - online, telefonisch und auch persönlich.
Simone:
Und wann erfährt man, welche Schule es geworden ist?
Gabriele:
Kurz vor Weihnachten erhalten die Familien eine schriftliche Mitteilung, in welcher Schule das Kind im Jänner eingeschrieben werden kann.
Simone:
Wie funktioniert die Auswahl? Bekommen alle eine ihrer Wunschschulen?
Gabriele:
Die Entscheidung trifft zu 99,9 % die jeweilige Schulleitung. Sie weiß, wie viele Plätze und Klassen zur Verfügung stehen und versucht, möglichst viele Erstwünsche zu erfüllen.
In den meisten Fällen bekommt man eine der vier gewählten Schulen. Wenn sich jedoch sehr viele Kinder für dieselbe Schule anmelden, kann es zu Umverteilungen kommen.
Simone:
Sind auch Privatschulen dabei?
Gabriele:
Einige Privatschulen nehmen teil - das sieht man direkt im Formular. Andere führen eigene Vormerkungen durch. Infos dazu gibt es meist bei Infoabenden der jeweiligen Schule.
Simone:
Was passiert, wenn man keine Vormerkung macht?
Gabriele:
Dann erhält man im Dezember ein Schreiben mit der Aufforderung zur Schuleinschreibung im Jänner. Dort wird das Kind registriert und die Schulreife überprüft.
Die Vormerkung ist freiwillig - aber ohne sie gibt es keine Garantie auf einen Platz in einer Wunschschule.
Simone:
Was sind die Vorteile der Online-Vormerkung?
Gabriele:
Ganz klar: Wahlfreiheit. Eltern können selbst entscheiden, welche Schulen für ihr Kind infrage kommen. Eine der vier gewählten Schulen muss im Umkreis von 1.500 Metern liegen - das System lässt sonst keine Auswahl zu.
So wird sichergestellt, dass Kinder später auch selbstständig zur Schule gehen können.
Simone:
Und wenn es technische Probleme gibt oder Fragen auftauchen?
Gabriele:
Dann kann man sich jederzeit an das Abi-Service wenden - telefonisch unter der Nebenstelle 7474 oder per E-Mail an abiservice@stadt.graz.at.
Wir bieten auch Workshops an, in denen wir beim Ausfüllen helfen. Dolmetscher*innen unterstützen bei sprachlichen Herausforderungen.
Simone:
Gibt es etwas, das noch verbessert werden sollte?
Gabriele:
Das System funktioniert sehr gut. Die Erweiterung auf vier Schulen war sinnvoll. Natürlich sind manche Eltern enttäuscht, wenn sie nicht die Erstwahl bekommen - diese Rückmeldungen nehmen wir ernst und leiten sie weiter.
Simone:
Wie entscheiden die Schulleitungen?
Gabriele:
Es gibt ein Feld im Formular, in dem Eltern begründen können, warum sie eine bestimmte Schule wählen - etwa, weil ein älteres Geschwisterkind bereits dort ist. Diese Angaben werden berücksichtigt und können einen kleinen Vorteil bringen.
Simone:
Was sind deine Tipps für Eltern?
Gabriele:
- Alle vier Schulen auswählen
- Das Bemerkungsfeld ausfüllen - mit einer persönlichen Begründung
- Tag der offenen Tür besuchen und das Gespräch mit der Schule suchen
- Geduld haben - die Zuteilung braucht Zeit
Simone:
Und wann sollte man das Formular abschicken?
Gabriele:
Es gibt kein „First-Come-First-Serve"-Prinzip. Der Zeitpunkt spielt keine Rolle - also kein Stress!
Simone:
Und jedes Kind hat bisher einen Schulplatz bekommen?
Gabriele:
Soweit ich weiß: Ja.
Simone:
Vielen Dank, liebe Gabi, für die vielen hilfreichen Infos!
Graz - die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 83: Einblick in das Grazer Stadtarchiv
Was passiert mit alten Bauakten, Meldezetteln und historischen Dokumenten in Graz? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen des Stadtarchivs: Dunkle Depoträume, säurefreie Kartons und sechs Kilometer Regale voller Geschichte. Archivleiter Wolfram Dornik erzählt, wer Zugang hat, was archivwürdig ist - und wie Graz auch digitale Daten für die Zukunft sichert.
Jingle: Graz Geflüster - der Stadt-Graz-Podcast.
Simone Koren-Wallis:
Heute tauchen wir ein in das Gedächtnis der Stadt Graz, nämlich in das Stadtarchiv. Warum hier Millionen Seiten Papier lagern, warum Tageslicht tabu ist, wer eigentlich Zugang hat und wonach viele Menschen hier suchen - das hört ihr jetzt, direkt aus dem Stadtarchiv.
Wolfram Dornik:
Hallo, ich bin Wolfram Dornik, Leiter des Stadtarchivs Graz innerhalb der Stadtmuseum Graz GmbH.
Simone:
Ich bin heute in der Schiffgasse 4. Ich gestehe, ich war noch nie hier. Das Erste, was mir auffällt, lieber Wolfram: Es ist ziemlich dunkel hier - fast wie bei Maulwürfen. Stimmt das?
Wolfram:
Ja, Tageslicht ist für uns tatsächlich ein Problem. Licht kann Wärme erzeugen, und wo Wärme entsteht, kann Kondenswasser entstehen - und wo Wasser ist, da entsteht leicht Schimmel. Außerdem enthält Licht auch UV-Strahlen, und die schädigen Papier. Deshalb bleiben in unseren Depots die Rollos immer unten, und wir halten die Räume bewusst dunkel.
Simone:
Wir stehen gerade in einem dieser Depots. Ich sehe große blaue Regale auf Rollen. Wie würdest du das beschreiben?
Wolfram:
Wir haben fast im gesamten Haus Rollregalanlagen - so können wir auf wenig Platz sehr viel unterbringen. Alle Unterlagen sind in säurefreien Archivkartons verpackt. Diese schützen nicht nur vor Licht und Staub, sondern auch im Notfall - etwa, wenn gelöscht werden müsste. Dann bieten die Kartons zusätzlichen Schutz.
Simone:
Vor uns stehen zwölf dieser hohen, blauen Regale. Kann man sagen, wie viele Akten allein hier gelagert sind?
Wolfram:
Unsere Maßeinheit ist der Regallaufmeter. Auf einem Regallaufmeter stehen etwa acht Archivkartons, in einem Karton rund 800 Blätter - je nach Papierstärke. Insgesamt haben wir hier rund sechseinhalb Laufkilometer an Regalen. Das bedeutet: Millionen Seiten Papier!
Simone:
Wahnsinn! Und was genau findet man im Stadtarchiv?
Wolfram:
Grundsätzlich alles, was für die Stadtverwaltung einmal wichtig war oder in Zukunft wichtig werden könnte. Wenn Kolleginnen aus der Verwaltung sagen, dass sie Unterlagen weiterhin brauchen, kommen sie automatisch zu uns. Und selbst wenn nicht, prüfen wir, ob sie für die Grazerinnen oder für die Forschung interessant sein könnten - und bewahren sie gegebenenfalls trotzdem auf.
Simone:
Ihr seid hier in einem alten Schulgebäude, richtig?
Wolfram:
Genau, das war früher die sogenannte „Entenschule". Etwa ein Drittel unseres Hauses ist mit Bauakten gefüllt - also mit Unterlagen zu Gebäuden, Wohnungen und Geschäften, die vor 1995 errichtet wurden. Jüngere Bauakten liegen in der Bau- und Anlagenbehörde am Europaplatz. Außerdem lagern hier Meldeunterlagen, Gewerbeakten und vieles mehr - alles, was langfristig erhalten bleiben muss.
Simone:
Wie alt sind die ältesten Dokumente?
Wolfram:
Die ältesten stammen aus dem späten 18. Jahrhundert. Der Schwerpunkt liegt aber ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Leider wurde ein großer Teil der älteren Bestände um 1820 vernichtet, weil sie im feuchten Keller der Ferdinandskaserne verschimmelten. Nur wenige Dokumente aus dieser Zeit haben überlebt.
Simone:
Das war also eine richtige Katastrophe für die Geschichtsforschung?
Wolfram:
Ja, tatsächlich. Der sogenannte „Grazer Moorsturz" - also die Vernichtung der alten Archivalien - ist europaweit bekannt. Seither gilt das als warnendes Beispiel dafür, wie wichtig sorgfältige Aufbewahrung ist. Heute tun wir alles dafür, dass so etwas nie wieder passiert.
Simone:
Wer darf denn überhaupt ins Archiv kommen und Unterlagen einsehen?
Wolfram:
Grundsätzlich alle Menschen - der Zugang zu öffentlichem Archivgut ist ein demokratisches Recht. Es gibt aber Einschränkungen: Datenschutz ist zentral. Persönliche Daten, besonders sensible wie Religionszugehörigkeit oder Gesundheitsdaten, dürfen wir erst 110 Jahre nach dem jüngsten Geburtsdatum freigeben. Auch bei sicherheitsrelevanten Bauakten, etwa von Banken, Polizeistationen oder dem Bundesheer, gelten besondere Zugangsregeln.
Simone:
Also kann ich hier trotzdem Familienforschung betreiben?
Wolfram:
Ja, das ist möglich - vor allem für verstorbene Angehörige. Für Verstorbene gilt der Datenschutz nämlich nicht mehr. Wir helfen gerne bei Recherchen, prüfen aber immer, ob Daten zugänglich gemacht werden dürfen.
Simone:
Wie läuft das ab?
Wolfram:
Wer etwas sucht, stellt einen Antrag. Dann prüfen wir, ob die gesuchten Personen in Graz gelebt haben und ob wir die entsprechenden Unterlagen haben. Teilweise müssen wir jeden einzelnen Meldezettel sichten, um sicherzustellen, dass keine geschützten Daten veröffentlicht werden.
Simone:
Und was kostet das?
Wolfram:
Die erste halbe Stunde Recherche ist kostenfrei. Wenn es länger dauert, gelten die Gebühren laut Grazer Archivtarifordnung. Aber viele Anfragen lassen sich ohnehin schnell klären.
Simone:
Jetzt sind wir im Jahr 2025 - die Digitalisierung schreitet voran. Wie wirkt sich das auf eure Arbeit aus?
Wolfram:
Die Papierunterlagen bleiben wichtig - sie müssen im Original erhalten bleiben. Aber wir digitalisieren zunehmend: Wir scannen Dokumente, Fotos, Pläne und stellen sie in unserer Datenbank bereit. Außerdem speichern wir „Born Digitals", also Unterlagen, die digital entstanden sind, in einem eigenen digitalen Archivsystem, das internationale Standards erfüllt. So bleiben die Daten langfristig sicher und zugänglich.
Simone:
Das klingt nach viel Arbeit!
Wolfram:
Das ist es auch. Aber es ist notwendig. Datenträger werden irgendwann unlesbar oder Systeme veralten. Unsere Aufgabe ist es, die Informationen dauerhaft zu sichern - unabhängig von Hard- und Software.
Simone:
Gibt es eine Geschichte, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Wolfram:
Oh ja, wir haben jedes Jahr rund 800 bis 1000 Anfragen. Unser Kollege, der dafür zuständig ist, recherchiert täglich in den Beständen. Oft geht es um persönliche Schicksale - etwa um Nachweise für Erbschaften oder Staatsbürgerschaften. Wenn wir dabei helfen können, ist das ein schönes Gefühl. Jede Geschichte, jede Anfrage ist wichtig.
Simone:
Und was ist für dich als Archivar das Schönste an der Arbeit?
Wolfram:
Wenn wir Archivgut finden oder retten können - das ist der größte Lohn. Dann wissen wir, dass wir etwas für die Zukunft bewahren, das die Geschichte unserer Stadt lebendig hält.
Folge 82: Grippe, HPV & Co: Die Impfstelle der Stadt Graz
Von Grippe bis HPV - die Impfstelle der Stadt Graz bietet kostenlose Impfungen, persönliche Beratung und hilft beim Überblick über den Impfpass. Amtsärztin Michaela Cartellieri und die Leiterin der Impfstelle Simone Traxler erklären das vielfältige Impfangebot der Stadt Graz: praktische Infos, verständlich erklärt - direkt aus der Impfstelle in der Schmiedgasse.
Graz Geflüster. Der Stadt Graz Podcast. Von Zeckenschutz über HPV bis zur Grippe.
In der Impfstelle der Stadt Graz gibt es Beratung, kostenlose Impfungen und Antworten auf viele, viele Fragen, die ich für euch schon einmal gestellt habe. Ich bin mit dem Mikrofon direkt in der Impfstelle bei der Leiterin und einer Ärztin.
Hallo, mein Name ist Michaela Cartellieri. Ich bin Amtsärztin im Gesundheitsamt und für die Impfagenden zuständig.
Hallo, mein Name ist Simone Traxler. Ich bin die administrative Leiterin der Impfstelle und für das gesamte Impfgeschehen, den Tagesablauf und die Schulimpfungen zuständig.
Für alle, die die Impfstelle der Stadt Graz nicht kennen - wer von Ihnen beiden kann sie mir kurz beschreiben, sodass sich alle auskennen?
Simone Traxler:
Sie finden uns im Amtshaus in der Schmiedgasse im zweiten Stock und gehen einfach den Sonnenblumen nach. Hier finden Sie dann vorne draußen die Impfeinwilligungserklärung, die für jede Impfung ausgefüllt werden muss. Ziehen Sie bitte eine Nummer und sehen dann am Monitor, wann Sie aufgerufen werden.
Was unterscheidet euch von einer Ordination?
Simone Traxler:
Wir sind eine öffentliche Impfstelle. Das heißt, zu uns kann jede Person kommen, egal ob sie in Graz lebt oder nicht. Wir machen Impfberatungen. Menschen kommen mit ihren Impfpässen, weil sie wissen möchten, ob sie noch weitere Impfungen benötigen. Wir führen auch für das gesamte Grazer Stadtgebiet die Impfungen in den Schulen durch - laut dem österreichischen Impfplan - und diese werden den Eltern kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch hier in der Impfstelle gibt es kostenlose Impfungen sowie saisonal bedingte Impfungen, zum Beispiel die Zeckenschutzimpfungen, die jährlich von Februar bis Juli angeboten werden. Und wir starten demnächst wieder mit unserer großen Grippe- und COVID-Impfaktion, die für alle Bürgerinnen und Bürger - auch für jene, die nicht aus Graz kommen - kostenlos ist.
Grippe und COVID kennen wir natürlich seit 2021 vermehrt. Grippe, Zecken - ja. Aber es gibt ja noch einiges mehr. Wo sagen Sie beide: Das würde ich empfehlen oder das gibt es jetzt und bitte nehmen Sie das in Anspruch?
Michaela Cartellieri:
Wir impfen im Auftrag des Landes Steiermark alle Gratisimpfungen für Kinder. Zusätzlich kommt im Jahr 2026 die Impfung gegen Zoster dazu - also Herpes Zoster, die sogenannte Gürtelrose-Impfung, die für alle Personen ab 60 Jahren empfohlen wird. Und die Pneumokokken-Impfung - das ist die Impfung gegen Lungenentzündung - wird ebenfalls für alle Personen ab 60 empfohlen.
Und ich glaube, ganz, ganz wichtig, weil man es immer wieder liest, vor allem für jüngere Menschen bis 30: Stichwort HPV.
Michaela Cartellieri:
Die HPV-Impfung ist aktuell Teil einer sogenannten Nachholaktion. Alle Menschen bis 30 sind eingeladen, eine HPV-Impfung durchzuführen. Man braucht zwei Impfungen im Abstand von sechs Monaten. Wichtig ist, dass die erste Impfung vor dem 30. Geburtstag erfolgt, damit die zweite Impfung noch bis Juni 2026 kostenlos ist.
Und danach kostet es?
Michaela Cartellieri:
Dann kostet es. Eine Impfung liegt ungefähr in der Preisklasse von 200 Euro.
Ich sage es ganz ehrlich: Ich kenne mich da nicht aus. Das heißt, ich kann mit dem Impfpass zu euch kommen, ich ziehe eine Nummer, ihr schaut euch das dann an und sagt mir, was vielleicht zum Auffrischen wäre?
Simone Traxler:
Genau. Sie kommen zu uns, ziehen eine Nummer und legen uns Ihre Impfunterlagen vor. Manche Personen haben mehrere Impfhefte - zum Beispiel noch den aus der Kindheit.
Den grünen? (lacht)
Den grünen, den rosaroten, den himmelblauen - es gibt alles Mögliche. Auch im Zuge der COVID-Impfungen wurden viele neue Impfpässe ausgestellt. Die Menschen kommen dann her und sagen: „Bitte, können Sie mir sagen, ob ich noch Impfungen brauche? Was ist zum Auffrischen?" Und diese Termine können wir den Personen auch mitgeben, weil wir zusätzlich für Erwachsene Auffrischungsimpfungen anbieten - Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten. Laut dem neuen Impfplan sollen diese bereits alle fünf Jahre durchgeführt werden, weil die Antikörper gegen Keuchhusten relativ rasch absinken. Und Keuchhusten tritt nicht nur im Winter auf, sondern auch bereits im Sommer.
Hat sich das Interesse an Impfungen seit der Pandemie irgendwie verstärkt? Merkt ihr einen Zustrom oder vielleicht sogar das Gegenteil?
Simone Traxler:
Kurz nach der Pandemie, nachdem vieles eingeschränkt war, haben sich die Menschen eher bewusst orientiert: Wann brauche ich meine nächste COVID-Impfung? Ich würde sagen, kurzfristig waren die anderen Impfungen eher rückläufig. Das hat sich aber stark wieder aufgeholt. Das Interesse ist nach wie vor groß. Wenn man auch schaut: Wir haben jedes Jahr immer wieder Masernfälle. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und es wird auch sehr stark publiziert - von allen Seiten, auch von der Kinderklinik -, dass der Impfstatus regelmäßig kontrolliert werden soll.
Aber es ist natürlich auch so - und ich glaube, man muss das ansprechen - dass es seit der Pandemie mehr Fälle gibt, in denen Menschen sagen: „Nein, ich lasse mich nicht mehr impfen."
Michaela Cartellieri:
„You don't like the vaccine - try the disease."
Das Problem ist: Impfgegner*innen erreicht man sehr schwer. Das liegt auch daran, dass viele junge Menschen die Infektionskrankheiten, die wir durch Impfungen zurückgedrängt haben, nicht mehr kennen. Sie fürchten sich mehr vor einer Impfung, die potenzielle Nebenwirkungen haben könnte, als vor der Erkrankung selbst - weil sie die Krankheit gar nicht mehr kennen.
Aber dann kommt oft dieser Satz: „Ich bin früher auch nicht daran gestorben. Ich hatte auch die Masern." Ich kenne das selbst. Was sagt man da?
Michaela Cartellieri:
Der natürliche Verlauf einer Kinderkrankheit ist im Erwachsenenalter in der Regel deutlich schwerer.
Aber wie Sie gesagt haben: Die Personen, die sagen „Ich lasse mich nicht impfen", kann man wahrscheinlich schwer umstimmen, oder?
Michaela Cartellieri:
Die kann man sicher schwer umstimmen. Und die kommen auch nicht zu uns in die Impfstelle.
Die trifft man dann eher privat, oder?
Michaela Cartellieri:
Ja, die trifft man oft privat. Aber es ist schwierig, sie anzusprechen. Missionieren ist immer schwierig, weil das zwei festgefahrene Meinungen sind. Auf der einen Seite meine Meinung als absolute Impfbefürworterin, auf der anderen Seite die Meinung als absolute Impfgegner*in. Da ist selten ein gemeinsamer Nenner zu finden.
Habt ihr da trotzdem vielleicht in der Impfstelle schon einmal irgendwelche Fälle gehabt, wo ihr dann positiv überrascht worden seid?
Simone Traxler:
Naja, im Laufe der Jahre merkt man schon, wie man mit - ich sage jetzt gar nicht rein Impfgegnerinnen, sondern Impfkritikerinnen - umgehen kann. Das heißt, sie sind sich nicht sicher, was sie machen sollen. Die Tendenz ist zwar eher, dass sie sagen: „Ich lasse mich nicht impfen", aber sie kommen trotzdem, weil sie gerne wissen möchten, was der Hintergrund ist. In erster Linie ist Beratung wirklich oberstes Gebot. Und dann können sie sich immer noch entscheiden: Lasse ich mich impfen oder lasse ich mich nicht impfen?
Und wir bieten auch an: Sie müssen sich heute nicht entscheiden. Überlegen Sie es sich, kommen Sie ein anderes Mal. Sie können uns jederzeit gerne anrufen. Das ist das große Angebot, das wir wirklich für solche Eltern und Personen bereitstellen. Und da haben wir auch positive Fälle, wo jemand sagt: „Ich habe es mir jetzt überlegt, ich komme impfen."
Das heißt, für solche Situationen ist bei euch auch Zeit? Es ist nicht so, dass man eine Nummer zieht, reingeht, sagt: „Ich brauche eine Impfung", zack, bumm, wieder raus. Sondern ihr habt auch Zeit für Beratung?
Simone Traxler:
Wir haben nicht nur hier Zeit für Beratung. Auch beim Schulimpfen ist es so, dass die Kolleg:innen vor Ort die Impfpässe der Kinder anschauen, den Eltern Termine mitgeben oder aufschreiben, welche Impfungen noch notwendig sind oder fehlen. Das Gleiche machen wir hier. Es wird jeder Impfpass durchgeschaut, auch wenn jemand bewusst sagt: „Ich komme zu dieser und jener Impfung." Und dann sagen wir: „Das könnten Sie bitte auch auffrischen. Sie können diese Impfung heute mitmachen. Wenn es Ihnen aber zu viel ist, zwei Impfungen auf einmal zu bekommen, können Sie gerne in zwei, drei Wochen wiederkommen." Ich muss sagen, dieses Angebot wird sehr gerne angenommen.
Aber warum ist es trotzdem so schwierig, Frau Doktor? Was hat sich da verändert?
Michaela Cartellieri:
Internet. Sicher auch die sozialen Medien, wo Informationen verbreitet werden, die tatsächlich nicht stimmen. Und die werden von vielen Menschen - auch jungen - gelesen und geglaubt. Sie werden nicht als das erkannt, was sie sind. Und diese Personen glauben dann auch nicht der Schulmedizin, weil sie von vornherein dagegen eingestellt sind.
Wir haben Oktober. Die sehr stressige Zeit kommt für euch erst. Aber wie schaut das jetzt aus, wenn ich sage: Ich will jetzt einen Termin bei euch. Wie mache ich das am besten?
Simone Traxler:
Sie können den Termin online buchen unter eTermin.net/stadtgraz - täglich von 8 bis 10 Uhr. Wir haben aber auch ein kostenloses Serviceangebot: Alle Grazer:innen, die im Vorjahr bei uns zur Grippeimpfung waren, bekommen automatisch wieder eine Einladung, dass sie heuer kommen können. Hier ist dann ein genauer Zeitraum festgesetzt. Aber auch alle anderen, die keinen Termin bekommen, können in diesem Zeitraum täglich ab 10:15 Uhr bis 12:30 Uhr ohne Termin zur Impfung kommen. Man muss nur mit Wartezeiten rechnen, aber das Angebot wird sehr gut angenommen.
Wie viele Impfungen habt ihr schon verabreicht? Könnt ihr das noch zählen?
Michaela Cartellieri:
Nein, das kann ich nicht zählen. Ich frage immer am Ende des Tages: „Wie viele waren heute?" Und wenn dann 350 Personen da waren, denke ich mir: Das war schon viel. Meistens sind wir dann auch zu zweit beim Impfen, weil es sonst nicht mehr machbar ist.
Ihr müsst ein super Team sein, dass das alles so funktioniert - wenn dann jemand für eine andere Person einspringt und so weiter, oder?
Simone Traxler:
Ja, wir sind ein sehr eingespieltes Team. Das heißt, nicht nur die Impfassistent:innen, sondern auch die Ärzt:innen sind sehr kollegial untereinander. Sonst funktioniert unser Rädchen nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und wir wollen ja für die Bevölkerung das bestmögliche Service anbieten.
Hinzu kommt, dass wir eben saisonale Impfungen anbieten - wie jetzt die FSME-Impfung - und Auffrischungsimpfungen für Erwachsene: Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten. Diese sind kostenpflichtig. Die Grippe- und COVID-Impfungen sind heuer wieder kostenlos. Und ganz wichtig: Die Masern-Mumps-Röteln-Impfung ist für alle Altersgruppen von 0 bis 99 kostenlos.
Jetzt kenne ich das selbst von mir: Ich bin nicht so die Nadelfreundin und denke mir immer - weggeschaut, nein, ich kann nicht hinschauen und so weiter. Wie geht es euch da mit den Kindern? Oder wie geht es den Kindern mit euch?
Michaela Cartellieri:
Das ist sehr unterschiedlich. Manche Kinder setzen sich einfach hin, lassen sich impfen und gehen wieder weg. Andere machen großes Theater, werfen sich auf den Boden, sind zornig. Positiv kann man sagen: Die Grippeimpfung für Kinder ab zwei Jahren bis 18 erfolgt über einen Nasenspray. Das heißt, da gibt es keinen Stich - und das wird sehr gut angenommen.
Kann ich die auch haben?
Leider nein, weil Sie schon über 18 sind. (lachen)
Folge 81: Die beste Geschenkidee - der Graz Gutschein
In 3 Monaten ist Weihnachten - ob Blumen, Bücher oder Bauernmarkt: Der Graz Gutschein ist so vielseitig wie die Stadt selbst. Was steckt hinter dem größten städtischen Gutschein-System im deutschsprachigen Raum, wie der Gutschein die lokale Wirtschaft stärkt und warum er das ganze Jahr über das perfekte Geschenk ist, erzählt Carola Kamencek von der Holding Graz.
Graz Geflüster - Der Stadt Graz Podcast
Nur noch drei Monate bis Weihnachten!
Und wer sagt, Gutscheine seien unpersönlich, hat den Graz Gutschein noch nicht kennengelernt.
In dieser Folge sprechen wir über die Graz Gutscheine:
Wo man sie einlösen kann, warum sie nicht nur praktisch, sondern auch persönlich sind - und wie sie die lokale Wirtschaft stärken.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation und heute direkt in der Graz Gutschein-Zentrale.
Hallo, mein Name ist Karola Kamenczak. Ich leite die Abteilung Vertriebsmanagement im Bereich Marketing der Holding Graz.
Weihnachten steht vor der Tür - und Graz Gutscheine sind gefragt
In drei Monaten ist Weihnachten - unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht!
Falls es tatsächlich noch eine Grazerin oder einen Grazer gibt, die oder der noch nie vom Graz Gutschein gehört hat (was wir uns kaum vorstellen können):
Was ist der Graz Gutschein?
Der Graz Gutschein ist das größte städtische Gutschein-System im deutschsprachigen Raum.
In Graz gibt es über 1.000 Partnerbetriebe, bei denen der Gutschein eingelöst werden kann.
Er ist an sieben Verkaufsstellen sowie im Online-Shop erhältlich.
Seit 2020 ist der Graz Gutschein bei der Holding Graz angesiedelt - davor war er bei Graz Tourismus. Seitdem arbeiten wir intensiv daran, das Angebot laufend zu verbessern, damit möglichst viele Menschen den Gutschein nutzen und das Geld in der Grazer Wirtschaft bleibt.
Lokal statt Online - Vielfalt für alle Zielgruppen
Gerade in Zeiten des boomenden Online-Handels ist es uns wichtig, dass das Geld bei lokalen Betrieben bleibt.
Deshalb achten wir darauf, dass alle Zielgruppen passende Angebote finden.
Der Gutschein ist in 25 Kategorien einlösbar - von Mobilität über Produkte des täglichen Bedarfs bis hin zu Büchern, Garten, Blumen, Apotheken, Drogerien und vielem mehr.
Dieses Jahr haben wir den tausendsten Partnerbetrieb gefeiert - ein großer Meilenstein!
Auch für Unternehmen attraktiv - steuerfrei schenken
Besonders im B2B-Kontext ist der Graz Gutschein interessant:
Unternehmen können bis zu 186 Euro pro Person und Jahr steuerfrei als Betriebsausgabe in Form von Gutscheinen verschenken.
Wir bieten spezielle Pakete an - inklusive individueller Gestaltung der Gutschein-Kuverts oder Hüllen im Corporate Design des Unternehmens.
Unternehmer*innen können uns jederzeit kontaktieren - telefonisch oder online über eine Terminanfrage. Wir beraten gerne!
Persönlich und vielseitig - Graz erleben mit dem Gutschein
Viele sagen, Gutscheine seien unpersönlich - aber das stimmt beim Graz Gutschein nicht:
Mit dem Print@Home-Gutschein kann man ein eigenes Foto und einen persönlichen Text einfügen - das macht das Geschenk individuell.
Und: Wer in Graz lebt oder zu Besuch ist, kann mit dem Gutschein die Stadt entdecken - von Gastronomie über Freizeitangebote bis hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ich habe den Gutschein sogar letztes Jahr nach Deutschland verschenkt - mit dem Hinweis: „Ihr müsst wieder nach Graz kommen, um ihn einzulösen."
Zahlen & Fakten
Im letzten Jahr wurden Graz Gutscheine im Wert von 9,3 Millionen Euro verkauft - und rund 9 Millionen Euro davon wurden auch tatsächlich eingelöst.
Das zeigt, wie stark der Gutschein zur lokalen Wirtschaft beiträgt.
Wo kann man Graz Gutscheine kaufen?
Neben dem Online-Shop gibt es Verkaufsstellen bei:
- Graz Tourismus (Herrengasse)
- Trafik am Jakominiplatz
- Trafik am Hauptplatz
- Trafik am Andritzer Hauptplatz
- Apotheke zum Grünen Kreuz (Ahnenstraße)
- Musikverein Graz (Kongress)
Wo sehe ich, ob ein Betrieb Partner ist?
- Auf der Website
- In unserem Partnerbetriebe-Folder
- Bei den Verkaufsstellen
- Oder einfach telefonisch bei uns nachfragen
Viele Betriebe kennzeichnen sich mit einem Graz Gutschein-Sticker - so erkennt man sie auch beim Spaziergang durch die Stadt.
Auch am Bauernmarkt einlösbar?
Ja! Der Gutschein ist sogar bei den Grazer Bauernmärkten gültig - für Eier, Fleisch und vieles mehr.
Das zeigt, wie vielseitig der Graz Gutschein ist.
Wer steckt hinter dem Graz Gutschein?
Ein engagiertes Team von vier Personen kümmert sich um:
- Verkauf
- Rücklösung
- Kommunikation mit Partnerbetrieben und Verkaufsstellen
- Kund*innenanfragen (online, per Mail oder telefonisch)
Natürlich unter strengen Kontrollprozessen - denn der Gutschein wird wie Bargeld behandelt.
Und zum Schluss: Was schenkst du zu Weihnachten?
Natürlich: Graz Gutscheine!
Folge 80: Vaterschaft und Kindesunterhalt - was Eltern wissen sollten
Eine wichtige Folge für alle Eltern: Es geht um Vaterschaft und Kindesunterhalt - also was passiert, wenn zum Beispiel die Vaterschaft nicht anerkannt wird oder wie wird der Unterhalt geregelt, wenn die Eltern getrennt leben? Das und vieles mehr beantwortet Katharina Landgraf aus dem Amt für Jugend und Familie!
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis
Das ist eine wichtige Folge für alle Eltern. Es geht heute um Vaterschaft und Kindesunterhalt.
Also: Was passiert, wenn eine Vaterschaft zum Beispiel nicht anerkannt wird? Oder wie wird der Unterhalt geregelt, wenn die Eltern getrennt leben?
Diese und viele weitere Fragen beantwortet heute das Amt für Jugend und Familie.
Hallo, mein Name ist Katharina Landgraf, und ich leite das Referat für Kindesunterhalt und Vaterschaft im Jugendamt der Stadt Graz.
Katharina, „Kindesunterhalt und Vaterschaft" klingt vielleicht selbsterklärend. Aber kannst du einmal ganz einfach erklären: Worum geht es dabei genau?
Katharina Landgraf:
Es gibt zwei große Themenbereiche: die Vaterschaft und den Kindesunterhalt.
Wenn die Eltern nicht verheiratet sind, muss die Vaterschaft anerkannt werden. Tut der Vater das freiwillig, geschieht das beim Standesamt der Stadt Graz. Ist er sich unsicher oder möchte er die Vaterschaft nicht anerkennen, stellen wir beim Gericht einen Antrag. Dort wird dann durch ein Gutachten festgestellt, ob er der Vater ist oder nicht.
Gerade weil es manchmal zwischenmenschliche Probleme gibt, ist das Gericht als neutrale Stelle besonders wichtig. Das Gutachten klärt eindeutig: Ist dieser Mann der Vater oder nicht?
Und in weiterer Folge stellt sich dann die Frage: Besteht auch eine Unterhaltspflicht? Also: Leben die Eltern getrennt oder leben sie mit dem Kind gemeinsam in einem Haushalt?
Simone Koren-Wallis:
Und was bedeutet Kindesunterhalt genau?
Katharina Landgraf:
Eltern sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Kinder zu sorgen - auch finanziell.
Leben sie zusammen, dann leisten sie den sogenannten Naturallebensunterhalt: Wohnen, Essen, Kleidung, Spielzeug, alles, was dazugehört.
Wenn die Eltern getrennt sind, lebt das Kind in der Regel bei einem Elternteil. Wir nennen das den haushaltsführenden Elternteil. Der andere Elternteil, der nicht im selben Haushalt lebt, ist der unterhaltspflichtige Elternteil.
Oft lebt das Kind bei der Mutter, aber das ist nicht immer so. Deshalb sprechen wir bewusst von „haushaltsführend" und „unterhaltspflichtig" - und nicht von Vater und Mutter.
Unser Jugendamt ist für den Kindesunterhalt bis zum 18. Geburtstag zuständig. Ab der Volljährigkeit muss das Kind seine Angelegenheiten selbst regeln. Unterhalt kann aber auch darüber hinaus geschuldet sein - etwa wenn das Kind studiert. Umgekehrt kann die Pflicht enden, sobald das Kind selbsterhaltungsfähig ist, also ein eigenes Einkommen über einer bestimmten Grenze hat.
Diese Grenze wird jedes Jahr angepasst.
Simone Koren-Wallis:
Das klingt nach großem Konfliktpotenzial ...
Katharina Landgraf:
Ja, absolut. Kindesunterhalt betrifft drei hochemotionale Themen: eine zerbrochene Beziehung, Kinder und Geld.
Es gibt viele Eltern, die sehr vernünftig sind und sagen: „Wir passen als Paar nicht zusammen, aber wir kümmern uns gemeinsam ums Kind." Sie treffen dann selbst Vereinbarungen.
Leider gibt es auch Fälle, in denen die Kommunikation so schlecht geworden ist, dass wir als Rechtsvertretung des Kindes einspringen und den Unterhalt festsetzen müssen - manchmal einvernehmlich, manchmal mit Gerichtsantrag.
Simone Koren-Wallis:
Gab es in deiner Karriere Fälle, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Katharina Landgraf:
Ja, da gibt es viele. Ein sehr schöner Fall war ein junger Mann, der unsicher war, ob er Vater ist. Als das Gutachten bestätigt hat, dass er es ist, hat er mich überglücklich angerufen. Er und die Mutter sind dann gemeinsam zu uns gekommen, um sich zu bedanken. Danach haben wir nichts mehr von ihnen gehört - vermutlich, weil sie jetzt als Familie glücklich sind.
Auf der anderen Seite gibt es auch sehr schwere Fälle. In einem Fall gab es sogar einen Mordversuch. Der Vater sitzt im Gefängnis, und die Kinder erhalten Unterhaltsvorschuss. Solche Fälle sind selten, aber sie gehen sehr nahe und bleiben unvergesslich.
Simone Koren-Wallis:
Hast du selbst Kinder?
Katharina Landgraf:
Ja, ich habe zwei Kinder. Dadurch kann ich die Sorgen und Nöte vieler Eltern gut nachvollziehen. Ich habe das Glück, in einer stabilen Beziehung zu leben, sodass ich mich privat nicht mit Unterhaltsfragen auseinandersetzen muss. Aber durch meine eigene Elternschaft kann ich mich gut in die Anliegen hineinversetzen.
Gerade zum Beispiel beim Start in den Kindergarten kennen viele Eltern die bürokratischen Wege. Dann kommt zusätzlich noch das Thema Unterhaltsvereinbarung dazu - das ist für viele eine Belastung.
Simone Koren-Wallis:
Kann man den Unterhalt irgendwie festlegen? Gibt es fixe Beträge oder hängt alles vom Einkommen ab?
Katharina Landgraf:
Der Kindesunterhalt ist sehr individuell. Es hängt ab vom Alter des Kindes, vom Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils und auch davon, wie viel Zeit das Kind mit dieser Person verbringt.
Es kann also sein, dass ein Elternteil für drei Kinder ganz unterschiedliche Beträge zahlt: eines verdient schon selbst, eines lebt zur Hälfte bei ihm, das dritte kaum.
Eine einfache Richtlinie gibt es leider nicht. Und auch einen gesetzlichen Mindestunterhalt gibt es in Österreich nicht. Wenn ein Elternteil sehr viele Sorgepflichten hat und wenig verdient, kann der Betrag auch einmal nur 25 Euro betragen.
Simone Koren-Wallis:
Da hört man ja oft: „Du willst nur mein Geld" oder „Du willst mich ausnehmen". Wie geht ihr damit um?
Katharina Landgraf:
Unser Auftrag ist klar: Wir vertreten ausschließlich das minderjährige Kind - nicht die Mutter, nicht den Vater.
Es gibt auch eine gesetzliche Obergrenze, den sogenannten Regelbedarf. Riesige Summen wie in anderen Ländern sind bei uns nicht möglich.
Wir erinnern die Eltern immer wieder: Es geht um das Kind. Es geht um seinen Rechtsanspruch, seine Bedürfnisse. Und jedes Kind kostet - das wissen alle, die Kinder haben.
Simone Koren-Wallis:
Graz ist vielfältig. Wie spürt ihr das in eurer Arbeit?
Katharina Landgraf:
Sehr stark. Wir haben alle sozialen Gruppen bei uns, von Arbeiter:innen bis zu Universitätsprofessor:innen. Manche Familien haben ein Kind, andere sieben.
Dazu kommt die sprachliche Vielfalt. Viele unserer Unterlagen gibt es zweisprachig, unsere Erklärvideos mit mehrsprachigen Untertiteln. Bei Beratungen arbeiten wir mit professionellen Dolmetscher:innen, weil Kinder nicht als Übersetzer:innen eingesetzt werden dürfen.
Simone Koren-Wallis:
Wenn jetzt jemand merkt: Die Beziehung geht auseinander und Kinder sind da - wie geht man am besten vor?
Katharina Landgraf:
Sind die Eltern verheiratet und eine Scheidung steht an, kann der Kindesunterhalt im Scheidungsurteil geregelt werden.
Besteht keine Ehe oder keine Scheidung, können sich Eltern direkt an uns wenden, sobald getrennte Haushalte vorliegen. Dann gibt es bei uns eine Erstberatungsstelle und ein Online-Formular.
Unter www.graz.at/kindesunterhalt stehen alle Informationen, welche Unterlagen nötig sind, und die Kontaktdaten der Erstberatung (Durchwahl 3120).
Simone Koren-Wallis:
Kommt es nicht auch vor, dass ihr so etwas wie „Blitzableiter" seid, wenn Eltern sehr wütend sind?
Katharina Landgraf:
Ja, das passiert. Oft sind es keine fachlichen Beschwerden, sondern die allgemeine Überforderung. Ich versuche dann zuzuhören, Orientierung zu geben und die nächsten Schritte aufzuzeigen.
Für viele ist das Thema völlig neu, und wir wollen die Scheu nehmen, Hilfe von einem Amt anzunehmen. Genau dafür sind wir da.
Simone Koren-Wallis:
Und was passiert, wenn ein Elternteil gar nicht zahlt?
Katharina Landgraf:
Dann übernehmen wir die Durchsetzung. Wir bringen im Namen des Kindes einen Exekutionsantrag beim Gericht ein. Reicht das nicht, prüfen wir, ob ein Unterhaltsvorschuss möglich ist.
Wichtig ist: Auch wenn der Kontakt zum Kind nicht funktioniert - das Kind ist daran unschuldig. Der Anspruch bleibt bestehen, weil es einfach das Geld braucht, um gut leben zu können.
Am Ende geht es immer nur um eines: das Kind.
Folge 79: Tipps von der Pilzberatung der Stadt Graz
Genießbar oder doch giftig? Viele essbare Pilze haben gefährliche Doppelgänger. Wie Sie sich vor Vegiftungen schützen, welche Arte besonders häufig verwechselt werden und wo Sie in Graz professionelle Pilzberatung bekommen, das erklärt einer der Pilzexperten schlechthin: Christian Siedl vom Referat Lebensmittelsicherheit und Märkte!
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis
Wir sind mittendrin in der Schwammerlsaison. Das Problem dabei: Viele essbare Pilze haben gefährliche Doppelgänger. Aber wie erkennt man die genau? Wenn ich mir unsicher bin, gehe ich auf jeden Fall zur Pilzberatung. Dort gibt es viele hilfreiche Tipps zum Schwammerlsuchen.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation und heute bei einem Pilzexperten der Stadt Graz.
Christian Siedl
Hallo, mein Name ist Christian Siedl. Ich leite das Referat für Lebensmittelsicherheit und Märkte. Bei uns gibt es ein großartiges Angebot: die sogenannte Pilzbestimmung.
Simone Koren-Wallis
Ich bin heute in der Lagergasse im Referat für Lebensmittelsicherheit und Märkte. Lieber Christian, heute ist Mittwoch - das heißt, dein Büro ist offen für alle Grazer*innen, die irgendwo einen Pilz gefunden haben und sich nicht ganz sicher sind, was das für einer ist. Wie läuft das ab? Bitte erklär uns das.
Christian Siedl
Montags und mittwochs kann man von 8 bis 12 Uhr ohne Anmeldung in die Lagergasse kommen - mit dem Fund, den man vielleicht mit der Familie oder mit Freund*innen gemacht hat. Wenn man sich unsicher ist, kommt man einfach zu mir ins Büro, und wir bestimmen gemeinsam, ob der Pilz genusstauglich ist.
Simone Koren-Wallis
Warum kannst du das eigentlich?
Christian Siedl
In der Ausbildung zur Lebensmittelinspektorin bzw. zum Lebensmittelinspektor ist das Thema Pilze ein eigener Schwerpunkt. Wir vollziehen nicht nur das Lebensmittelrecht, sondern sind auch für die Lebensmittelsicherheit zuständig. Pilze sind Lebensmittel - und wenn sie in Umlauf gebracht werden, muss man sicherstellen, dass sie genusstauglich sind. Deshalb werden wir auch speziell auf Pilze geschult.
Simone Koren-Wallis
Wie viele Pilzarten gibt es eigentlich?
Christian Siedl
Weltweit gibt es schätzungsweise bis zu 3,8 Millionen verschiedene Pilzarten.
Davon sind etwa 120.000 wissenschaftlich beschrieben.
In Österreich gibt es rund 17.000 Pilzarten, darunter etwa 4.500 Großpilzarten.
Großpilze sind jene, die man mit freiem Auge erkennen kann.
Simone Koren-Wallis
Und du kennst sie alle?
Christian Siedl
Nein, alle kenne ich nicht - aber ich erkenne gut 50 Pilzarten sicher.
Simone Koren-Wallis
Kann man sich denn wirklich immer zu 100 % sicher sein?
Christian Siedl
Nein, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht - außer man beschäftigt sich schon sehr lange und intensiv mit bestimmten Pilzarten.
Die Österreicherinnen sind leidenschaftliche Pilzesammlerinnen - das zeigen auch unsere Statistiken. Viele kommen zur Pilzberatung, obwohl sie glauben, die Pilze zu kennen - einfach, um eine zweite Meinung einzuholen.
In der Steiermark sind besonders Eierschwammerl, Steinpilze und Parasole beliebt.
Bei der Beratung zeigen wir oft auch andere genießbare Pilze - und viele sind überrascht und beginnen, neue Arten zu sammeln.
Mein Tipp: Wenn man keine Pilze kennt, sollte man nur jene sammeln, die man wirklich sicher erkennt - also die klassischen drei. Alle anderen bitte unbedingt vor dem Verzehr begutachten lassen.
Letzte Woche hatten wir einen besonderen Fall: Ein älterer Herr kam zu mir und erzählte, dass er früher für seine Kinder Pilze gesammelt hat - darunter auch den Grünen Täubling, den er besonders mochte.
Er rief mich an und sagte: „Ich habe die Pilze schon gegessen, aber nur die Stiele aufgehoben - jetzt bin ich unsicher."
Das ist genau das, was man nicht machen sollte.
Der Stiel vom Grünen Knollenblätterpilz sieht anders aus als der vom Täubling.
Zum Glück konnten wir die Angst nehmen: Die Stiele waren glatt und brüchig - ein klares Zeichen für den Täubling.
Und da er den Pilz schon vor drei Tagen gegessen hatte und keine Beschwerden wie Schwindel, Übelkeit oder Schweißausbrüche hatte, konnten wir Entwarnung geben.
Bitte ruft uns an - wir sind nicht nur Montag und Mittwoch erreichbar. Auch außerhalb dieser Zeiten kann man telefonisch einen Termin vereinbaren oder spontan anrufen. Wenn ich gerade keinen Termin habe, nehme ich mir gerne Zeit für eine Bestimmung.
Simone Koren-Wallis
Hast du schon einmal jemandem das Leben gerettet?
Christian Siedl
„Leben gerettet" ist vielleicht übertrieben - aber es kommt oft vor, dass Pilzsammler*innen alles in einen Korb werfen.
Das sollte man unbedingt vermeiden, besonders wenn man die Pilze bestimmen lassen möchte.
Wir erleben es leider häufig, dass neben Steinpilzen oder Parasolen auch Knollenblätterpilze im Korb sind.
Dann müssen wir alle Pilze entsorgen - denn die Sporen des Knollenblätterpilzes sind hochgiftig und können die Leber zerstören.
Deshalb: Pilze bitte immer getrennt sammeln - am besten in einem Korb oder einem Stoffsackerl.
Viele kommen leider noch mit Plastiksackerln - darin beginnen die Pilze zu schwitzen und zu schimmeln.
Auch genießbare Pilze wie Steinpilze müssen dann weggeworfen werden.
Also: Wenn ihr euch die Mühe macht, Pilze zu sammeln - bitte richtig lagern!
Christian Siedl
Wichtig ist: festes Schuhwerk und ein Messer mitnehmen. Pilze sollten geschnitten und nicht einfach abgebrochen werden - das ist oft schwierig und kann wichtige Merkmale zerstören.
Der typische Pilzsammler bzw. die typische Pilzsammlerin verrät die Fundorte natürlich nicht.
Aber heuer ist ein sehr gutes Pilzjahr - vor allem, weil der Juli sehr regenreich war.
In der Steiermark, besonders in der Packgegend, findet man derzeit einiges.
Simone Koren-Wallis
Wie viel darf man denn überhaupt mitnehmen? Ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, oder?
Christian Siedl
Das regelt das Forstgesetz.
Erlaubt sind zwei Kilogramm pro Tag und pro Person.
Das ist wichtig und sollte unbedingt eingehalten werden.
Man sollte auch immer darauf achten, ob irgendwo ein Schild angebracht ist, das das Sammeln ausdrücklich verbietet - etwa vom Waldbesitzer oder der Waldbesitzerin.
Wenn so ein Hinweis vorhanden ist, muss man das respektieren.
Aber wenn kein Verbot ausgeschildert ist, gelten die zwei Kilo pro Tag.
Simone Koren-Wallis
Du hast vorher die drei üblichen Speisepilze erwähnt, die wohl fast alle schon einmal gesammelt haben.
Aber du hast auch gesagt, es gibt noch ein paar andere, die wirklich hervorragend schmecken - besonders, wenn man sie anbrät.
Gibt es da welche, die du besonders empfehlen würdest?
Christian Siedl
Mein Lieblingspilz ist der Fichtenreizker - den kennen nur wenige.
Er ist ähnlich wie das Eierschwammerl, aber sein Merkmal ist: schön gelb und auf der Oberfläche grünlich verfärbt - wie Grünspan.
Man findet ihn oft am Waldrand, besonders bei Fichten.
Er ist schön knackig und lässt sich gut zubereiten - ähnlich wie das Eierschwammerl.
Auch Täublinge sind sehr gut - besonders die Frauentäublinge in Blau- und Weinrot-Tönen.
Ich esse sie sehr gerne.
Dann gibt es noch den Safranschirmling - ein kleiner Verwandter des Parasols.
Er verfärbt sich leicht rötlich, daher auch der Name.
Simone Koren-Wallis
Die häufigste Verwechslung, die ja auch tödlich enden kann, ist die zwischen dem Parasol und dem Knollenblätterpilz.
Kannst du bitte die genauen Unterschiede erklären? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Christian Siedl
Unbedingt!
Man sollte sich zwei Exemplare genau anschauen.
Beim Parasol ist der Stiel genattert - das heißt, er hat eine braune Musterung, ähnlich wie eine Schlangenhaut.
Deshalb nennt man das auch „Natterung".
Nicht nur auf den Ring achten - viele Pilze haben bewegliche Ringe, die sich verschieben lassen.
Beim Knollenblätterpilz ist der Stiel eher gebändert und hat eine ausgeprägte Knolle mit einer Scheide darüber - das sind wichtige Merkmale.
Deshalb ist es entscheidend, dass die Pilze vollständig mitgebracht werden.
Wenn ich nur die Hüte vor mir habe, kann ich keine sichere Bestimmung vornehmen - das wäre zu gefährlich und unverantwortlich.
Wenn jemand mit unvollständigen Pilzen kommt, bestimme ich sie nicht.
Ich sage immer: Wer sich mit Pilzen beschäftigt, sollte sich die Merkmale gut aneignen - am besten mit einem guten Pilzbuch oder durch sorgfältige Recherche im Internet.
Und keine Angst vor dem Anruf bei der Behörde - wir beißen nicht!
Lieber einmal unsicher sein und nachfragen, als einen Pilz essen und dann vielleicht ein Kind gefährden - wie wir es leider letztes Jahr erlebt haben.
Kinder spielen oft in der Wiese und sind neugierig - da kann es passieren, dass sie einen Pilz kosten.
Letztes Jahr hatten wir zwei Fälle - einen in Graz und einen im Burgenland.
Deshalb ist es wichtig, aufmerksam zu sein, über Pilze zu sprechen und sich bewusst zu machen, dass es auch giftige Arten gibt.
Simone Koren-Wallis
Und wenn ich jetzt eher der „Typ Faul" bin und sage: Ich gehe nicht selbst Schwammerl suchen - ich kann sie ja auch kaufen.
Gibt es Empfehlungen von dir?
Christian Siedl
Ja, auf jeden Fall!
In Graz empfehle ich die Bauernmärkte.
Dort findet man heimische Pilze in sehr guter Qualität.
Wenn man nicht selbst sammeln möchte, aber trotzdem ein gutes Schwammerlgericht kochen will - einfach auf den Grazer Bauernmarkt gehen.
Dort gibt es Steinpilze, Eierschwammerl, Krause Glucken - also saisonale Schwammerl, frisch und hochwertig.
Simone Koren-Wallis
Was ist, wenn ich Schwammerl gesammelt und zubereitet habe - und dann merke, dass der Pilz vielleicht doch nicht essbar war?
Was sind die Symptome und was soll ich bei einer Pilzvergiftung tun?
Christian Siedl
Wichtig ist: ruhig bleiben und den Körper beobachten.
Wenn Symptome wie Schwindel, Bauchschmerzen oder leichtes Fieber auftreten, sollte man sofort die Rettung und die Vergiftungszentrale anrufen.
Wichtig ist, gleich zu erklären:
- Was ist passiert?
- Wo wurde der Pilz gesammelt?
- Wann wurde er gegessen?
- Wie lange hat es gedauert, bis die Symptome aufgetreten sind?
Diese Informationen helfen, schnell und gezielt zu reagieren - und hoffentlich geht alles gut aus.
Folge 78: Zu Fuß durch Graz
Wie viel gehen wir eigentlich zu Fuß? Warum ist genau das manchmal kein „Spaziergang"? Und was passiert, damit das besser wird - für Eltern mit Kinderwagen, für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung oder für alle, die gern einfach nur spazieren? Die Antworten kommen von der Fußgänger:innenbeauftragten der Stadt Graz: Renate Platzer.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Wie viel gehen wir in Graz eigentlich durchschnittlich zu Fuß? Und warum ist genau das manchmal gar kein Spaziergang? Was passiert eigentlich, damit es besser wird?
Mein Name ist Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation, und ich bin heute unterwegs mit der Fußgänger:innenbeauftragten der Stadt Graz.
Renate Platzer:
Hallo, mein Name ist Renate Platzer. Ich bin die Fußgänger:innenbeauftragte der Stadt Graz. Die Stelle habe ich im Juli 2022 übernommen, bin aber schon seit über zehn Jahren bei der Stadt Graz - und zwar durchgehend in der Abteilung für Verkehrsplanung.
Simone Koren-Wallis:
Wie könnte es anders sein - wir gehen spazieren! Wir schlendern durch die Grazer Innenstadt und sind gerade in der Schmiedgasse unterwegs. Kann man eigentlich sagen, wie viel die Grazer:innen durchschnittlich zu Fuß gehen?
Renate Platzer:
Ja, man sagt, die durchschnittliche Weglänge liegt bei etwa eineinhalb bis zwei Kilometern - das ist eine Distanz, die man gut zu Fuß zurücklegen kann. Laut der letzten Modal-Split-Erhebung werden rund 22 Prozent der Wege in Graz zu Fuß zurückgelegt.
Man muss aber dazusagen: Das sind nur die Wege, bei denen das Zufußgehen als Hauptverkehrsmittel angegeben wurde. Die sogenannte „Dunkelziffer" - also die ganzen Zuwege, etwa zu Haltestellen oder Parkplätzen - ist da gar nicht enthalten. Es geht wirklich nur um Wege, die komplett zu Fuß zurückgelegt wurden.
Simone Koren-Wallis:
Vielleicht hat man's im Hintergrund gehört - da hat gerade ein Fahrrad gebremst. In der Schmiedgasse treffen ja viele Fußgänger:innen und Radfahrer:innen aufeinander. Ich glaube, da knirscht es manchmal ein bisschen, oder?
Renate Platzer:
Genau, das ist ein klassischer Konfliktpunkt. Die Gasse ist historisch gewachsen und dadurch relativ eng - das macht aber auch ihren Charme aus. Im Sommer kommen dann noch die Gastgärten und Verkaufsstände dazu, was den Raum zusätzlich verengt.
Da wird es dann schon kritisch, was die verträgliche Menge an schlendernden Fußgänger:innen und durchfahrenden Radfahrer:innen betrifft.
Aber: Mit der neuen Radverbindung in der Neutorgasse hat sich die Situation etwas entspannt - die Zahl der Radfahrer:innen in der Schmiedgasse ist deutlich zurückgegangen. Wer hier noch fährt, sollte das wirklich nur in Schrittgeschwindigkeit tun. Es geht nicht darum, das Radfahren komplett zu verbieten - das liegt auch auf einer anderen Entscheidungsebene - aber wer schnell unterwegs ist, sollte bitte die Neutorgasse nutzen.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt sind wir schon mitten im Thema Konfliktpotenzial. Gibt es eigentlich Rückmeldungen von Bürger:innen? Schreiben oder rufen Leute an - mit Beschwerden, Wünschen oder auch Lob?
Renate Platzer:
Ja, auf jeden Fall. In letzter Zeit haben wir - oder Kolleg:innen von mir - einige Straßenzüge neu oder umgeplant. Dabei wurde viel Grünraum geschaffen, was für die Entsiegelung der Stadt und den Wasserhaushalt sehr wichtig ist.
Aber auch fürs Zufußgehen ist Begrünung angenehm - es macht einfach glücklicher, durch eine blühende Stadt zu gehen. Gerade im Frühling, wenn alles blüht, bekommen wir viele positive Rückmeldungen.
Natürlich gibt es auch Verbesserungsvorschläge - und die sind sehr vielfältig. Die einen wünschen sich breite, entspannte Gehwege. Andere wollen möglichst viele Parkplätze, weil sie mit dem Auto in die Stadt fahren. Wieder andere fordern komfortable Radwege.
All diese Interessen in einem Projekt unterzubringen, ist extrem schwierig - eigentlich fast unmöglich.
Simone Koren-Wallis:
Wir sind gerade über eine Ampel gegangen - und da muss ich dich jetzt einfach fragen: Diese gelben Druckknöpfe an den Ampeln - bringen die wirklich was? Wird die Ampel schneller grün, wenn ich draufdrücke? Da gibt's ja viele Mythen.
Renate Platzer:
Ja, um diese Kästchen ranken sich viele Mythen. Grundsätzlich sind die Ampeln tagsüber meist nicht auf Bedarf geschaltet - sie laufen im normalen Signalzyklus, da muss man gar nicht drücken.
In den Randzeiten, also abends oder nachts, sollte man aber schon drücken - da sind viele Ampeln auf Bedarf geschaltet, und nur so bekommt man dann seine Grünphase.
Der untere Taster ist übrigens für sehbehinderte Personen - er sorgt dafür, dass das Kästchen vibriert. Bei älteren Modellen gibt es auch ein lautes Ticken.
Es gibt nur noch sehr wenige Ampeln, bei denen man sich wirklich aktiv anmelden muss - und das ist dann auch deutlich mit „Bitte drücken!" gekennzeichnet.
Simone Koren-Wallis:
Wir sind jetzt in der Kaiserfeldgasse - hier gibt's ja auch diese taktilen Leitstreifen für sehbehinderte Menschen. Wird das noch weiter ausgebaut? Wie steht's generell um das Thema Inklusion?
Renate Platzer:
Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Ich arbeite eng mit dem Referat für barrierefreies Bauen zusammen. Die Kolleg:innen dort wiederum kooperieren mit dem Sehbehinderten- und Gehörlosenverband, um Projekte möglichst inklusiv umzusetzen.
Natürlich gibt es auch Situationen, die sich nicht vollständig lösen lassen - etwa, wenn eine taktile Erfassung baulich nicht möglich ist. In solchen Fällen wird das an die Verbände kommuniziert, und die geben die Infos in ihren Netzwerken weiter, damit sich Betroffene entsprechend orientieren können.
Unser Ziel ist es, ein durchgängiges taktiles Leitsystem zu schaffen - nicht nur in der Innenstadt, sondern in der ganzen Stadt.
Simone Koren-Wallis:
Gehören eigentlich auch Rollstuhlfahrer:innen zu deinem Aufgabenbereich?
Renate Platzer:
Ja, auf jeden Fall. Rollstuhlfahrer:innen zählen definitiv zum Fußverkehr - sie sind keine Radfahrer:innen, weil sie viel langsamer unterwegs sind und sich auf Gehsteigen fortbewegen dürfen.
Deshalb ist es besonders wichtig, dass sie barrierefrei auf den Gehsteig gelangen können - dafür braucht es sogenannte Nullabsenker.
Ein großes Thema ist auch die Breite der Gehsteige. Gerade bei Müllabfuhrtagen in den Randbezirken stehen oft Mülltonnen auf dem Gehsteig, und dann kommen Rollstuhlfahrer:innen nicht mehr vorbei.
Sie können nicht einfach ständig runter und wieder rauf fahren - vor allem, wenn es keine Absenkungen gibt. Das sind Herausforderungen, an die man oft nicht denkt. Das Thema Mülltonnen ist da wirklich ein eigenes Kapitel.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt sind wir gerade in der Neutorgasse - warum ist die eigentlich ein gutes Beispiel?
Renate Platzer:
Ich glaube, viele Menschen sind früher kaum durch die Neutorgasse gegangen - zumindest nicht bewusst. In meiner Erinnerung war sie eine triste, graue Straße mit viel Verkehr. Man ist mit dem Auto schnell durchgefahren, aber stehen geblieben ist man selten.
Durch die Umgestaltung - mit weniger Fahrstreifen, einem eigenen Radweg und einem großzügigen Bereich für Fußgänger:innen - hat sich das komplett verändert.
Jetzt lädt die Gasse zum Verweilen ein. Es gibt eine durchgehende Baumachse, die mit neuen Bäumen ergänzt wurde - das schafft echte Aufenthaltsqualität.
Was jetzt noch fehlt, ist, dass sich mehr Geschäfte und vielleicht Gastronomie ansiedeln. Dann wird die Gasse richtig lebendig.
Simone Koren-Wallis:
Erklär doch bitte kurz den „Masterplan Gehen".
Renate Platzer:
Der „Masterplan Gehen" wurde im Jänner 2024 beschlossen. Wir haben etwa ein Jahr daran gearbeitet.
Er ist unsere Strategie, wie wir den Fußverkehr in Graz stärken und fördern wollen.
Darin sind Maßnahmen enthalten, die bei jedem Infrastrukturprojekt berücksichtigt werden sollen - zum Beispiel Begrünung, Sitzmöglichkeiten, ausreichend breite Gehsteige und gute Beleuchtung.
Außerdem haben wir ein sogenanntes „Soll-Fußwegenetz" erstellt - also ein Netz von Wegen, das idealerweise ausgebaut werden soll.
Natürlich wollen wir überall gute Fußwege, aber wir müssen priorisieren.
Das heißt: Wir starten dort, wo die Hauptströme verlaufen, und setzen das Schritt für Schritt um.
Wenn neue Projekte entstehen, schauen wir: Liegt das auf dem Hauptwegenetz? Dann braucht es dort besonders breite Gehsteige und gute Bedingungen für Fußgänger:innen.
Im Masterplan sind auch Leitprojekte definiert - einige davon sind bereits in Umsetzung.
Und: Der Masterplan ist auch Voraussetzung dafür, dass wir Förderungen vom Bund für den Fußverkehr erhalten.
Simone Koren-Wallis:
Ich habe gerade einen E-Scooter gesehen - sind die eigentlich ein Problem?
Renate Platzer:
Ja, schon. Am Anfang war nicht klar, wo sie fahren dürfen.
Tretroller, bei denen man selbst mit dem Fuß anschiebt, dürfen auf dem Gehsteig fahren.
E-Scooter hingegen müssen auf dem Radweg fahren.
Das Problem ist, dass viele das nicht wissen - und weil sie so leise sind, nehmen Fußgänger:innen sie oft gar nicht wahr, bis sie plötzlich vorbeizischen.
Aber es gibt bereits Konzepte und Ideen auf Bundesebene, wie man mit diesen Fahrzeugen besser umgehen kann.
Simone Koren-Wallis:
Wäre es nicht einfach besser, wenn alle mehr Rücksicht aufeinander nehmen würden?
Renate Platzer:
Ja, das wäre das Beste - und eigentlich auch das Einfachste.
Wenn jede:r, egal mit welchem Verkehrsmittel, achtsam unterwegs ist und schaut, ob jemand ein Bedürfnis hat oder gerade über die Straße möchte, dann wäre schon viel gewonnen.
Man kann Fehler machen - aber wenn man aufmerksam und vorausschauend geht oder fährt, nimmt man viel Stress aus dem Alltag.
Leider ist unsere Gesellschaft oft gestresst: Man bringt die Kinder in den Kindergarten, muss schnell zur Arbeit, vielleicht noch ein Frühstück besorgen - und in dieser Hektik wird man unaufmerksam.
Das ist ein Teil des Problems.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Kinder haben - solange sie nicht selbsterhaltungsfähig sind - Anspruch auf Unterhalt.
Aber wie wird dieser Betrag eigentlich berechnet? Was sind Alimente? Und was passiert, wenn ein Elternteil nicht zahlt?
Das schauen wir uns in der nächsten Folge an.
Wir hören uns - ich freu mich!
Folge 77: Warum Plastik im Biomüll nichts verloren hat
Was darf eigentlich in den Biomüll - und was besser nicht? In dieser Folge spricht Alice Loidl von der Abfallwirtschaft der Holding Graz über weitverbreitete Irrtümer, warum kompostierbare Plastiksackerl keine gute Idee sind und wie aus Bioabfall wertvolle Gartenerde entsteht. Ein Podcast über richtige Mülltrennung, nachhaltige Kreisläufe und kleine Entscheidungen mit großer Wirkung.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Warum hat Plastik im Biomüll nichts verloren? Und damit meinen wir auch die sogenannten kompostierbaren Plastiksackerl.
Und wie wird aus unserem Bioabfall eigentlich hochwertige Gartenerde?
Das schauen wir uns heute genauer an.
Mein Name ist Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation, und ich bin heute zu Gast bei Alice Loidl im Ressourcenpark.
Alice Loidl:
Ja, mein Name ist Alice Loidl. Ich bin Spartenbereichsleiterin für die Abfallwirtschaft bei der Holding Graz.
Simone Koren-Wallis:
Ich bin heute in der Sturzgasse. Ich glaube, jede Grazerin und jeder Grazer kennt den Ressourcenpark, der vor drei Jahren eröffnet wurde.
Ich bin aber gegenüber - und man hört es schon im Hintergrund: Hier wird ordentlich gearbeitet.
Alice, erzähl uns bitte, wo genau sind wir gerade?
Alice Loidl:
Wir stehen direkt bei der Einfahrt zu unserer Bioabfallaufbereitungsanlage.
Hier kommen die Sammelfahrzeuge an, die den ganzen Tag in Graz unterwegs sind und Bioabfall einsammeln.
Der Bioabfall wird hier abgeladen, von groben Störstoffen befreit und mit gehäckseltem Grünschnitt vermischt.
Danach wird er in Container gefüllt und zu Kompostieranlagen in der Steiermark gebracht - zur landwirtschaftlichen Kompostierung.
Dort entsteht aus dem Bioabfall wertvoller Kompost.
Simone Koren-Wallis:
Du hast gerade das Wort „Störstoffe" erwähnt. Was genau ist damit gemeint? Ich glaube, wir kennen das alle irgendwie - aber was zählt da konkret dazu?
Alice Loidl:
Besonders problematisch sind Plastiksackerl.
Sie sind eine große Herausforderung, weil sie bei der Kompostierung oft händisch aussortiert werden müssen.
Sie beeinflussen den Kompostierprozess und zersetzen sich nicht vollständig.
Konventionelle Plastiksackerl sowieso nicht - aber auch die angeblich kompostierbaren Varianten zersetzen sich viel langsamer als angegeben.
Im schlimmsten Fall hat man dann Plastikfetzen im Kompost oder in der Gartenerde - und das wollen wir natürlich vermeiden.
Zusätzlich besteht die Gefahr von Mikroplastik, wenn man das nicht aussortiert.
Das ist wirklich ein Störstoff, der uns große Sorgen bereitet.
Simone Koren-Wallis:
So wie du sagst - sie sehen ja eigentlich harmlos aus. Ich gestehe, ich habe sie selbst mal verwendet, weil „kompostierbar" draufsteht.
Da habe ich meinen Bioabfall reingegeben und mir gedacht: Praktisch, da muss ich nicht so oft auswischen. Aber der Schein trügt.
Alice Loidl:
Ja, der Schein trügt.
Viele dieser kompostierbaren Materialien sind für industrielle Kompostierung gedacht - dort gibt es höhere Temperaturen und längere Verweilzeiten als bei der landwirtschaftlichen Kompostierung.
Deshalb sind sie bei uns problematisch.
Und es gibt so viele verschiedene Arten von kompostierbaren Plastiksackerln, dass es extrem schwer ist zu erkennen, welche tatsächlich unter unseren Bedingungen kompostierbar sind.
Simone Koren-Wallis:
Können wir mal reinschauen?
Wir haben uns einen super Tag ausgesucht - ich glaube, es hat 33 Grad.
Wo passiert das mit dem Aussortieren? Weiter hinten?
Alice Loidl:
Nein, das Aussortieren passiert momentan erst auf der Kompostieranlage.
Aber wir haben bereits ein Projekt in Planung - es ist sogar schon bei der Behörde eingereicht.
Es geht um eine moderne Bioabfallaufbereitungsanlage mit maschinellen Komponenten wie Zerkleinerung, Windsichtung, Siebung und mehr.
Damit können wir Störstoffe maschinell aussortieren - nicht zu 100 %, aber deutlich besser als bisher.
Simone Koren-Wallis:
Wir stehen jetzt vor dieser großen Halle - und ich glaube, man kann froh sein, dass es noch kein „Geruchshören" gibt.
Man riecht es natürlich schon. Was passiert jetzt mit dem Bioabfall?
Alice Loidl:
Der Bioabfall wird grob von größeren Störstoffen befreit - auch maschinell.
Aber die Technik stößt da an ihre Grenzen, weil der nasse Bioabfall leicht Maschinen verstopft.
Dann wird er mit Grünschnitt vermischt, in Transportcontainer gefüllt und abtransportiert.
Simone Koren-Wallis:
Wohin geht das dann?
Alice Loidl:
Zu rund 19 verschiedenen Kompostieranlagen in der Steiermark.
Eine davon ist die AD Bioerde - eine 100-prozentige Tochter der Holding Graz.
Dort wird aus dem Bioabfall Kompost hergestellt, den man bei uns als Qualitätskompost oder Gartenerde kaufen kann.
Simone Koren-Wallis:
Und das war vielleicht früher mal mein Apfelputzen, den ich weggeschmissen habe?
Alice Loidl:
Genau - und jetzt wird daraus die Erde für einen neuen Apfelbaum.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt sind wir drinnen im Ressourcenpark - es ist kühler und ruhiger. Was gibt's hier?
Alice Loidl:
Wir sind jetzt beim Info-Point bzw. in der Re-Use-Zone.
Hier kann man Vorsammelhilfen aus Papier für den Bioabfall erwerben - also schöne Papiersackerl, die man statt Plastiksackerl verwenden kann.
Papier ist tatsächlich kompostierbar.
Man kann den Bioabfall zu Hause sammeln und das Sackerl dann zur Biotonne bringen.
Am liebsten ist uns natürlich, wenn gar keine Vorsammelhilfe verwendet wird - aber das ist oft nicht praktikabel.
Wenn doch, dann bitte aus Papier.
Außerdem gibt es hier große Grünschnittsäcke mit einem Fassungsvermögen von etwa 110-120 Litern.
Die kann man bei uns oder an anderen Stellen kaufen, zu Hause mit Grünschnitt befüllen und neben die Biotonne stellen - sie werden bei der Sammlung mitgenommen.
Simone Koren-Wallis:
Und was kosten die Sackerl - die kleinen und die großen?
Alice Loidl:
Die Biomüllsackerl gibt's im 50er-Pack für 5,90 Euro.
Der große Grünschnittsack kostet 4,50 Euro.
Inklusive Sammlung, Verwertung und Abholung - alles dabei.
Simone Koren-Wallis:
Du hast vorher das Wort „Störstoffe" erwähnt - kannst du ungefähr sagen, wie viel Prozent davon im Bioabfall enthalten sind?
Alice Loidl:
Im Durchschnitt sind es etwa fünf Prozent.
Je nach Sammelgebiet kann das aber variieren - in manchen Gebieten ist es weniger, in anderen mehr.
Simone Koren-Wallis:
Hast du schon mal etwas erlebt, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Du schmunzelst schon...
Alice Loidl:
Ja, tatsächlich! Was schon ein paar Mal passiert ist: Ein ganzer Bioabfallbehälter ist im Sammelfahrzeug gelandet. Der dürfte beim Entleeren hineingestürzt sein - und wird dann einfach mit ausgeleert.
Oder auch Tierkadaver - das kommt leider öfter vor.
Simone Koren-Wallis:
Also Tierkadaver gehören bitte nicht in den Bioabfall?
Alice Loidl:
Nein, auf keinen Fall. Dafür gibt es eine eigene Tierkörperverwertung beim Schlachthof - dort kann man das abgeben. Im Bioabfall haben sie nichts verloren.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt stehen wir hier - da ist schon groß das Schild „Erdenverkauf".
Das heißt, wir sind am Ende des Kreislaufs angekommen, dort, wo man die Erde auch kaufen kann.
Ist das Angebot nur für Grazer:innen?
Alice Loidl:
Grundsätzlich kann jede:r kommen und bei uns Erde kaufen.
Hier schließt sich der Kompostkreislauf auf besonders schöne Weise:
Aus Bioabfall - also etwas, das niemand mehr haben will - entsteht ein wertvolles Produkt, nämlich Gartenerde oder Qualitätskompost.
Das kann dann jede Kundin und jeder Kunde bei uns abholen - entweder lose, zum Beispiel direkt auf einen Anhänger verladen, oder auch in kleineren Mengen.
Wir haben sogar wiederverwendbare Kübel für Garten- und Komposterde, die man frisch befüllen kann.
Wenn jemand nur ein kleines Hochbeet hat, kann er oder sie einfach zwei Kübel mitnehmen und zu Hause verwenden.
Simone Koren-Wallis:
Und wenn man kein Auto hat, aber trotzdem Erde braucht - gibt's da einen besonderen Service?
Alice Loidl:
Ja, genau! Wir bieten einen Erden-Zustellservice an.
Die Erde wird mit dem Lkw direkt zum gewünschten Ort geliefert.
Man muss nur schauen, ob die Zufahrt möglich ist - dann bringen wir die Erde direkt vorbei.
Simone Koren-Wallis:
Und dann kann gepflanzt und geerntet werden?
Alice Loidl:
Genau - dann wird gepflanzt, geerntet, und das Gemüse landet irgendwann wieder im Bioabfall.
So kann man den Kreislauf quasi unendlich fortsetzen.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
21 Prozent unserer Wege legen wir zu Fuß zurück.
Aber was bedeutet das konkret für die Stadt Graz?
Wo hakt's? Wo funktioniert's besonders gut?
Das hört ihr in der nächsten Folge.
Wir hören uns - ich freu mich!
Folge 76: Wie die Stadt Graz gegen die Tigermücke kämpft
Die Tigermücke breitet sich in Graz aus - und das kann gesundheitliche Folgen haben. In dieser Folge erzählt Erwin Wieser vom Gesundheitsamt, wie die Stadt gegen die invasive Mückenart vorgeht, welche Maßnahmen bereits laufen und warum eure Mithilfe entscheidend ist. Wir sprechen über Brutstätten, Bekämpfungsstrategien und wie ihr selbst aktiv werden könnt.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Die Stadt Graz kämpft gegen die Tigermücke.
Wie genau? Das erklären wir euch heute ganz ausführlich.
Und eines ist klar: Ganz ohne eure Mithilfe geht es nicht.
Mein Name ist Simone Koren-Wallis und ich bin heute im Westen von Graz unterwegs - gemeinsam mit Erwin Wieser.
Erwin Wieser:
Hallo, mein Name ist Erwin Wieser. Ich arbeite im Gesundheitsamt und bin seit 33 Jahren beim Magistrat.
Im Gesundheitsamt leite ich das Referat für Infektionsschutz - und dazu gehört auch die Tigermücke.
Derzeit bin ich fast ständig im Einsatz im Kampf gegen dieses Tier.
Simone Koren-Wallis:
Wir sind heute im Garten von Katja.
Katja, kannst du uns erzählen, wie es euch mit der Tigermücke geht?
Katja:
Ja, also letztes Jahr war wirklich hart.
Wir haben gerade erst das Haus gekauft und waren im Sommer nur gelegentlich mit den Kindern da.
Unser Kleiner war damals sechs Monate alt - und er war komplett zerstochen, von oben bis unten.
Es waren sicher 30 bis 40 Tigermückenstiche.
Das hat uns echt die Freude genommen.
Gerade bei kleinen Kindern hat man ja auch Angst, weil die Mücken Krankheiten übertragen können.
Letzten Sommer war wirklich schwierig.
Simone Koren-Wallis:
Und deshalb habt ihr euch entschieden, die Stadt Graz bzw. das Gesundheitsamt zu kontaktieren, um gemeinsam etwas dagegen zu unternehmen?
Katja:
Genau.
Letztes Jahr war schon jemand vom Gesundheitsamt bei uns und hat eine Gartenbegehung gemacht - das hat uns sehr geholfen.
Wir hätten zum Beispiel nie an Astlöcher in den Bäumen gedacht.
Wir haben nur auf Regentonnen und Gießkannen geachtet.
Und als wir heuer in der Zeitung von dem neuen Projekt gelesen haben, haben wir uns gleich gemeldet.
Wir finden es super, dass etwas gemacht wird - denn es war wirklich unerträglich.
Wir wollten niemanden mehr einladen und selbst kaum noch in den Garten gehen.
Simone Koren-Wallis:
Dann hoffen wir, dass es diesmal besser wird!
Katja:
Ja, auf jeden Fall.
Simone Koren-Wallis:
Für alle, die vielleicht noch nie von der Tigermücke gehört haben - was ich mir kaum vorstellen kann:
Lieber Erwin, was macht die Tigermücke so besonders?
Erwin Wieser:
Die Tigermücke ist besonders, weil sie eigentlich nicht zu uns gehört.
Sie stammt aus Südostasien und ist über den Gütertransport nach Europa und später nach Österreich gekommen.
Sie ist auffällig schön - schwarz-weiß gestreift, wie ein kleiner Tiger.
Anders als unsere heimischen Gelsen ist sie tagaktiv und lautlos - und dadurch besonders lästig.
Wie andere Mücken braucht sie Blut zur Fortpflanzung und zur Eiablage - und sticht daher öfter, als uns lieb ist.
Simone Koren-Wallis:
Kinder nennen dich den „Tigermücken-Detektiv", weil du wirklich in den Gärten unterwegs bist.
Erwin Wieser:
Genau - immer wenn wir von Gartenbesitzer:innen gerufen werden, sind wir vor Ort.
Oder wenn uns die Mosquito-Alert-App viele Meldungen aus einer bestimmten Gegend liefert, schauen wir dort nach.
Dann werden wir aktiv und helfen, die Brutstätten zu finden.
Das ist ganz wichtig, denn viele erkennen diese gar nicht als solche und glauben, sie hätten nichts damit zu tun.
Aber wir finden fast in jedem Garten Wasser und damit eine Brutstätte.
Simone Koren-Wallis:
Du hast die App erwähnt - wie findet man die?
Erwin Wieser:
Die App heißt Mosquito Alert und ist ganz einfach herunterzuladen.
Auf der Webseite der Stadt Graz ist sie auch verlinkt - das macht es noch einfacher.
Simone Koren-Wallis:
Der Download ist wirklich unkompliziert - ich habe es selbst gemacht.
Vor ein paar Tagen habe ich eine Tigermücke erschlagen, ein Foto gemacht und in der App hochgeladen.
Kommt das dann direkt bei euch im Gesundheitsamt an?
Erwin Wieser:
Genau.
Zuerst wird das Bild von der AGES in Wien verifiziert - sie prüfen, ob es wirklich eine Tigermücke ist oder ein anderes Tier.
Dann bekommen wir Zugriff auf die Daten und spielen sie ins städtische Geo-Informationssystem ein.
Und dann geht's los:
Die Holding Graz wird beauftragt, im öffentlichen Raum zu bekämpfen - etwa in Gullis und Regeneinläufen.
Und wir schauen uns die Gärten dahinter an, suchen Brutstätten und helfen den Bürger:innen direkt vor Ort.
Simone Koren-Wallis:
Ich weiß zum Beispiel, dass Blumentöpfe typische Brutstätten sind, weil sich darin oft Wasser sammelt.
Aber wir stehen jetzt vor einer Birke - und die hat typische Löcher. Ist das auch eine Brutstätte?
Erwin Wieser:
Ja, genau - das ist eine Baumhöhle.
Die Tigermücke ist ein sogenannter Baumhöhlenbrüter.
Wenn sich in so einer Höhle Wasser sammelt, ist das eine ihrer bevorzugten Brutstätten.
In diesem Fall hat der Gartenbesitzer aber schon vorgesorgt und ein Loch in den Baum gebohrt, damit sich kein Wasser ansammelt.
Ich würde das allerdings nicht unbedingt empfehlen - besser wäre es, die Höhle mit Sand zu füllen. Das funktioniert genauso gut und ist baumschonender.
Simone Koren-Wallis:
Bei Blumentöpfen ist es ja so, dass man das Wasser regelmäßig ausleeren sollte, oder?
Erwin Wieser:
Genau. Täglich wäre natürlich ideal - aber einmal pro Woche reicht im Prinzip auch schon aus.
Wichtig ist einfach, dass sich kein stehendes Wasser über längere Zeit hält.
Denn das ist genau das, was die Tigermücke braucht, um ihre Eier abzulegen.
Simone Koren-Wallis:
Und was ist mit Regentonnen? Die kann ich ja nicht einfach jede Woche ausleeren.
Erwin Wieser:
Stimmt - das wäre bei 300 Litern oder mehr auch kaum machbar.
Deshalb sollte man Regentonnen unbedingt mit einem feinmaschigen Netz abdecken.
Die handelsüblichen Deckel, die oft mitverkauft werden, sind nicht immer dicht genug.
Ein Netz hat gleich mehrere Vorteile: Es hält Schmutz und Blätter draußen, das Wasser bleibt sauber - und die Tigermücke kann weder hinein noch hinaus.
Also eine echte Win-Win-Situation.
Und ja - du hast recht, da fliegt gerade eine. Sie sucht sich dein dunkles T-Shirt aus - die Tigermücke steht nämlich auf dunkle Farben. Du bist heute ganz in Schwarz, das wird sie mögen.
Simone Koren-Wallis:
Es gibt aber auch Tabletten, die man ins Regenwasser geben kann, oder?
Erwin Wieser:
Ja, das sind sogenannte Culinex- oder BTI-Tabletten.
Sie enthalten einen biologischen Wirkstoff - ein Eiweiß, das aus dem Boden stammt.
Das wirkt gezielt gegen die Larven der Tigermücke, nicht gegen die erwachsenen Tiere.
Also: Nicht in die Luft sprühen - das bringt nichts.
Aber in Wasserstellen, die man nicht ausleeren kann, wirken diese Tabletten sehr gut.
Und das Wasser kann danach ganz normal zum Gießen verwendet werden.
Simone Koren-Wallis:
Und wo bekommt man diese Tabletten?
Erwin Wieser:
Am besten online - in Österreich sind sie im Handel leider noch schwer erhältlich.
Die meisten Baumärkte führen sie nicht.
Einfach nach „BTI", „Culinex-Tabletten" oder „Stechmücken-Larvizid" suchen - dann findet man passende Anbieter.
Simone Koren-Wallis:
Die Stadt Graz möchte aber auf keinen Fall, dass Insektizide eingesetzt werden, oder?
Erwin Wieser:
Ganz genau.
Wir wollen keine chemischen Mittel, keine Sprühaktionen mit Drohnen oder Hubschraubern - wie man das aus anderen Städten kennt, etwa Dresden oder Paris.
Unser Ansatz ist ein biologischer - kombiniert mit Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit.
Wir arbeiten auch mit Schulen und Kindern zusammen.
Und: Wir wollen keine Strafen verhängen - wie zum Beispiel in Meran, wo es Bußgelder gibt, wenn man Wasserstellen im Garten hat.
Unser Ziel ist, dass das Wissen in die Köpfe kommt - und ins tägliche Handeln.
Nur so können wir die Plage langfristig eindämmen.
Simone Koren-Wallis:
Wir sind heute auch deshalb in einem Vorgarten, weil Graz eine Vorreiterrolle spielt - besonders bei der Bekämpfung der Tigermücke.
Kannst du das kurz erklären?
Erwin Wieser:
Du meinst sicher das SIT-Projekt - das steht für Sterile Insektentechnik.
Wir führen dieses Pilotprojekt gemeinsam mit der IAEO (Internationale Atomenergieorganisation) aus Seibersdorf durch.
In zwei Gebieten in Graz - im Osten und im Westen - machen wir ein engmaschiges Monitoring über die gesamte Saison, also bis November.
Dabei fangen wir lebende Tiere, analysieren abgelegte Eier und setzen gezielt sterile Männchen aus.
Diese werden in Seibersdorf gezüchtet, bestrahlt und eingefärbt - jede Woche in einer anderen Farbe.
So können wir nachvollziehen, wie weit sie fliegen, wie viele zurückkommen und wie effektiv die Maßnahme ist.
Die Männchen paaren sich mit den Weibchen - aber es entsteht kein Nachwuchs.
Wenn alles gut läuft, können wir die nächste Generation um bis zu 70 % reduzieren. Das wäre ein großer Erfolg.
Simone Koren-Wallis:
Und das ist besonders wichtig, weil die Tigermücke nicht nur lästig ist, sondern auch Krankheiten übertragen kann.
Aber noch eine letzte Frage: Wenn ich doch gestochen werde - was hilft am besten gegen den Juckreiz?
Erwin Wieser:
Das Wichtigste: Nicht kratzen!
Auch wenn's schwerfällt - lieber kühlen.
Und es gibt sogenannte Stichheiler, die mit Hitze arbeiten.
Die erhitzen die Einstichstelle auf über 65 Grad - das hilft sehr gut gegen den Juckreiz.
Also: Erst kühlen, dann Hitze - und möglichst nicht kratzen.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge klären wir, warum Plastik im Biomüll so gar nichts verloren hat.
Vielleicht denkt sich der eine oder die andere: „Weiß ich eh!" - aber da gehören tatsächlich auch die kompostierbaren Sackerl dazu.
Wir hören uns - ich freu mich!
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Ich glaube, es geht uns allen gleich:
Die Ereignisse Mitte Juni in Graz haben uns tief erschüttert.
Gerade in solchen Zeiten ist es umso wichtiger, den Blick auf das Miteinander zu richten.
In dieser Folge sprechen wir deshalb über Integration, Zugehörigkeit und darüber, was eine Stadt wie Graz zusammenhält.
Kavita Sandhu:
Hallo, mein Name ist Kavita Sandhu und ich leite das Integrationsreferat der Stadt Graz.
Sarah Schalk:
Hallo, ich bin Sarah Schalk und eine von drei Standortleiterinnen von Sindbad Graz.
Simone Koren-Wallis:
Ja, was soll ich sagen - Happy Birthday, Integrationsreferat, oder Kavita?
Kavita Sandhu:
Ja, danke schön!
Wir freuen uns sehr, dass wir heuer 20 Jahre alt werden und seit zwei Jahrzehnten die Integrationsarbeit in Graz mitgestalten dürfen.
Simone Koren-Wallis:
Wie sieht diese Arbeit konkret aus? Kannst du das für alle einmal erklären?
Kavita Sandhu:
Graz ist eine sehr vielfältige Stadt.
Wir haben über 80.000 Menschen hier, die eine andere Staatsbürgerschaft als die österreichische besitzen.
Menschen aus über 160 Nationen leben in Graz - das zeigt, wie bunt und vielfältig unsere Stadt ist.
Uns ist es wichtig, gute Rahmenbedingungen für ein friedliches Zusammenleben zu schaffen.
Menschen, die neu hier sind, sollen sich gut zurechtfinden, ausreichend Informationen bekommen und gut ankommen können.
Das sehen wir als unsere zentrale Aufgabe.
Simone Koren-Wallis:
Kannst du das auch aus Sicht der Stadtentwicklung erklären? Hat sich verändert, woher die Menschen kommen?
Kavita Sandhu:
Ja, das kann man über die letzten 20 Jahre gut beobachten.
Graz ist zwar im europäischen Vergleich eine eher kleine Stadt, aber natürlich trotzdem beeinflusst von globalen Ereignissen.
Ein Beispiel: Vor dem Angriffskrieg in der Ukraine 2022 spielten ukrainische Staatsbürger:innen zahlenmäßig in Graz kaum eine Rolle.
Heute gehören sie zu den zehn größten Gruppen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in der Stadt.
Auch Menschen aus Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien und der Türkei sind stark vertreten.
Und natürlich hat auch der Krieg in Syrien dazu geführt, dass viele Menschen aus Syrien und Afghanistan nach Graz gekommen sind.
Man sieht: Graz ist von weltweiten Entwicklungen beeinflusst - und muss darauf reagieren.
Dabei entstehen oft Integrationsfragen, und da kommen wir als Integrationsreferat ins Spiel.
Simone Koren-Wallis:
Eine große Gruppe sind auch die Deutschen.
Kavita Sandhu:
Ja, genau - die vergisst man oft.
Aber tatsächlich leben viele deutsche Staatsbürger:innen in Graz.
Die geografische Nähe spielt sicher eine Rolle, und natürlich auch die Sprache.
Den Dialekt muss man zwar lernen, aber das geht für Deutsche meist recht schnell.
Simone Koren-Wallis:
Wir müssen es ehrlich sagen: Es gibt auch Ausländerfeindlichkeit.
Wie kann man dem begegnen?
Kavita Sandhu:
Ich glaube, ein Schlüssel liegt in der Begegnung.
Oft entstehen Vorurteile gegenüber dem, was man nicht kennt.
Wenn man aber mit anderen Menschen, Kulturen oder Religionen in Kontakt kommt, können Barrieren abgebaut werden.
Das „Fremde" bekommt ein Gesicht - und viele Vorstellungen, die man mit sich herumträgt, lösen sich auf.
Deshalb ist es uns wichtig, Räume der Begegnung zu schaffen.
Ein Beispiel ist unser „Fest für alle", das wir seit drei Jahren in der Seifenfabrik veranstalten.
Da kommt ganz Graz zusammen - alle sind eingeladen.
Es gibt Informationsangebote zu Integration, Gesundheit, Sport und Ehrenamt.
Und man kann mit ganz unterschiedlichen Menschen ins Gespräch kommen.
Solche Formate - ob groß oder klein - sind für uns zentrale Elemente, um gegenseitiges Verständnis zu fördern.
Simone Koren-Wallis:
Hast du auch Lieblingsprojekte, bei denen du sagst: Das ist besonders wertvoll?
Kavita Sandhu:
Ja, auf jeden Fall.
Wir sind in der Abteilung für Bildung und Integration - und haben daher einen starken Bildungsschwerpunkt.
Besonders schön finde ich unsere kostenlosen Deutschkursprojekte für Kinder und Jugendliche in den Ferien.
Ein Projekt kombiniert Deutschlernen mit Sport - die Kinder können sich in verschiedenen Sportarten ausprobieren und vielleicht sogar bei Vereinen andocken.
Das gefällt mir besonders gut.
Aber auch andere Projekte sind sehr wertvoll - zum Beispiel jene, die Jugendliche beim Übergang von der Schule in eine Ausbildung oder Lehre unterstützen.
Ein Projekt, das wir seit Beginn in Graz begleiten, ist das Mentoringprogramm von Sindbad Graz.
Simone Koren-Wallis:
Dann stellen wir gleich einmal Sindbad vor.
Sarah, erklär uns bitte: Was ist Sindbad genau?
Sarah Schalk:
Sindbad ist ein 1-zu-1-Mentoring-Programm, bei dem - wie Kavita schon gesagt hat - junge Menschen am Übergang von der Pflichtschule in eine weiterführende Ausbildung begleitet werden.
Dabei geht es vor allem um Jugendliche, bei denen eine externe Bezugsperson besonders viel bewirken kann.
Unsere Mentor:innen engagieren sich ehrenamtlich - das heißt, das Angebot ist für die Jugendlichen kostenlos und freiwillig.
Diese Bezugspersonen treten außerhalb von Familie und Schule in das Leben der Jugendlichen und unterstützen sie in dieser wichtigen Phase - sei es beim Einhalten von Fristen für Schulanmeldungen, beim Erstellen eines Bewerbungsfotos oder einfach durch Beziehungsarbeit: mal fragen, wie es geht, gemeinsam spazieren gehen, Sport machen oder Freizeit verbringen.
Simone Koren-Wallis:
Also quasi wie eine große Schwester, ein großer Bruder - jemand, der einfach bei allem unterstützt?
Sarah Schalk:
Ganz genau.
Wenn wir an unsere eigene Jugend zurückdenken, fällt uns oft jemand ein, der so eine Rolle eingenommen hat.
Und genau diese Rolle übernehmen unsere Mentor:innen bei Sindbad.
Simone Koren-Wallis:
Kann jede:r Mentor:in werden?
Sarah Schalk:
Grundsätzlich ja.
Wir haben eine Altersgrenze von 20 bis maximal 40 Jahren.
Junge Studierende, Berufstätige oder einfach engagierte Erwachsene, die einen jungen Menschen begleiten möchten, können bei uns mitmachen.
Simone Koren-Wallis:
Ich finde, bei solchen Projekten merkt man erst, was die Stadt alles macht und fördert.
„Graz sind wir alle" - das ist euer Motto, oder?
Kavita Sandhu:
Genau - das ist unser Leitspruch und gleichzeitig der Titel unseres städtischen Integrationsleitbilds, das 2023 vom Gemeinderat beschlossen wurde.
„Graz sind wir alle" steht für unsere Haltung in der Integrationsarbeit:
Jeder Mensch, der hier lebt, soll sich zur Stadtgemeinschaft zugehörig fühlen.
Wir wollen gegenseitiges Verständnis fördern und ein gutes Zusammenleben ermöglichen.
Dazu braucht es Angebote wie Sindbad - für Jugendliche, die gerade mit Herausforderungen kämpfen oder Orientierung suchen.
Es ist schön zu sehen, wie viel ein Mensch bewirken kann, wenn er sich Zeit nimmt - nicht nur für einen Monat, sondern für ein ganzes Jahr.
Und das Tolle ist: Es profitieren nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Mentor:innen - viele empfinden das als große Bereicherung und lernen selbst viel dabei.
Simone Koren-Wallis:
Ist das Mentoring wirklich auf ein Jahr begrenzt - oder entstehen da auch Freundschaften fürs Leben?
Sarah Schalk:
Oft entstehen tatsächlich Freundschaften fürs Leben.
Das Programm läuft grundsätzlich so ab, dass man im November oder April einsteigt - also im Laufe eines Schuljahres - und es endet dann im darauffolgenden November.
Bis dahin haben die Jugendlichen idealerweise den Übergang geschafft und sammeln erste Erfahrungen in der neuen Schule oder Lehrstelle.
Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dranzubleiben - denn Veränderungen sind oft herausfordernd.
Und da ist es gut, wenn Sindbad unterstützend zur Seite steht.
Viele bleiben auch nach dem offiziellen Programm in Kontakt - manchmal über Jahre hinweg.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Jugendliche nehmen teil?
Sarah Schalk:
Pro Jahr begleiten wir rund 100 Jugendliche.
Seit der Gründung von Sindbad Graz haben bereits etwa 900 junge Menschen das Programm durchlaufen - gemeinsam mit ihren Mentor:innen.
Das sind 900 Menschen, die diese verbindende Erfahrung gemacht haben - und das wirkt natürlich auch in die Gesellschaft hinein.
Simone Koren-Wallis:
Müssen wir noch viel tun, um das Thema Integration weiter in die Köpfe der Menschen zu bringen?
Kavita Sandhu:
Ja, ich denke, da liegt die Verantwortung auf beiden Seiten.
Menschen, die neu nach Graz kommen, müssen sich orientieren, die Sprache lernen und sich in unsere Systeme einfinden - sei es Arbeitsmarkt, Bildung oder Gesundheit.
Aber genauso wichtig ist es, dass wir als städtische Gesellschaft offen sind, informieren und den Austausch suchen.
Vielfalt kann eine große Bereicherung sein - aber dafür braucht es Engagement von beiden Seiten.
Es gibt viele Angebote, aber vieles ist einfach nicht bekannt.
Deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe, über diese Angebote zu informieren:
Beratungsstellen, Elternkurse, Förderprogramme für Kinder und Jugendliche - etwa zum Thema „Lernen lernen", Sprachförderung oder Systemwissen.
In Elternkursen geht es nicht nur um Deutsch, sondern auch darum, wie Schule funktioniert:
Wie spreche ich mit Lehrkräften? Warum ist der Elternabend wichtig? Wie komme ich mit der Schule in Kontakt?
Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Eltern, Kinder und Jugendliche in Graz unterstützt werden - und die Stadt setzt hier wirklich viele Angebote.
Simone Koren-Wallis:
Und ich glaube, das darf man wirklich nicht vergessen - deshalb finde ich den Spruch so schön: „Graz sind wir alle."
Kavita Sandhu:
Ganz genau.
Jeder Mensch soll sich in Graz zugehörig fühlen - und dafür setzen wir uns im Integrationsreferat ein.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge geht es um ein Pilotprojekt der Stadt Graz zur Eindämmung der Tigermückenplage.
Wir hören uns - ich freu mich!
Folge 74: Graz trauert – und wir sprechen darüber
Am 10. Juni wurde Graz von einem Ereignis erschüttert, das uns alle tief betroffen macht. Ein Amoklauf an einer Schule hat mehrere Menschenleben gefordert und viele weitere verletzt - körperlich wie seelisch. In dieser Folge wollen wir nicht über das Geschehene spekulieren, sondern mit Ursula Sampt von der internen Krisenprävention- und intervention der Stadt Graz Orientierung geben: Was passiert mit uns in solchen Momenten und wie wir auch mit Kindern darüber sprechen können.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Es ist ein Tag, den wir so schnell nicht vergessen werden.
Ein Tag, der uns alle erschüttert, der uns sprachlos macht.
Und doch müssen wir sprechen.
In Graz hat sich an einer Schule eine Tragödie ereignet, die uns tief ins Herz trifft.
Menschen haben ihr Leben verloren. Viele weitere wurden verletzt - körperlich und seelisch, für immer gezeichnet.
Unsere Gedanken sind bei den Familien, den Freund:innen, den Lehrkräften, den Einsatzkräften - bei allen, die einen Teil ihrer Welt verloren haben.
Wir nehmen diese Folge auf, weil wir glauben, dass es gerade jetzt wichtig ist, nicht zu schweigen.
Wir wollen darüber sprechen, wie man mit so einem Ereignis umgehen kann - als Erwachsene, als Eltern, aber auch als Gesellschaft.
Und wir wollen besonders darüber sprechen, wie wir mit Kindern und Jugendlichen über das Unfassbare reden können - ohne sie zu überfordern, aber auch ohne sie allein zu lassen.
Mein Name ist Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation, und mein Gast ist Ursula Sampt, die Leiterin der internen Krisenprävention und Intervention der Stadt Graz.
Liebe Ursula, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.
Wir sind beide Mütter. Dieser Tag hat uns beide sehr getroffen.
Wie geht man mit so etwas um?
Ursula Sampt:
Ich spüre deine Berührtheit - so wie ich sie heute auch schon gespürt habe.
Du hast gesagt, wir sind beide Mamas. Und gleichzeitig verlangt die berufliche Rolle nach Antworten.
Ich versuche, aus beiden Rollen zu sprechen - als Mutter und als Fachfrau.
Ich habe mir vorgenommen, authentisch zu sein, weil ich überzeugt bin, dass das greifbarer ist als gut gemeinte Ratschläge oder Verhaltenshinweise, die es in solchen Momenten ohnehin nicht wirklich gibt.
Als Mensch, als Mutter, war ich heute früh irritiert, als ich die Sirenen gehört habe.
Und als ich dann erfahren habe, dass etwas an einer Schule passiert ist, war meine erste Frage: Welche Schule?
Und ich muss ehrlich sagen - als ich gehört habe, dass es nicht die Schule meiner Kinder war, habe ich kurz aufgeatmet.
Und mich gleichzeitig sofort dabei ertappt: Was bedeutet das?
Ändert das etwas daran, dass andere Menschen ihr Leben verloren haben?
Nein, es ändert nichts.
Ich habe dann in meinem Büro eine Kerze angezündet und mich an Dinge gehalten, die ich mir über die Jahre angeeignet habe.
Ein gewisser Glaube an etwas, das mich trägt.
Und ein inneres Mantra: Das ist das Leben.
Das Leben besteht nicht nur aus schönen Momenten, sondern auch aus tiefgreifenden, berührenden Ereignissen.
Aus meiner beruflichen Perspektive bin ich nicht zum ersten Mal mit dem Thema Tod konfrontiert - ich habe schon öfter mit Betroffenen gearbeitet.
Es ist mir also nicht fremd, auch wenn es nie zur Routine wird.
Simone Koren-Wallis:
Was sind jetzt die wichtigsten Schritte in dieser akuten Phase - nicht nur für die betroffene Schule und die Familien, sondern auch für die Stadt Graz?
Gibt es da überhaupt etwas, das man tun kann?
Ursula Sampt:
Ein Satz, der mir dazu einfällt, lautet: Anerkennen, was ist.
Das ist ein philosophischer Ansatz - denn es ist passiert.
Was jetzt in vielen Köpfen passiert, ist die Frage nach dem Warum.
Warum ist das geschehen? Hätte man es verhindern können?
Ich glaube: Nein.
Es ist Teil eines Prozesses, der offenbar stattfinden musste.
Das Warum werden wir nie erfahren.
Wir können keine Strategien entwickeln, um so etwas künftig sicher zu verhindern - denn wir haben es mit Individuen zu tun.
Die Tat ging von einem Menschen aus, der sich - soweit bekannt - das Leben genommen hat.
Das heißt, wir werden auch hier nie erfahren, was ihn bewegt hat.
Und das ändert nichts am Schicksal der Betroffenen.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es jetzt konkrete Maßnahmen - für die Schüler:innen, für das Lehrpersonal vor Ort?
Natürlich gibt es psychologische Hilfe.
Aber ganz Graz, die ganze Steiermark, ganz Österreich - ja, die ganze Welt blickt heute betroffen auf unsere Stadt.
Was kann jede:r Einzelne für sich tun?
Ursula Sampt:
Eine allgemeingültige Antwort fällt mir schwer.
Es hängt vom Grad der Betroffenheit ab.
Es macht einen Unterschied, ob ich Mutter eines Opfers bin oder ob ich in Graz lebe und die Nachricht im Radio oder auf Social Media gehört habe.
Ich kann nicht sagen, was man tun sollte - denn das müsste im Austausch mit der jeweiligen Person geschehen.
Was mir spontan einfällt:
Eine gewisse Demut gegenüber dem Leben zu entwickeln - für die, die am Leben sind.
Das kann ein erster Schritt sein.
Unmittelbar Betroffene - etwa Schüler:innen, die das Geschehen miterlebt haben - befinden sich vermutlich in einer akuten Stresssituation.
Wir sprechen hier von einer akuten Belastungsreaktion.
In solchen Momenten geht es nicht um rationales Verstehen, sondern um emotionales Erleben.
Die Seele arbeitet - und sie arbeitet langsamer als der Verstand.
Was helfen kann, ist Achtsamkeit.
Sich selbst etwas Gutes tun.
Für den einen bedeutet das: in den Wald gehen, sich mit der Natur verbinden.
Für den anderen: Sport treiben, Musik hören, die gut tut.
Es gibt keine pauschale Antwort - aber sich selbst etwas Gutes zu tun, ist eine Ressource, an die man andocken kann.
Und: Es braucht Zeit.
Wir können nicht einfach einen Schalter umlegen und sagen: „Das war gestern - heute ist ein neuer Tag."
Es dauert.
Und wir sollten uns diese Zeit auch geben - jede:r in seinem Tempo, nach seinem Bedürfnis.
Wenn wir weniger direkt betroffen sind, kann auch Zusammenhalt helfen.
Das Positive sehen, das Verbindende betonen, über gute Dinge sprechen, füreinander da sein - trotz allem.
Simone Koren-Wallis:
Ich glaube, viele Eltern fragen sich jetzt:
Wie erkläre ich meinem Kind, was passiert ist?
Und das betrifft nicht nur direkt betroffene Kinder - auch kleine Kinder bekommen vieles mit, und größere sowieso.
Wie gehe ich als Elternteil mit dieser Situation zu Hause um?
Ursula Sampt:
Ich würde es ansprechen.
Zum Beispiel: „Hast du mitbekommen, was heute passiert ist?"
Dann würde ich fragen, was das Kind weiß - und mir erzählen lassen, wie es das erlebt oder verstanden hat.
Vielleicht auch: „Hast du eine Idee, warum so etwas passiert?"
Denn gerade über soziale Medien kursieren viele Informationen - viele Wahrheiten.
Jede:r teilt etwas, jede:r glaubt zu wissen, was richtig oder falsch ist.
Die Herausforderung ist, wieder zu sich selbst zurückzufinden - zur eigenen Intuition.
Als Eltern, Großeltern oder Bezugspersonen kennen wir unsere Kinder.
Wir beobachten sie, bieten Nähe an - wenn sie angenommen wird - und sind einfach da.
Ich würde es nicht zu kompliziert machen.
Nicht zu viele Hypothesen aufstellen - denn damit kann man auch etwas in ein Kind hineintragen, das gar nicht da ist.
Ein Beispiel:
Ich habe meine beiden Söhne angerufen - der eine ist elf, der andere vierzehn.
Ich habe gefragt: „Braucht ihr mich heute? Wollen wir den Tag gemeinsam verbringen?"
Die Antwort war: „Nein, Mama, alles gut. Ich gehe zum Training."
Das Kind meiner Freundin hingegen hat aktiv Nähe gesucht - wollte früher abgeholt werden, wollte zur Mama.
Das zeigt: Jedes Kind ist anders.
Wir können Sicherheit anbieten - aber keine absolute Sicherheit.
Das ist etwas, das wir sagen dürfen und müssen.
Simone Koren-Wallis:
Also du sagst: Ansprechen - auf jeden Fall?
Ursula Sampt:
Ja, unbedingt.
Ansprechen, was das Kind weiß, was es beschäftigt.
Wenn man merkt, dass Kinder abdriften, sich zurückziehen - dann kann man fragen: „Was beschäftigt dich gerade?"
So eine Situation wirft Lebensfragen auf - auch für Erwachsene.
Vielleicht sogar mehr für Erwachsene als für Kinder.
Denn wir verdrängen den Tod in unserer Gesellschaft.
Wir haben nicht gelernt, mit ihm umzugehen.
Und das macht es für Erwachsene oft schwerer als für Kinder.
Aber genau deshalb ist es wichtig, heute mit dem Kind zu sprechen - und morgen wieder.
Diese Aufarbeitung braucht Zeit.
Simone Koren-Wallis:
Wenn man jetzt auf die langfristige Begleitung und auch Prävention schaut - wie geht man mit den seelischen Folgen eines solchen Ereignisses um?
Bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen?
Ursula Sampt:
Ich denke, es gibt die Möglichkeit, das Erlebte gut zu integrieren.
Wir haben es hier mit einem Ereignis zu tun, das den Lebensfluss unterbrochen hat.
Das Ziel einer guten Begleitung - oder auch der eigenen Verarbeitung - kann sein, diesen Lebensfluss wieder durchgängig zu machen.
Das bedeutet: Integration.
Wir werden das Erlebte nie vergessen - aber wir können lernen, es in unser Leben zu integrieren.
Das ist möglich.
Ich spreche aus Erfahrung - auch aus Begleitungen, in denen es Todesfälle gab.
Manchmal dauert es Monate, aber die Integration kann gelingen.
Nicht, wenn man wegschaut - sondern wenn man hinschaut.
Was mir besonders am Herzen liegt:
Überlegen wir gut, welche Nachrichten wir täglich konsumieren.
Welche Botschaften wir in uns aufnehmen.
Denn jede Information wirkt auf unseren Körper, auf unsere Seele.
Wenn ich mich ständig mit negativen Inhalten umgebe, kann ich auf Dauer nicht seelisch gesund bleiben.
Es gibt Menschen, die sich regelrecht durch Katastrophen scrollen - sogenannte „Station Seekers".
Diese Menschen beneide ich nicht.
Denn das, womit wir uns umgeben, spüren wir innerlich - und das macht auf Dauer krank.
Meine Einladung lautet:
Bearbeitet das, was jetzt da ist.
Schaut hin.
Fragt euch: Was habe ich erlebt? Wie habe ich es erlebt?
Im Kollektiv ist das oft einfacher als allein.
Und: Gebt euch die Zeit, die es braucht.
Für manche fühlt sich dieser Tag wie ein Weltuntergang an - vor allem für jene, die jemanden verloren haben.
Für andere ist es vielleicht ein zweiter Geburtstag - weil sie überlebt haben.
Wir haben es mit ganz unterschiedlichen Situationen und Betroffenheiten zu tun.
Deshalb gibt es keinen allgemeingültigen Weg.
Wir sind Individuen - und jeder verarbeitet anders.
Simone Koren-Wallis:
Ich muss diese Frage stellen:
Du bist die Leiterin der internen Krisenprävention und Intervention.
Welche Rolle spielt Prävention?
Und kann man solche Taten überhaupt verhindern?
Ursula Sampt:
Meine persönliche Meinung: Nein.
Verhindern kann man solche Taten nicht.
Man kann nur achtsam sein - und Dinge rechtzeitig ansprechen, wenn einem etwas auffällt.
Aber selbst die besten Sicherheitskonzepte und Präventionsmaßnahmen können ein außergewöhnliches Ereignis wie dieses nicht verhindern.
Denn wir können nicht in Menschen hineinschauen.
Wir wissen nicht, welche Verletzungen, Kränkungen oder inneren Konflikte jemand erlebt hat.
Was wir tun können:
Auf uns selbst schauen.
Unsere eigene seelische Gesundheit pflegen.
Weniger auf andere schauen - mehr auf uns selbst.
Wenn ich als Mutter oder Vater achtsam bin, lebe ich das meinen Kindern vor.
Und das ist Prävention.
Auch das Vertrauen ins Leben gehört dazu.
Das klingt vielleicht paradox - gerade nach so einem Tag.
Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern:
Es gibt viele positive Erlebnisse.
Und die meisten Menschen sind gut.
Wenn wir mit einer positiven Haltung durchs Leben gehen, ist die Chance groß, dass wir auch Positives zurückbekommen.
Leider haben wir das verlernt.
Wir gehen oft mit Sorgen, Vorbehalten und Vorurteilen durchs Leben - und manchmal werden diese Vorurteile dann zur Realität.
Nach einem Tag wie heute ist das alles schwer zu begreifen.
Aber ich möchte trotzdem ein Stück Perspektive geben.
Für die unmittelbar Betroffenen gibt es nichts, was den Schmerz nimmt.
Der Schmerz bleibt.
Aber ihn zu durchleben ist eine Chance, ihn zu integrieren.
Und gerade in solchen fürchterlichen Momenten sieht man auch, wie eine Stadt zusammenhält.
Das ist das Schöne.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es etwas, das du den Menschen in Graz noch mitgeben möchtest - als Expertin, aber auch als Mensch?
Ursula Sampt:
Lächeln wir uns an, wenn wir uns begegnen - auch wenn es schwerfällt.
Mir fällt es nicht schwer.
Der Blick von Angesicht zu Angesicht, das in-die-Augen-Schauen - das öffnet das Tor zur Seele.
Und das ist der schönste und einfachste Zugang zum anderen.
Das haben wir verlernt.
Die meisten Blicke gehen nach unten - auf den Boden, aufs Smartphone.
Meine Botschaft ist vielleicht unkonventionell, aber sie ist einfach:
Schaut euch wieder an.
Das kostet nichts - und verbindet uns wieder.
Ich habe kein Patentrezept.
Und ich möchte auch keines geben.
Das wäre überheblich und würde dem individuellen Erleben nicht gerecht.
Simone Koren-Wallis:
Danke, dass Sie zugehört haben - an einem Tag, der uns alle tief erschüttert.
Vielleicht habt ihr beim Zuhören gemerkt:
Es gibt keine einfachen Antworten.
Jede:r muss seine eigene Antwort finden.
Aber es gibt Wege, mit dem Unfassbaren umzugehen.
Wege, die wir gemeinsam gehen können - als Eltern, als Freund:innen, als Familie und als Stadt.
Und wenn Sie selbst betroffen sind oder jemanden kennen, der Unterstützung braucht:
Bitte zögern Sie nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Es ist kein Zeichen von Schwäche - sondern von Stärke, sich begleiten zu lassen.
Auch wenn die Welt gerade stillzustehen scheint - sie dreht sich weiter.
Und wir können mithelfen, dass sie sich in eine Richtung bewegt, in der Mitgefühl, Achtsamkeit und Zusammenhalt mehr zählen als Angst und Gewalt.
Passen Sie gut auf sich auf - und aufeinander.
In Gedenken an alle, die heute ihr Leben lassen mussten.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 73: In memoriam Alfred Stingl
Diese Folge ist dem Grazer Altbürgermeister Alfred Stingl gewidmet. Wir sprechen über sein Vermächtnis und die vielen Spuren, die er hinterlassen hat. Peter Grabensberger erzählt von elf Jahren enger Zusammenarbeit - und von einem „Sir", der nie laut wurde und stets für andere da war.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
In Memoriam Alfred Stingl.
Diese Folge ist dem Gedenken an den Grazer Altbürgermeister gewidmet.
Wir sprechen über sein Vermächtnis und die vielen Spuren, die er hinterlassen hat.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation, und mein Gast ist Peter Grabensberger.
Peter Grabensberger:
Hallo, mein Name ist Peter Grabensberger.
Ich hatte das Vergnügen, elf Jahre lang im Bürgermeisteramt unter Alfred Stingl tätig zu sein - als Pressesprecher, zuständig für Protokollfragen und internationale Beziehungen.
Diese Zeit dauerte bis zum Jahr 2000, als ich nach einem Assessment die Leitung des Kulturamts übernehmen durfte.
Simone Koren-Wallis:
Wir sprechen heute über einen Mann, der nicht nur langjähriger Bürgermeister von Graz war, sondern auch weit über die Politik hinaus gewirkt hat.
Für mich war er ein „Sir".
Herr Grabensberger, wie würden Sie Alfred Stingl als Persönlichkeit beschreiben?
Peter Grabensberger:
In meinem inzwischen auch schon langen Leben gab es nur wenige Persönlichkeiten, die so viel Korrektheit und gleichzeitig so viel Einfühlungsvermögen ausgestrahlt haben wie Alfred Stingl.
Er war ein zutiefst korrekter Mensch - und manche meinten sogar, das habe sich bis zu seiner Frisur durchgezogen, die immer kerzengerade war.
Äußerlichkeiten waren ihm eigentlich nicht wichtig.
Es gab jahrelange Diskussionen über seine große Brille, die für sein schmales Gesicht als „zu groß" empfunden wurde.
Er hat sich davon nie beirren lassen - bis er einmal bei einer Aktion einer Zeitung und der Optikerinnung mitgemacht hat, bei der ihm eine neue Brille „verordnet" wurde.
Das hat mich damals als sein Öffentlichkeitsarbeiter ziemlich überrascht - ich hatte immer gesagt: „Lasst ihn in Ruhe, er weiß selbst, was ihm steht."
Aber er hat zugestimmt - auch, weil die Aktion unter einem sozialen Motto stand.
Und damit sind wir bei seinem zentralen Thema: soziale Offenheit.
Die hat er in allen Lebenslagen ausgestrahlt.
Simone Koren-Wallis:
Wie war Alfred Stingl als Bürgermeister?
Peter Grabensberger:
Er war ein sehr korrekter und hilfsbereiter Bürgermeister.
Es war ihm wichtig, dass Graz sich öffentlich gut präsentieren konnte - und das ist ihm nachhaltig gelungen.
Er war aktiv im Rat der Gemeinden und Regionen Europas und engagiert im interreligiösen Dialog.
Obwohl er selbst keiner Konfession angehörte, hat er sich intensiv um die Religionsgemeinschaften in Graz und darüber hinaus gekümmert.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es Anekdoten aus Ihrer gemeinsamen Zeit, die den Menschen Alfred Stingl zeigen?
Ich habe einmal gelesen, er habe kaum gegessen - außer Apfelstrudel. War das sein Leibgericht?
Peter Grabensberger:
Ob es sein Leibgericht war, weiß ich nicht genau.
Aber seine Chefsekretärin Eva Schmid - leider auch schon verstorben - hat immer versucht, ihm im Tagesverlauf etwas zu essen „unterzujubeln".
Das Einzige, was ihr regelmäßig gelungen ist, war Apfelstrudel.
Er hat ihn gern gegessen - vielleicht auch wegen des Energieschubs durch den Zucker.
Aber grundsätzlich war Essen ein schwieriges Thema für ihn - ebenso wie das Trinken.
Er hat mir oft gesagt, dass er im Laufe des Tages genug isst.
Was er damit meinte:
Bei den Ehrungen von 90- bis 100-jährigen Mitbürger:innen haben die Gastgeberinnen oft Brötchen vorbereitet - voller Freude, dass der Bürgermeister persönlich kommt.
Und obwohl die Brötchen manchmal schon etwas „fortgeschritten" waren, hat er sie aus Respekt und Wertschätzung trotzdem gegessen.
Er war ein tapferer Gast - und hat die Mühe der Gastgeberinnen sehr geschätzt.
Simone Koren-Wallis:
Ich finde es gerade sehr schön, dass wir über einen Menschen sprechen, der zwar nicht mehr unter uns ist - aber dessen Geschichten bleiben.
Wenn Sie über ihn erzählen, sieht man das Leuchten in Ihren Augen.
Alfred Stingl war für Sie ein ganz besonderer Mensch, oder?
Peter Grabensberger:
Ja, das war er auf jeden Fall.
Ich hatte auch vor und nach meiner Zeit im Bürgermeisteramt immer wieder beruflich mit ihm zu tun - zuletzt als Kulturamtsleiter in den letzten drei Jahren seiner Amtszeit.
Was mich besonders fasziniert hat:
Er hat nie laut gesprochen.
Nie.
Man hat mit Freude für ihn gearbeitet - mit einem gewissen „vorauseilenden Gehorsam", wie meine Frau einmal gesagt hat.
Und das stimmt wohl.
Denn wenn man um sieben Uhr früh mit ihm sprechen konnte - das war die einzige ruhige Zeit - wusste man, dass ab halb acht der Tag durchgetaktet war, oft bis 22 Uhr.
Man hat sich einfach bemüht, seine Ideen für Graz bestmöglich umzusetzen.
Simone Koren-Wallis:
Sie haben vorhin das Soziale angesprochen - das war ja sein zentrales Anliegen, oder?
Peter Grabensberger:
Ja, das Soziale stand bei ihm über allem.
Schon als jüngster Jugendstadtrat unter Bürgermeister Gustav Scherbaum war er stark sozial engagiert.
Er war immer Sozialreferent - und es war ihm bei jeder Verhandlung wichtig, dass er diese Funktion behalten durfte.
Die Freundschaft mit Wolfgang Pucher ist da ein gutes Beispiel.
Die beiden haben sich auf Augenhöhe begegnet - und gemeinsam für die Schwächsten in unserer Stadt gearbeitet.
Das war Alfred Stingl ein echtes Herzensanliegen.
Simone Koren-Wallis:
Was würden Sie sagen - was ist das Erbe von Alfred Stingl?
Peter Grabensberger:
Puh, das ist eine sehr schwierige Frage.
Für mich persönlich gibt es viele Punkte in Graz, bei denen ich weiß, dass Alfred Stingl politisch maßgeblich beteiligt war.
Ob es das ReSoWi-Zentrum im Universitätsbereich ist, die neuen Anlagen am Rosenhain oder das geriatrische Krankenhaus in der Albert-Schweitzer-Gasse - all das trägt für mich seine Handschrift.
Auch viele Bauten, die im Rahmen des Europäischen Kulturhauptstadtjahres 2003 finalisiert wurden, gehen auf seine Initiative zurück.
Was ich besonders betonen möchte:
Er hat all das immer im größtmöglichen Einvernehmen mit anderen politischen Parteien umgesetzt.
Ich erinnere mich gut daran, wie er etwa die Verkehrspolitik von ÖVP-Vizebürgermeister Erich Edegger verteidigt hat - sogar gegen Widerstand aus der eigenen Partei.
Oder wie er gemeinsam mit Helmut Strobl große Kulturprojekte auf den Weg gebracht hat.
1993 durften wir den Europäischen Kulturmonat veranstalten - und 2003 wurde Graz Kulturhauptstadt Europas.
Das war möglich, weil Alfred Stingl über Parteigrenzen hinweg gedacht und gehandelt hat.
Und genau das hat ihn ausgemacht.
Simone Koren-Wallis:
Er war ja auch ein großer Musik- und Opernfan, oder?
Peter Grabensberger:
Ja, das stimmt absolut.
Seine Leidenschaft für Musik - besonders für Oper - wurde schon in seiner Kindheit geweckt.
Sein Vater war Mitglied der Berufsfeuerwehr Graz, die damals bei Opernaufführungen Sicherheitsdienste übernommen hat.
Und der kleine Alfred durfte mitkommen.
So entstand seine Liebe zur Oper - und die hat ihn sein Leben lang begleitet.
Er hatte eine beeindruckende Sammlung von Opernprogrammen der Grazer Oper.
Was besonders spannend war:
Durch die Offenheit der Grazer Kommunalpolitik - mit Persönlichkeiten wie Maxi Uray-Frick und Helmut Strobl - konnten sich in Graz neue, moderne Operninszenierungen entwickeln.
Ein Beispiel ist Peter Konwitschny, der in Graz groß geworden ist.
Die Haltung war: Zulassen statt verhindern.
Und genau dadurch entstanden diese wunderbaren zeitgenössischen Interpretationen klassischer Werke.
Simone Koren-Wallis:
An was denken Sie persönlich besonders gern zurück?
Peter Grabensberger:
Ob es Reisen in die Schwesterstädte waren oder kleine, scheinbar unbedeutende Ereignisse in Graz - es war einfach schön, mit ihm unterwegs zu sein.
Ich erinnere mich an eine Fahrt mit der Straßenbahn:
Egal ob im Dienstwagen oder öffentlich unterwegs - Alfred Stingl hat jedes herumliegende Papier gesehen und aufgehoben.
Da habe ich dann versucht, schneller zu sein als er - und den „vorauseilenden Gehorsam" entwickelt, wie meine Frau es nennt.
Das sind diese kleinen, liebenswerten Begegnungen, die bleiben.
Wir hatten als Kolleg:innen viele schöne Momente mit ihm - und die bleiben unvergessen.
Folge 72: Wildes Graz – Naturschutz mitten in der Stadt
Die Natur hat in Graz viele Gesichter - doch wir übersehen sie oft.
In dieser Folge spricht Naturschutzbeauftragter Michael Tiefenbach über wandernde Falken, schützenswerte Fledermäuse und warum Naturschutz nicht nur Aufgabe der Stadt ist - sondern auch eine Einladung an uns alle.
Ein Spaziergang an der Mur, der die Augen (und bei manchen auch die Ohren) öffnet.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Falken, Fledermäuse, Schlangen - und ganz, ganz viele Vögel mitten in Graz.
Ich bin Simone Koren-Wallis, und gemeinsam mit dem Naturschutzbeauftragten der Stadt Graz zeigen wir euch heute, wie wild unsere Landeshauptstadt eigentlich ist - und was jede:r von uns für den Naturschutz tun kann.
Michael Tiefenbach:
Hallo, mein Name ist Michael Tiefenbach.
Ich bin seit etwas mehr als zwei Jahren Naturschutzbeauftragter der Stadt Graz.
Simone Koren-Wallis:
Mit einem Naturschutzbeauftragten war klar: Dieses Interview führen wir nicht irgendwo drinnen.
Wir schlendern gerade durch den Augarten, entlang der Mur.
„Naturschutzbeauftragter" sagt eigentlich schon viel - aber vielleicht magst du trotzdem kurz erklären, was genau deine Aufgaben sind?
Michael Tiefenbach:
Ich bin einerseits Vertreter der Natur in der Stadt Graz - und andererseits das „Maßband" der Behörde.
Das heißt: Ich erstelle Gutachten und Stellungnahmen zu verschiedensten Vorhaben - etwa Veranstaltungen oder Bauprojekte - und prüfe sie nach den Vorgaben des Naturschutzgesetzes.
Simone Koren-Wallis:
Du hast vorhin von Artenvielfalt gesprochen.
Gibt es Tiere, von denen du sagst: Das wissen viele Grazer:innen gar nicht, dass es sie hier gibt?
Michael Tiefenbach:
Ein gutes Beispiel ist der Wanderfalke.
Seit mehreren Jahren brütet ein Wanderfalkenpaar am Turm der Herz-Jesu-Kirche - eine tolle Geschichte!
Wir haben dort mittlerweile eine Webcam installiert, über die jede:r das Brutgeschehen live verfolgen kann - mit allen Höhen und Tiefen.
Oder die große Hufeisennase - eine Fledermausart, die früher deutlich weiter verbreitet war.
Heute gibt es in ganz Österreich nur noch eine einzige Wochenstube, also ein Fortpflanzungsquartier - und das befindet sich im Schloss Eggenberg.
Das ist wirklich etwas Besonderes.
Simone Koren-Wallis:
Wir gehen gerade an der Mur entlang und sehen auch Enten.
Ist da etwas Spezielles dabei? Für mich ist Ente gleich Ente - aber du schaust schon ganz genau.
Michael Tiefenbach:
Die weißen Enten mit dem grünlich-dunklen Kopf sind Gänsesäger.
Das ist eine Entenart, die sich in den letzten Jahrzehnten besonders im Siedlungsraum etabliert hat.
Sie brütet in Baumhöhlen und ernährt sich fast ausschließlich von Fischen - was nicht alle Angler freut.
Aber es ist eine echte Erfolgsgeschichte.
Simone Koren-Wallis:
Ich kenne das selbst als Mama:
Wenn man mit Kindern ans Wasser geht, heißt es oft: „Mama, ich will sie füttern!" - und dann landet Brot im Wasser.
Aber das ist genau das Falsche, oder?
Michael Tiefenbach:
Ganz genau.
Der Verdauungstrakt von Enten ist nicht dafür ausgelegt, Brot zu verarbeiten.
Und abgesehen davon finden Enten - wie die meisten Vögel - in der Natur ausreichend Nahrung.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt sind wir ganz nah an der Mur - und da sind auch Schlangen ein Thema, oder?
Michael Tiefenbach:
Ja, Schlangen sind definitiv ein Thema - besonders an der Mur, aber auch an anderen Gewässern und sogar in trockeneren Lebensräumen.
In Graz gibt es vier verschiedene Schlangenarten:
- Die Würfelnatter, die direkt am Gewässer lebt.
- Die Ringelnatter, die eher in der Nähe von stehenden Gewässern vorkommt.
- Die Äskulapnatter und die Schlingnatter, die trockene, terrestrische Lebensräume bevorzugen.
Simone Koren-Wallis:
Du bist nicht nur Naturschutzbeauftragter - du bist auch ein echter Vogelexperte, oder?
Michael Tiefenbach:
Ja, das ist mein Steckenpferd seit meiner Kindheit.
Ich habe mich früh für die Natur interessiert - und besonders für Vögel.
Ich fotografiere sie auch - und wenn ich unterwegs bin und einen Vogel höre, kann ich meist sofort sagen, welcher es ist.
Simone Koren-Wallis:
Dann machen wir die Probe aufs Exempel. (Es zwitschert.)
Michael Tiefenbach:
Das ist eine Mönchsgrasmücke - ein kleiner Singvogel, relativ unscheinbar, aber doch markant.
Sie ist ein Zugvogel und überwintert meist im Mittelmeerraum.
Bei uns ist sie ein häufiger Brutvogel.
Simone Koren-Wallis:
Der singt aber ganz schön laut, oder?
Michael Tiefenbach:
Ja, das stimmt. (Es zwitschert wieder.)
Das war ein Stieglitz - sein Ruf klingt metallisch.
Im Moment ist Brutzeit.
Vögel singen, um ihr Revier abzugrenzen - und bei den meisten Arten singen nur die Männchen.
Der Gesang dient dazu, Weibchen anzulocken und Konkurrenten fernzuhalten.
Aber Vögel haben auch andere Lautäußerungen:
Es gibt Kontaktrufe, Warnrufe - ein ganzes Repertoire.
Wenn man die Stimmen kennt, muss man gar nicht mehr hinschauen - man hört einfach, wer da singt.
(Es zwitschert.)
Das ist wieder eine Mönchsgrasmücke - diesmal mit einem Warnruf.
Klingt fast wie zwei Kieselsteine, die man aneinander schlägt.
Sie hat wahrscheinlich ein Nest in der Nähe und warnt vor uns - obwohl wir ihr nichts tun. Aber das weiß sie nicht.
Simone Koren-Wallis:
Ich finde es total spannend, dass wir mitten in der Stadt sind - und trotzdem so eine Artenvielfalt haben.
Das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst.
Michael Tiefenbach:
Ja, das ist den meisten nicht bewusst.
Die Stadt ist nicht nur ein einzelner Lebensraum - sie ist ein Mosaik aus vielen verschiedenen Lebensräumen.
Und dadurch gibt es auch eine große Vielfalt an Arten.
(Es zwitschert.)
Ein Taubenpaar - die schmusen gerade.
Simone Koren-Wallis:
Aber sind Tauben ein Problem?
Michael Tiefenbach:
Tauben können durchaus zum Problem werden - vor allem durch ihre Ausscheidungen.
Der Kot ist sehr sauer und kann historische Bausubstanz beschädigen.
Außerdem besteht ein gesundheitliches Risiko, da Taubenkot Krankheitserreger enthalten kann.
Aber: Ältere Grazer:innen werden bestätigen, dass der Bestand an Straßentauben in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen ist.
Ich erinnere mich noch als kleiner Junge - am Hauptplatz oder Jakominiplatz gab es richtige Taubenschwärme.
Heute sieht man das kaum noch.
Der Grund: Das Angebot an Brutplätzen ist stark zurückgegangen.
Viele Menschen haben ein Problem mit Straßentauben und vergittern potenzielle Brutplätze - Dachböden, Nischen, Vorsprünge.
Auch Abwehrspieße werden angebracht.
Das hat leider auch Auswirkungen auf andere Arten, die ähnliche Brutplatzpräferenzen haben - zum Beispiel Fledermäuse.
Wenn Dachböden vergittert sind, können sie ihre angestammten Wochenstuben nicht mehr aufsuchen.
Was mir dazu einfällt:
Wir haben eine Meldeplattform für Gebäudebrüter.
Jede:r Bürger:in kann dort ein Brutvorkommen melden - etwa von Mauerseglern, Mehlschwalben, Turmfalken oder Dohlen.
Einfach auf der Website der Stadt Graz nach „Gebäudebrüter Meldeplattform" suchen.
Die Beobachtung wird mir zugeschickt, ich überprüfe sie und trage sie in eine interaktive Karte ein.
So kann jede:r sehen, wo sich Gebäudebrüter in Graz befinden - und wir erhalten wertvolle Daten für unsere tägliche Naturschutzarbeit.
Simone Koren-Wallis:
Und am Rathaus gibt es ja auch Kunstnester für Mehlschwalben, oder?
Michael Tiefenbach:
Genau.
Seit einigen Jahren gibt es an der Außenfassade des Rathauses Kunstnester für Mehlschwalben.
Wenn man aufs Rathaus blickt, sieht man sie etwa in halber Höhe - unter den Ornamenten und Strukturen, wo sie einigermaßen witterungsgeschützt sind.
Sie sehen ein bisschen aus wie verkehrte Kokosnüsse.
Mehlschwalben sind Gebäudebrüter - ein einzelnes Nest bringt wenig.
Man sollte sie geclustert anbringen - ein Dutzend reicht meist schon aus, je mehr, desto besser.
Die Mehlschwalben überwintern in Zentralafrika.
Das gilt für die meisten insektenfressenden Vogelarten.
Man erkennt das übrigens am Schnabel:
- Ein schlanker, pinzettenartiger Schnabel = Insektenfresser.
- Ein kräftiger Schnabel = Körnerfresser.
Körnerfresser können bei uns überwintern - Insektenfresser müssen in den Süden, weil es hier im Winter keine Insekten gibt.
Aber schau - die ersten Mehlschwalben sind gerade angekommen.
Sie dürften in den letzten Tagen zurückgekehrt sein.
Mehlschwalben haben eine ausgeprägte Brutplatztreue.
Wenn sich einmal eine Kolonie etabliert hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Nester jedes Jahr wieder besetzt werden.
Simone Koren-Wallis:
Was würdest du dir wünschen - für die Stadt Graz, für die Natur?
Michael Tiefenbach:
Mein persönlicher Wunsch wäre, dass die Sensibilität für die Natur in der Bevölkerung noch weiter zunimmt.
Unabhängig davon, was die Stadt Graz tun kann - jede Privatperson kann selbst etwas beitragen.
Und oft sind es ganz einfache Maßnahmen:
- Eine Ecke im Garten einfach mal ungepflegt lassen - nicht alles mit dem Rasenmäher bearbeiten.
- Gehölze pflanzen, die Vogelarten mit Beeren versorgen.
- Extensive Pflege statt Überpflege im eigenen Grünbereich.
Das hilft der Artenvielfalt - und macht unsere Stadt noch ein Stück wilder und lebenswerter.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge feiern wir Geburtstag - und zwar 20 Jahre Integrationsreferat in Graz.
Es geht um Vielfalt, Zusammenhalt und darum, was wirklich hilft, wenn Menschen neu in unsere Stadt kommen.
Wir hören uns - ich freu mich!
Folge 71: Ins Ungewisse - Graz nach 1945
Wie lebt man weiter, wenn alles in Trümmern liegt? Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes werfen wir einen Blick auf Graz in der Zeit von 1945 bis 1965. Die beiden Kurator:innen Annette Rainer und Bernhard Bachinger des Graz Museums erzählen von ihrer neuen Ausstellung "Ins Ungewisse", die ab 25. Juni zu sehen ist.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Wie lebt man weiter, wenn alles in Trümmern liegt?
Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes werfen wir einen Blick zurück auf Graz - und zwar auf die Zeit von 1945 bis 1965.
Damit tauchen wir auch ein in die neue Ausstellung des Graz Museums: „Ins Ungewisse".
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation und unterwegs mit Annette Rainer und Bernhard Bachinger.
Bernhard Bachinger:
Hallo, mein Name ist Bernhard Bachinger.
Ich bin seit 2021 als Kurator im Graz Museum tätig und darf Ausstellungen kuratieren.
Annette Rainer:
Mein Name ist Annette Rainer.
Ich bin ebenfalls Kuratorin im Graz Museum und auch in der Kulturvermittlung tätig.
Simone Koren-Wallis:
Wir haben uns heute ein Café ausgesucht - mit Blick auf den Schlossberg und das Graz Museum, das gleich nebenan liegt.
Es geht um das Gedenkjahr schlechthin.
Bernhard, magst du als Historiker kurz erklären, worum es dabei eigentlich geht?
Bernhard Bachinger:
2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal - ein Anlass, der uns alle betrifft.
Simone Koren-Wallis:
Und dazu gibt es eine Ausstellung im Graz Museum?
Annette Rainer:
Genau.
Wir haben diesen Anlass genutzt, um eine Ausstellung speziell zur Stadt Graz und zur Zeit von 1945 bis 1965 zu gestalten.
Das ist der Zeitraum, mit dem wir uns intensiv beschäftigen.
Warum gerade diese Zeitspanne?
Das Graz Museum hat heuer das Jahresmotto „Stadtdemokratie".
Und deshalb wollen wir in der Ausstellung besonders zeigen, wie sich nach 1945 - nach einer Zeit der Diktatur und Repression - Demokratie in Graz entwickeln konnte.
Wie haben die Menschen gelernt, demokratisch zu denken und zu leben?
Simone Koren-Wallis:
Bernhard, kannst du uns ein bisschen die damalige Situation schildern - damit wir ein Gefühl für diese Zeit bekommen?
Bernhard Bachinger:
Es ist wirklich schwer, sich das heute vorzustellen.
1945 war eine Zeit, in der es um das pure Überleben ging.
Die Stadt war stark zerstört - nicht nur physisch, sondern auch seelisch.
Es gab kaum Nahrung, zu wenig Wohnraum, Flüchtlingsströme - und keine Perspektive.
Die Menschen wussten nicht, wie es weitergeht.
Sie mussten sich um ihr eigenes Leben kümmern und gleichzeitig die Scherben aufkehren, die Austrofaschismus und Nationalsozialismus hinterlassen hatten.
Simone Koren-Wallis:
Also eine Zeit, die man sich kaum vorstellen kann - und auch nicht vorstellen will.
Bernhard Bachinger:
Nein, natürlich nicht.
Vor allem die ersten Monate waren ein echter Existenzkampf.
Die Menschen mussten mit offiziell knapp 650 Kalorien pro Tag auskommen.
Wer nicht tauschen, hamstern oder am Schwarzmarkt etwas besorgen konnte, hat extremen Hunger gelitten.
Es war eine sehr, sehr schwere Zeit.
Simone Koren-Wallis:
Wie hat Graz damals ausgesehen? Kann man das bildlich beschreiben?
Bernhard Bachinger:
Die Stadt war teilweise stark zerstört - besonders das Bahnhofsviertel, weil dort große Fabriken standen und es stark bombardiert wurde.
Es musste alles wieder aufgebaut werden.
1945 stand die Stadtregierung vor riesigen Herausforderungen - und später auch mit Unterstützung der Besatzungsmächte.
Zuerst waren die sowjetischen Besatzer da, ab Juli dann die Briten.
Aber es fehlte an Transportmitteln - keine Autos, kaum Infrastruktur.
Man musste vieles mit Pferdefuhrwerken in die Stadt bringen - wenn es überhaupt etwas zu bringen gab.
Und so entstand der Mythos der „Stunde Null" - der absolute Neuanfang.
Simone Koren-Wallis:
Habt ihr für die Ausstellung auch mit Zeitzeug:innen gesprochen?
Annette Rainer:
Ja, wir haben mit Zeitzeug:innen gesprochen - und auch mit der Universität Graz kooperiert.
Dort gibt es bereits aufgezeichnete Interviews, die wir für die Ausstellung nutzen.
So können wir bestimmte Themen dokumentieren - und Ausschnitte davon werden auch in der Ausstellung zu sehen sein.
Simone Koren-Wallis:
Worauf legt ihr in der Ausstellung den Fokus?
Annette Rainer:
Die Ausstellung hat mehrere Ebenen.
Einerseits zeigen wir die Lebensrealitäten der Menschen - unter anderem durch Zeitzeug:innen-Interviews.
Andererseits beschäftigen wir uns mit konkreten Fakten:
Wie war die Stadt organisiert?
Wie sah die Politik aus?
Wie verliefen die Migrationsströme?
Wie haben die Menschen ihr Geld verdient?
Wie war die wirtschaftliche Lage?
Diese Themen dokumentieren wir mit Objekten und Texten - und machen sie für die Besucher:innen greifbar.
Zusätzlich gibt es eine künstlerische Ebene:
Wir zeigen Kunstwerke, die einen assoziativen Zugang zur Zeit ermöglichen.
Sie laden dazu ein, die Epoche emotional nachzuempfinden.
Simone Koren-Wallis:
Heißt das auch, dass ihr den Menschen ein Bild davon geben wollt, wie es früher war - und vielleicht auch ein bisschen Demut fördern möchtet?
Ist das ein Hintergrundgedanke? Oder was macht diese Ausstellung für euch so besonders?
Annette Rainer:
Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, sich zu erinnern - daran, wie es war.
Wie schrecklich Krieg und seine Folgen sind.
Und auch, welche Auswirkungen ein Regime wie das NS-Regime oder generell eine Diktatur auf eine Gesellschaft hat.
Uns ist es ein Anliegen, zu zeigen, wie wertvoll demokratische Werte sind - und wie wichtig es ist, für sie einzustehen.
Wir wollen vermitteln, wie privilegiert wir sind, heute in einer freien Gesellschaft leben zu dürfen.
Natürlich wollen wir das nicht mit erhobenem Zeigefinger tun - aber diese Botschaft schwingt ganz klar mit.
Simone Koren-Wallis:
Es passiert ja einiges in diesem Gedenkjahr.
Am 9. Mai gibt es eine große Gedenkveranstaltung am Schlossberg.
Wann wird die Ausstellung eröffnet?
Annette Rainer:
Unsere Ausstellung „Ins Ungewisse - Graz 1945 bis 1965" wird am 25. Juni eröffnet und läuft dann für etwa drei Viertel eines Jahres.
Bernhard Bachinger:
Der Titel „Ins Ungewisse" beschreibt die Situation sehr treffend.
1945 war vieles ungewiss.
Ein Großteil der männlichen Bevölkerung war noch in Kriegsgefangenschaft - viele kamen erst Jahre später zurück, teilweise erst Ende der 1940er oder Anfang der 1950er Jahre.
Familien waren zerrissen, die Gesellschaft war in Bewegung.
Graz war eine Anlaufstelle für sogenannte „Volksdeutsche" aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Ungarn, Rumänien - und auch für Heimatvertriebene aus der Tschechoslowakei.
Die Stadtgesellschaft musste sich neu formieren - und gleichzeitig mit inneren Spannungen umgehen.
Ein Beispiel:
1947 gab es einen auffälligen Anstieg an Scheidungen.
Das zeigt, wie schwierig es war, nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft wieder in die Familie und in die Gesellschaft zurückzufinden.
Viele Menschen waren traumatisiert - und das hat sich auch auf die Beziehungen ausgewirkt.
Simone Koren-Wallis:
Also es war für niemanden leicht - auch nicht für das Konstrukt Familie, oder?
Bernhard Bachinger:
Ganz genau.
Die Nachkriegsgesellschaft war geprägt von einem starken Frauenüberhang.
Das führte zu gesellschaftlichen Spannungen:
Einerseits gab es die Erwartung, zu heiraten und eine Familie zu gründen - andererseits fehlten schlichtweg die Männer.
In der Ausstellung greifen wir auch das Thema Kontaktanzeigen auf.
Das ist sehr spannend - denn über Zeitungen wurden damals Ehepartner gesucht.
Da finden sich hunderte Beispiele:
„Kriegswitwe sucht neuen Mann", „Heimkehrer sucht Frau".
Und oft wird auch die wirtschaftliche Situation beschrieben:
„Ich habe Eigenmittel", „Ich betreibe ein kleines Geschäft", „Ich habe eine Wohnung".
Das zeigt, wie eng Partnersuche und wirtschaftliche Sicherheit miteinander verknüpft waren.
Annette Rainer:
Was ich besonders schön finde:
Unsere Ausstellung zeigt nicht nur die dramatische Zeit der unmittelbaren Nachkriegsjahre - sondern auch den Aufbruch, den beginnenden Wirtschaftswunder-Zeitgeist.
Wir erzählen also nicht nur von Tristesse, sondern auch von Hoffnung und Neubeginn.
Und ich hoffe, dass unsere Erzählungen neugierig gemacht haben - und wir uns in der Ausstellung „Ins Ungewisse - Graz 1945 bis 1965" wiedersehen, ab dem 25. Juni im Graz Museum.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge bin ich wieder unterwegs für die Natur - und zwar mit dem Naturschutzbeauftragten der Stadt Graz.
Wir hören uns - ich freu mich!
Folge 70: Wenn die BIM Pause macht - Graz im Schienenersatzmodus
Wie ersetzt man vier Straßenbahnlinien gleichzeitig - und was heißt das für alle, die täglich durch die Stadt müssen?
Wir waren mit dem Fahrplankoordinator der Graz Linien Bernd Fiedler auf Baustellenbesuch, wo ab Mai die Gleise zwischen der Annenstraße und der Vorbeckgasse angebunden werden und die 1, 4, 6 und 7er Straßenbahnen bis September nicht mehr fahren.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Wie ersetzt man eigentlich vier Straßenbahnlinien auf einmal?
Und was bedeutet das für alle, die täglich in Graz unterwegs sind?
Das werden wir ab Mai alle spüren - denn Graz ist dann im Schienenersatzverkehr-Modus.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation und unterwegs mit dem Fahrplankoordinator der Graz Linien.
Bernd Fiedler:
Hallo, mein Name ist Bernd Fiedler.
Ich bin seit knapp drei Jahren Fahrplankoordinator bei den Graz Linien und kümmere mich um Fremdeinflüsse im Liniennetz - und deren Auswirkungen bzw. deren Kompensation für unsere Fahrgäste.
Simone Koren-Wallis:
Es ist ein schöner Frühlingstag, wir spazieren gerade Richtung Annenstraße - Ecke Vorbeckgasse.
Ab Mai wird es hier richtig rund gehen.
Bernd, wir gehen gerade auf die Baustelle zu - was passiert hier genau?
Bernd Fiedler:
Am 24. Mai beginnt der Anschluss der Innenstadtentlastungsstrecke - also der Neutorlinie - an die Annenstraße.
Das ist ein sehr komplexes Projekt, das eine lange Bauzeit erfordert - und leider auch starke Einschränkungen im Straßenbahnbetrieb.
Simone Koren-Wallis:
Ich bin selbst Straßenbahnfahrerin - mit der Linie 7 fahre ich täglich von Wetzelsdorf ins Rathaus.
Was kommt da auf uns zu? Ich versuche, es mit Fassung zu tragen.
Bernd Fiedler:
Für rund drei Monate wird keine Straßenbahn durch die Annenstraße fahren.
Auch der Busverkehr ist nur eingeschränkt möglich - vor allem wegen der Baustelle in der Vorbeckgasse.
Simone Koren-Wallis:
Die Gleise müssen ja angebunden werden, damit die Straßenbahn später auch dort fahren kann.
Gerade fährt eine BIM im Hintergrund - perfekte Kulisse für uns.
Ich muss gestehen: Als ich gehört habe, dass drei Monate lang keine Straßenbahn fährt, habe ich schon kurz geschluckt.
Wie ist das für dich - du koordinierst ja das Ganze?
Bernd Fiedler:
Das Ganze hat vor etwa einem Jahr begonnen - mit der Info unserer Gleisbauabteilung, was gemacht werden muss und wie lange es dauert.
Dann haben wir mit der groben Planung begonnen.
Am Ende steht jetzt ein Schienenersatzverkehr über drei Monate - weil im Zuge der Neutor-Anbindung auch andere Projekte gleich mit umgesetzt werden.
Das macht Sinn - aber es macht die Aufgabe natürlich deutlich komplexer.
Simone Koren-Wallis:
Kannst du uns einen Einblick geben, wie man so einen Fahrplan überhaupt koordiniert, wenn gleich vier Linien - die 1, 4, 6 und 7 - betroffen sind?
Bernd Fiedler:
Zuerst klärt man: Was macht der Gleisbau? Wann? Welche Sperren sind notwendig?
Dann schaut man: Welche Strecken bleiben übrig? Welche Fahrzeuge stehen zur Verfügung?
Was muss ich leisten, um die Straßenbahn halbwegs zu ersetzen?
Dann beginnt die Suche nach Ressourcen, Strecken, Alternativen - und man versucht, eine grobe Planung zu erstellen und den Bedarf zu ermitteln.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Busse braucht man, um das zu kompensieren? Kann man das überschlagsmäßig sagen?
Bernd Fiedler:
Mehr, als wir haben.
Simone Koren-Wallis:
Kann man da nicht einfach Busse zukaufen?
Bernd Fiedler:
Doch - wir kaufen Leistungen zu.
Aber kein Busunternehmen hat dutzende Fahrzeuge auf Vorrat, nur für den Fall einer Großbaustelle.
Wir als Graz Linien sind im Großraum Graz das einzige Unternehmen mit Gelenksbussen.
Wir jonglieren also mit unseren eigenen Bussen und kaufen zusätzliche Leistungen zu, um den Schienenersatzverkehr abdecken zu können.
Simone Koren-Wallis:
Puh, sag ich da nur. Du grinst noch?
Bernd Fiedler:
Ja - es war eine echte Herausforderung.
Ich kann sagen: Wir haben alles an Leistungen in Graz gekauft, was zu kaufen war.
Simone Koren-Wallis:
Die Annenstraße ist ja teilweise nicht befahrbar - auch für Busse.
Wie fährt der Ersatzverkehr dann? Es können ja nicht alle Haltestellen angefahren werden.
Bernd Fiedler:
Genau.
Durch die Sperre der Vorbeckgasse und der Annenstraße müssen wir mit dem Bus über den Griesplatz und die Elisabethinergasse ausweichen - und erst später wieder in die Annenstraße einbiegen.
Das bedeutet: Die Haltestellen Südtiroler Platz und Hauptplatz können vom Schienenersatzverkehr nicht bedient werden.
Zusätzlich erneuern wir die Gleise in der Unterführung beim Hauptbahnhof - auch die ist für einen Zeitraum nicht befahrbar.
Wir fahren also oben herum über den Hauptbahnhof.
Und durch die Arbeiten an der Remise 3 - Ost- und Westanbindung - können wir auch die Eggenberger Straße stadtauswärts nicht bedienen.
Simone Koren-Wallis:
Das kommt also auch noch dazu - die Remise wird gleichzeitig mitgemacht?
Bernd Fiedler:
Genau.
Im Zuge der Annenstraßen-Anbindung werden mehrere Projekte umgesetzt:
- Gleiserneuerung in der Unterführung am Hauptbahnhof
- Anbindung der Remise 3 (Ost- und Westseite)
- Und in den Sommerferien: Sanierung des Gleiskreuzes Asperngasse - das ist stark frequentiert und mittlerweile sanierungsbedürftig.
Simone Koren-Wallis:
Ich muss gerade lachen - ich habe noch nie so viele Straßenbahnen in so kurzer Zeit vorbeifahren sehen.
Hast du das heute organisiert?
Bernd Fiedler:
Es sind vier Linien - darunter die Linie 7 mit einem 5-Minuten-Intervall.
Die anderen fahren im 7- bis 8-Minuten-Takt.
Die Annenstraße ist stark frequentiert.
Simone Koren-Wallis:
Bauarbeiten im Sommer - klar, weil Schüler:innen nicht zur Schule müssen.
Aber gleichzeitig sind auch Tourist:innen unterwegs, die in die Innenstadt wollen.
Bekommst du viel - ich nenne es mal freundlich - Feedback von Fahrgästen, die sich beschweren?
Bernd Fiedler:
Ja, eine Baustelle bringt natürlich vor allem dann Rückmeldungen, wenn sie für Fahrgäste direkt spürbar ist.
Und klar - vier Straßenbahnlinien mit Bussen zu ersetzen, ist extrem schwierig.
Eigentlich müsste alle paar Minuten ein Bus fahren, um das Passagieraufkommen der Straßenbahn abzufedern.
Deshalb unser Appell in diesem Jahr:
Bitte, wenn möglich, Alternativstrecken nutzen, um die Situation am Hauptbahnhof zu entlasten.
Natürlich gibt es auch kritische Stimmen - das bleibt nicht aus und ist verständlich.
Aber ich muss sagen: Die Grazer:innen nehmen es erstaunlich gelassen.
Simone Koren-Wallis:
Wir stehen jetzt direkt an der Kreuzung, die schon länger gesperrt ist.
Die Schienen sind soweit fertig, damit sie in die Annenstraße eingeflochten werden können, oder?
Bernd Fiedler:
Genau.
Der Gleisbau bis zur Annenstraße ist abgeschlossen.
Jetzt folgt die Anbindung mit der entsprechenden Weichensituation.
Das Gleisbett wird leicht verlegt, damit die Kurvenradien optimal passen.
Und es ist sehr aufwendig - man muss tief graben, alle Leitungsträger müssen mit rein.
Denn das Ziel ist, hier für die nächsten 10 bis 15 Jahre nicht mehr eingreifen zu müssen.
Deshalb wird gleich alles mitgemacht, was möglich ist.
Simone Koren-Wallis:
Also man hat wirklich vorgedacht und gesagt: Wenn wir schon aufreißen, dann gleich alles mitmachen.
Bernd Fiedler:
Genau.
Es ist sicher nicht die Prämisse der Graz Linien, die Hauptverkehrsverbindung alle zwei Jahre wieder aufzureißen und zu sperren.
Simone Koren-Wallis:
Busse können ja nicht ganz so schnell fahren wie Straßenbahnen.
Muss man dann auch mehr Zeit einplanen, wenn man von A nach B möchte?
Bernd Fiedler:
Definitiv.
Die Strecke ist länger - und wir fahren im normalen Individualverkehr mit.
Das ist ein Unterschied zur Straßenbahn, die in der Annenstraße, am Südtiroler Platz oder Hauptplatz auf eigenen Gleisen fährt.
Das bedeutet:
Mehr Fahrzeuge, mehr Fahrzeit - und für unsere Fahrgäste leider auch mehr Zeit unterwegs.
Deshalb: Bitte um Geduld und starke Nerven.
Simone Koren-Wallis:
Es ist nun mal so - damit wir danach viel besser fahren können.
Bernd Fiedler:
Genau.
Was die Situation zusätzlich erschwert:
In den sechs Wochen vor den Sommerferien ist auch die Peter-Tunner-Gasse wegen einer ÖBB-Baustelle gesperrt.
Das heißt:
Die Eggenberger Straße, unsere Hauptausweichroute, wird stark belastet.
Das führt zu Staus - und kostet uns und unseren Fahrgästen wieder zusätzliche Zeit.
Simone Koren-Wallis:
Puh ... Du grinst noch, ich auch.
Schauen wir mal, wie es wird - aber es ist zumindest alles gut geplant.
Bernd Fiedler:
Ja - und nochmal unsere Bitte:
Wenn möglich, Alternativstrecken nutzen.
Wer zum Beispiel aus dem Süden mit der S-Bahn kommt und in die Innenstadt möchte:
Schon in Puntigam aussteigen und dort auf die Straßenbahn umsteigen.
Je weniger Fahrgäste am Hauptbahnhof ankommen, desto besser für die gesamte Verkehrssituation.
Simone Koren-Wallis:
Du hast die Remise Alte Poststraße schon erwähnt - auch die wird umgebaut.
Und das zieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich.
Bernd Fiedler:
Ja, durch den Umbau der Remise 3 können wir ab dem 24. Mai keine Fahrzeuge mehr von dort ins Liniennetz schicken.
Sie ist während der Bauzeit vom Netz abgeschnitten.
Das heißt:
Wir bedienen das gesamte Straßenbahnnetz nur noch mit Fahrzeugen aus der Remise 2 in der Steyrergasse.
Und das hat natürlich Auswirkungen auf den gesamten Fahrplan.
Simone Koren-Wallis:
Was heißt das konkret - betrifft das wirklich alle Grazer:innen?
Bernd Fiedler:
Ja, es betrifft alle.
Ein paar Beispiele:
- Die Linien 4 und 7 werden kombiniert - sie fahren zwischen St. Leonhard und Liebenau/Murpark.
- Die Linien 5 und 6 werden ebenfalls kombiniert - zwischen St. Peter und Puntigam.
- Die Linie 5 fährt von Andritz nur noch bis zum Jakominiplatz.
- Die Linie 3 bleibt als einzige unverändert - sie fährt von der Krenngasse nach Andritz, und zwar Montag bis Sonntag, von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss.
- Die Linie 1 wird verkürzt und fährt von Mariatrost nur noch bis zum Jakominiplatz.
🎵 Stadt Graz Jingle / Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge geht es um 80 Jahre Kriegsende - wir sprechen über die Nachkriegszeit und den Wiederaufbau in Graz, gemeinsam mit dem Graz Museum.
Wir hören uns - ich freu mich!
Folge 69: "Was bleibt, wenn wir gehen?" - Ein Einblick in die Grazer Feuerhalle
Feuerbestattung wird immer beliebter! Aber was passiert eigentlich dabei genau?
Wir sprechen mit den Menschen, die Tag für Tag den letzten Weg begleiten, über Mythen rund um Asche und Verwechslungen und moderne Bestattungskultur! Gerald Bauer und Heinrich Mörth von der Grazer Bestattung gewähren einen Einblick in die Grazer Feuerhalle und ins Krematorium.
🎵 Stadt Graz Jingle / Simone Koren-Wallis:
Feuerbestattung wird immer beliebter - aber was passiert dabei eigentlich genau?
Wir sprechen heute mit den Menschen, die Tag für Tag den letzten Weg begleiten - über Mythen, moderne Bestattungskultur und persönliche Erfahrungen.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation und zu Gast bei Gerald Bauer und Heinrich Mörth.
Gerald Bauer:
Hallo, mein Name ist Gerald Bauer.
Ich bin seit 2019 Betriebsleiter der Grazer Bestattung am Urnenfriedhof und unter anderem zuständig für das Krematorium Graz.
Heinrich Mörth:
Hallo, ich heiße Heinrich Mörth.
Ich bin seit 2005 bei der Grazer Bestattung tätig und für die gesamte Anlage sowie die Kremation verantwortlich.
Simone Koren-Wallis:
Ostern steht vor der Tür - und zum Leben gehört auch der Tod.
Deshalb bin ich heute direkt in der Feuerhalle in Graz.
Eine Frage brennt mir seit der Anfahrt auf der Zunge:
Gerald, wie lange machst du das schon?
Gerald Bauer:
Ich bin seit dem Jahr 2000 bei der Grazer Bestattung.
Ich habe im Begräbnisdienst und Abholdienst begonnen und bin 2019 in die Verwaltung des Urnenfriedhofs und Krematoriums gewechselt.
Simone Koren-Wallis:
Warum dieser Weg?
Gerald Bauer:
Für mich ist das kein Beruf, sondern eine Berufung.
Vor meiner Zeit bei der Bestattung war ich sieben Jahre bei der Rettung - auch dort kommt man oft mit dem Thema Tod in Berührung.
Ich hatte den Wunsch, weiterhin in diesem Bereich tätig zu sein - vor allem, um Menschen in ihrer Trauer zu begleiten.
Mein Ziel ist es, Hinterbliebenen in den ersten Momenten der Trauer zu helfen - bei der Verabschiedung und der Beisetzung.
Denn: Bei uns gibt es kein „Replay". Es muss beim ersten Mal passen.
Simone Koren-Wallis:
Wir stehen jetzt direkt in der Feuerhalle.
Für alle, die noch nie hier waren - wie sieht es hier aus?
Gerald Bauer:
Wir befinden uns im Hauptbereich der Verabschiedung.
Es gibt neun Aufbahrungskojen mit verschiedenen Varianten - von schlicht bis exklusiv.
Seit 2005 bieten wir auch familiäre Verabschiedungen in einem eigenen Raum für bis zu zwölf Personen an.
Das wird gerne angenommen - entweder von kleinen Familien oder von großen, die sich vor der öffentlichen Trauerfeier zurückziehen möchten.
Die große Verabschiedung findet dann im Zeremoniensaal statt - mit bis zu 150 Trauergästen.
Simone Koren-Wallis:
Ich muss gestehen: Ich kann mit dem Tod schwer umgehen.
Für mich ist das immer ein mulmiges Gefühl.
Ist der Tod für dich zur Normalität geworden?
Gerald Bauer:
Ja, in gewisser Weise schon.
Aber als Bestatter darf man sich nie fragen: „Warum?"
Man muss professionell auftreten und den Trauernden helfen - besonders in den ersten Tagen, wenn die Trauer am größten ist.
Natürlich gibt es Situationen, die einen berühren - etwa, wenn Kinder betroffen sind.
Aber man muss in dem Moment funktionieren und alles abnehmen, was möglich ist.
Simone Koren-Wallis:
Wir sind jetzt im hinteren Bereich - bei der Anlieferung.
Was passiert hier?
Gerald Bauer:
Hier werden die Verstorbenen ins Krematorium gebracht - nicht nur von uns, sondern auch von Bestattungsunternehmen aus Graz-Umgebung, der Steiermark, Kärnten und dem Burgenland.
Die Verabschiedung findet meist am Heimatort statt - die Kremation dann bei uns.
Jeder Sarg wird bei der Anlieferung außen und innen kontrolliert - inklusive Beschriftung und Identität des Verstorbenen.
Das ist unser erster Kontrollgang - um Verwechslungen auszuschließen.
Simone Koren-Wallis:
Wird die Feuerbestattung immer beliebter?
Gerald Bauer:
Ja, in Graz liegt der Anteil mittlerweile bei etwa 70 % Feuerbestattung und 30 % Erdbestattung.
Rein rechnerisch ist die Feuerbestattung günstiger - allein das Ausheben eines Erdgrabs kostet rund 1.000 Euro.
Ein Urnengrab ist kleiner und günstiger - auch beim Steinmetz.
Simone Koren-Wallis:
Aber das Trauern bleibt gleich, oder?
Gerald Bauer:
Natürlich.
Ob Urne oder Sarg - das Gesetz macht keinen Unterschied.
Viele entscheiden sich auch aus hygienischen Gründen für die Feuerbestattung.
Simone Koren-Wallis:
Was passiert mit der Urne? Muss sie in die Erde? Darf man sie verstreuen?
Gerald Bauer:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Mit einem gültigen Bescheid vom Magistrat kann man die Urne auch mitnehmen.
Wir arbeiten mit Partnerunternehmen - etwa in Kroatien oder Hamburg - die eine Versenkung im Meer ermöglichen.
Alternativ gibt es Urnenwände oder klassische Erdgräber für die Beisetzung.
Simone Koren-Wallis:
Es wird wärmer - klar, wir nähern uns den Öfen.
Heinz, wie lautet deine Berufsbezeichnung?
Heinrich Mörth:
Ofenwart.
Simone Koren-Wallis:
Wir stehen vor zwei Öfen.
Kannst du uns erklären, wie das hier genau funktioniert?
Heinrich Mörth:
Unsere Öfen sind Elektroöfen.
Sie werden über Heizspiralen auf eine Grundtemperatur von etwa 800 Grad Celsius aufgeheizt.
Sobald der Sarg eingeführt wird, beginnt die Kremation durch Selbstentzündung.
Die Verbrennung wird dann über die Sauerstoffzufuhr geregelt.
Simone Koren-Wallis:
Also 800 Grad - und wie lange dauert das Ganze?
Heinrich Mörth:
Die Kremation startet bei 800 Grad, erreicht aber Spitzentemperaturen von bis zu 1400 Grad.
Im Durchschnitt dauert eine Kremation etwa eine Stunde und 30 Minuten - je nach Körpergewicht auch länger.
Simone Koren-Wallis:
Es gibt ja viele Mythen.
Zum Beispiel: „Man bekommt gar nicht die Asche des eigenen Angehörigen zurück."
Was ist da dran?
Heinrich Mörth:
Das stimmt nicht.
Es wird immer nur ein Verstorbener pro Kremation verbrannt - unser Ofensystem lässt gar keine Mischungen zu.
Nach jeder Kremation wird der Ofen gereinigt, bevor die nächste beginnt.
Außerdem legen wir bei jeder Kremation einen Schamottstein mit einer einmaligen, fortlaufenden Nummer bei.
Diese Nummer ist im System hinterlegt und garantiert die eindeutige Identifikation.
Der Schamottstein bleibt während des gesamten Prozesses beim Verstorbenen - und kommt auch mit in die Urne.
Simone Koren-Wallis:
Wir stehen jetzt dort, wo die Särge in die Öfen geschoben werden.
Wo kommt die Asche dann heraus?
Heinrich Mörth:
Im unteren Bereich - im sogenannten „Keller" des Ofens.
Dort findet eine Nachverbrennung statt.
Die Asche wird von uns händisch entnommen, abgekühlt und anschließend in die Urne gefüllt.
Simone Koren-Wallis:
Wie viel Asche bleibt von einem Menschen übrig?
Heinrich Mörth:
Man sagt etwa drei bis fünf Kilogramm.
Simone Koren-Wallis:
Und was ist mit Zahngold oder Schmuck?
Heinrich Mörth:
Zahngold hat einen Schmelzpunkt von etwa 900 Grad - bei unseren Temperaturen bis zu 1400 Grad verflüchtigt es sich und vermischt sich mit der Asche.
Es bleibt nichts Verwertbares übrig.
Gerald Bauer:
Man kann es höchstens mikroskopisch nachweisen - aber es ist unmöglich, daraus etwas zu gewinnen.
Simone Koren-Wallis:
Wie sieht es mit der Umwelt aus - immerhin wird ja verbrannt?
Gerald Bauer:
Wir haben eine moderne Filteranlage im Wert von etwa 1,5 Millionen Euro.
Die Abgase - die bei etwa 800 Grad entstehen - werden über einen Pufferspeicher abgekühlt und dann durch die Filteranlage geleitet.
Links im Raum sieht man den Bildschirm, auf dem die Abgasmessungen angezeigt werden.
Diese sind behördlich vorgeschrieben - und alle drei Jahre müssen wir einen umfassenden Bericht beim Umweltamt einreichen.
Simone Koren-Wallis:
Man hört es schon am Klang - wir sind jetzt im Zeremoniensaal, der übrigens denkmalgeschützt ist.
Das ist der große Saal mit der goldenen Tür.
Und ganz zum Schluss - ich bekomme Gänsehaut - schließt sich diese Tür.
Und ihr wisst genau, wie lange das dauert, weil es mit der Musik abgestimmt ist?
Gerald Bauer:
Ja, die Schließzeit beträgt exakt 55 Sekunden.
Wenn ein Musikstück zum Beispiel 2 Minuten 55 dauert, drückt der Kollege draußen bei Minute 2:00 auf „Schließen".
Beim letzten Ton des Musikstücks ist die Tür dann geschlossen.
Simone Koren-Wallis:
Die Zeremonie ist vorbei, das Tor ist geschlossen - und dann geht es um die Beisetzung.
Die findet ja auch hier am Urnenfriedhof statt?
Gerald Bauer:
Sie kann hier stattfinden - muss aber nicht.
Die Hinterbliebenen können die Urne auf allen Friedhöfen in Graz beisetzen lassen.
Mit einem gültigen Bescheid kann die Urne auch mit nach Hause genommen werden.
Aber direkt neben der Feuerhalle befindet sich unser Urnenfriedhof, den wir als Grazer Bestattung betreuen.
Ein bis zwei Tage nach der Verabschiedung ist die Urne verfügbar - und die Beisetzung kann hier stattfinden.
Besonders beliebt ist unsere Naturbestattung:
Wir haben einen künstlich angelegten Wald mit Baumbestattungen und Wiesenbestattungen.
Die biologisch abbaubare Urne wird neben einem Baum beigesetzt - ganz ohne Grabstein, ganz ohne Folgekosten.
Das kostet einmalig etwa 1.500 Euro - und danach entstehen keine weiteren Gebühren wie bei klassischen Grabstätten.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge geht es um den Endspurt für die Neutor-Linie.
Von Mai bis September 2025 werden die Gleise von der Vorbeckstraße an die Annenstraße angebunden.
Alle Infos zum Schienenersatzverkehr - und vieles mehr - in der nächsten Folge.
Wir hören uns - ich freu mich!
Folge 68: Zum Weltwassertag: Alles über unser Grazer Wasser
Am 22. März war Weltwassertag. Deshalb schauen wir uns die Reise des Wassers in Graz genauer an. Unser Grazer Trinkwasser ist rein, unbehandelt und jederzeit verfügbar - aber ist das wirklich so selbstverständlich? Wir werfen mit Kajetan Beutle und Wolfgang Hanusch einen Blick hinter die Kulissen der Wasserwirtschaft und klären, warum Wasser in Graz mehr ist als nur ein Durstlöscher.
🎵 Stadt Graz Jingle / Simone Koren-Wallis:
Am 22. März ist Weltwassertag.
Ziel ist es, auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage für die Menschheit aufmerksam zu machen.
Also schauen wir uns heute genauer an:
Von der Quelle bis zum Wasserhahn - die faszinierende Reise unseres Trinkwassers in Graz.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation und zu Gast bei Kajetan Beutle und Wolfgang Hanusch von der Wasserwirtschaft.
Kajetan Beutle:
Ich bin Kajetan Beutle, Bereichsleiter der Graz Wasserwirtschaft.
Wolfgang Hanusch:
Hallo, ich bin Wolfgang Hanusch, Abteilungsleiter für den Rohrnetzbetrieb Wasser.
Simone Koren-Wallis:
Wir starten mit einem frischen Glas Grazer Wasser - passend zum Weltwassertag, der erst vor wenigen Tagen war.
Meine erste Frage: Wie viel Wasser verbrauchen wir eigentlich?
Wolfgang Hanusch:
Der durchschnittliche Wasserverbrauch liegt bei etwa 130 bis 150 Litern pro Person und Tag.
Hochgerechnet auf alle Grazer:innen sind das rund 55.000 Kubikmeter täglich.
Simone Koren-Wallis:
Ist das zu viel - oder ist da schon alles eingerechnet, wie etwa eine undichte Klospülung?
Wolfgang Hanusch:
Solche „Verluste" sind da natürlich mit eingerechnet.
Wir liegen damit im österreichischen Durchschnitt.
Simone Koren-Wallis:
Diese Zahl klingt riesig - kann man sich das irgendwie bildlich vorstellen?
Wolfgang Hanusch:
Stellen Sie sich ein Fußballfeld vor - das wäre etwa 10 Meter hoch mit Wasser gefüllt.
Das entspricht dem täglichen Wasserverbrauch in Graz.
Kajetan Beutle:
Oder anders gesagt:
Wir fördern 800 Liter pro Sekunde ins Leitungsnetz.
Eine Badewanne fasst etwa 200 Liter - also liefern wir vier Badewannen pro Sekunde.
Das ist eine gigantische Menge.
Simone Koren-Wallis:
Ist Wasser für uns vielleicht schon zu selbstverständlich geworden?
Kajetan Beutle:
Ja, definitiv.
Niemand denkt mehr groß darüber nach - beim Zähneputzen, bei der Klospülung.
Es funktioniert einfach.
Und das ist auch ein Grund zur Freude:
In Graz liefern wir unbehandeltes Wasser - es wird nicht chemisch aufbereitet, sondern kommt so, wie wir es aus dem Boden fördern, direkt zu unseren Kund:innen.
Simone Koren-Wallis:
Aber es wird streng kontrolliert, oder?
Ich habe gelesen, Trinkwasser ist eines der strengsten kontrollierten Lebensmittel.
Kajetan Beutle:
Das stimmt.
Wasser ist ein Lebensmittel - und wird entsprechend überwacht.
Wir haben ein akkreditiertes Wasserlabor, das regelmäßig Proben nimmt und auswertet.
Sollte es einmal ein Problem geben, erfahren wir das sofort.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt bin ich zu Hause, drehe den Wasserhahn auf - und das Wasser kommt.
Aber der Weg dahin ist doch ziemlich lang, oder?
Wolfgang Hanusch:
Ja, da steckt viel Arbeit dahinter.
Wir gewinnen unser Wasser aus drei Wasserwerken: Friesach, Andritz und Feldkirchen.
Zusätzlich bekommen wir Wasser vom Hochschwab, über die Zentralwasserversorgung Hochschwab-Süd - ein eigenes Unternehmen der Holding Graz.
Das Wasser wird aus den Brunnen in große Transportleitungen gepumpt, gelangt in Hochbehälter und wird je nach Wohnlage verteilt.
Wer am Ruckerlberg wohnt, bekommt das Wasser über zwei Pumpstufen - in Mariatrost kommt es früher an.
Simone Koren-Wallis:
Die Rohre habt ihr ja nicht selbst verlegt.
Wie viele Kilometer Leitungen liegen da überhaupt unter Graz?
Kajetan Beutle:
In Graz gibt es rund 900 Kilometer Versorgungsleitungen und etwa 540 Kilometer Hausanschlussleitungen.
Die Versorgungsleitungen sind die großen Rohre in den Straßen - das eigentliche Wasserversorgungsnetz.
Die Hausanschlussleitungen führen von der Hauptleitung direkt ins Haus - dort wird auch der Wasserzähler montiert.
Simone Koren-Wallis:
Das ist ein Wahnsinn, was das Wasser da für einen Weg zurücklegt!
Kajetan Beutle:
Ja - und wir sind stolz darauf, dass wir das sehr gut im Griff haben.
Simone Koren-Wallis:
Und wenn ihr es mal nicht im Griff habt - dann ist das der berühmte „Wasserrohrbruch", oder?
Ich sehe schon deinen Blick - das ist für euch der Super-GAU.
Kajetan Beutle:
Es kommt natürlich auf die Größe an.
In Graz gibt es viele Schotterböden - da sieht man kleine Rohrbrüche oft gar nicht.
Aber wenn Wasser an die Oberfläche tritt und Straßen überflutet, dann ist das ein „Oh Gott"-Moment - ein großer Rohrbruch.
Simone Koren-Wallis:
Wie alt sind die Leitungen? Seit wann gibt es dieses System?
Wolfgang Hanusch:
Das Grazer Rohrnetz hat sich über mehr als 150 Jahre entwickelt.
Es gibt tatsächlich noch einige Leitungen aus dieser Zeit, aber das mittlere Alter liegt derzeit bei etwa 50 Jahren.
Wir haben eine bunte Mischung an Materialien:
Von modernen Kunststoffleitungen wie PVC und PE bis hin zu älteren Grauguss- und Duktilgussleitungen.
Kajetan Beutle:
Ein ganz wichtiger Punkt:
Graz ist bleifrei.
Unser Versorgungsnetz wurde in den letzten Jahren so umgebaut, dass keine einzige Bleileitung mehr im Boden liegt - weder bei den Hauptleitungen noch bei den Hausanschlüssen.
Das ist ein großer Schritt in Richtung Gesundheit und Sicherheit.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt: gesundes Wasser?
Kajetan Beutle:
Genau.
Alle Materialien, die wir verwenden, tragen das Gütesiegel der ÖVGW - also der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach.
Wir sind da qualitativ wirklich sehr gut aufgestellt.
Simone Koren-Wallis:
Die Wasserwirtschaft der Holding Graz versorgt also wirklich alle Grazer:innen?
Wolfgang Hanusch:
Ja, wir haben einen Versorgungsgrad von rund 99 %.
Das heißt: Fast jeder Haushalt in Graz wird direkt mit Trinkwasser beliefert.
Nur vereinzelt gibt es noch Hausbrunnen oder kleinere Anlagen.
Kajetan Beutle:
Zur Infrastruktur gehören auch 23 Hochbehälter, in denen das Wasser zwischengespeichert wird.
Damit wir auch höher gelegene Häuser versorgen können, braucht es zusätzlich eine Vielzahl an Pumpstationen.
So funktioniert die Wasserversorgung in Graz.
Simone Koren-Wallis:
Wie sicher ist diese Versorgung?
Wolfgang Hanusch:
Die gesamte Steuerung läuft über ein Prozessleitsystem.
Das heißt: Pumpen, Hochbehälter und Leitungen werden automatisch überwacht und gesteuert - 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
Natürlich sind wir auch gegen Cyberangriffe abgesichert - das ist heute ein wichtiger Teil der Sicherheitsstrategie.
Simone Koren-Wallis:
Und was passiert im Fall eines Blackouts?
Kajetan Beutle:
Dann tritt ein Notfallplan in Kraft.
Zwei unserer Wasserwerke sind vollständig notstromversorgt.
Wenn es zu einem großflächigen Stromausfall kommt, wird der Wasserverbrauch ohnehin stark zurückgehen - etwa durch den Stillstand der Industrie.
Wir sind überzeugt, dass wir die Grazer Bevölkerung auch in so einem Fall über einen sehr langen Zeitraum sicher versorgen können.
Simone Koren-Wallis:
Und das alles funktioniert natürlich nicht ohne ein starkes Team, oder?
Kajetan Beutle:
Ganz genau.
Ich bin sehr stolz auf unser Team - rund 200 Kolleg:innen, die täglich dafür sorgen, dass die Wasserversorgung funktioniert.
Und nicht nur das: Auch das Abwasser wird zuverlässig abtransportiert, in der Kläranlage gereinigt und dem Naturkreislauf zurückgegeben.
Das ist echte Teamarbeit.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt eine vielleicht naive Frage - aber gibt es eigentlich unendlich Wasser?
Kajetan Beutle:
Als Wasserversorger mit Blick in die Zukunft sage ich: Ja - aber mit Einschränkungen.
Wir beziehen unser Wasser ausschließlich aus Grundwasservorkommen.
Österreich ist ein wasserreiches Land - vor allem durch unsere Berge.
In Graz haben wir mehrere unabhängige Quellen:
- Friesach,
- Andritz,
- Feldkirchen,
- und zusätzlich Wasser aus der Obersteiermark, südlich des Hochschwabgebiets.
Das gibt uns eine gute Versorgungssicherheit.
Aber: In manchen Regionen - auch in der Steiermark - sinken die Grundwasserspiegel, wenn es über längere Zeit keinen Niederschlag gibt.
Seit Oktober/November des Vorjahres hatten wir kaum Regen - das merkt man auch an den Brunnenständen.
Langfristig müssen wir unsere Anlagen anpassen:
Pumpen tiefer hängen, mehr Wasser aus der Obersteiermark holen.
Aber: Dass der Grundwasserkörper komplett versiegt, halte ich für ausgeschlossen.
Simone Koren-Wallis:
Ich glaube, jede:r von uns kann auch etwas tun, um Wasser zu sparen, oder?
Wolfgang Hanusch:
Ja - besonders an heißen Tagen im Mai oder Juni, wenn alle gleichzeitig den Garten bewässern oder Pools füllen, wird es eng.
Mein Appell:
Achtsam mit Wasser umgehen.
Nicht verschwenden.
Vielleicht mal kürzer duschen oder mit dem Gießen warten, wenn Regen angesagt ist.
Kajetan Beutle:
Oft sieht man, dass beim Zähneputzen oder Rasieren das Wasser einfach weiterläuft.
Aber: Von Trinkwasser zu Abwasser sind es nur wenige Zentimeter.
Sobald das Wasser aus dem Hahn kommt und im Waschbecken landet, ist es Abwasser - und muss aufwendig gereinigt werden.
Das ist, als würde man ein hochwertiges Lebensmittel einfach wegwerfen.
Und das sollte man nicht tun.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
So wie man Wasser zum Leben braucht, gehört zum Leben auch das Sterben dazu.
Deshalb kommt die nächste Folge - kurz vor Ostern - aus der Grazer Feuerhalle.
Wir hören uns - ich freu mich!
Folge 67: Wie die Stadt Graz ihre Bürger:innen informiert
Zum 50. Geburtstag der BIG, der Bürger:inneninformation Graz, der offiziellen Zeitung der Stadt Graz, werfen wir mit Max Mazelle, dem Leiter der Abteilung für Kommunikation, einen Blick hinter die Kulissen: wie die Stadt Graz ihre Bürger:innen informiert - von Print über Podcast bis hin zu Online und Social Media!
🎵 Stadt Graz Jingle / Simone Koren-Wallis:
Wie werdet ihr eigentlich von der Stadt Graz informiert?
In dieser Folge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Öffentlichkeitsarbeit - von Print über Podcast bis hin zu Online und Social Media.
Denn: Die BIG, die offizielle Zeitung der Stadt Graz, wird 50 Jahre alt.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation - und mein Gast ist Max Mazelle.
Max Mazelle:
Hallo, mein Name ist Max Mazelle.
Ich leite die Abteilung für Kommunikation der Stadt Graz.
Unsere Abteilung steht auf drei Säulen:
- Öffentlichkeitsarbeit - hier geben wir die Eigenmedien der Stadt heraus,
- Kommunikationsmanagement - zuständig für städtisches Campaigning,
- und das Referat Protokoll - unser „Hollywood-Bereich", mit Ehrungen, Auszeichnungen und Empfängen.
Simone Koren-Wallis:
Lieber Max, Happy Birthday - aber nicht dir, sondern der BIG!
Max Mazelle:
Danke - stellvertretend für alle, die an der BIG mitarbeiten.
Die BIG - das steht für Bürger:innen-Information Graz - feiert im April ihr 50-jähriges Jubiläum.
Das ist schon etwas Besonderes.
Simone Koren-Wallis:
Ein halbes Jahrhundert - das ist wirklich beeindruckend.
Gibt's ein paar Highlights oder „Schmankerl" aus der BIG-Geschichte, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Max Mazelle:
Ich bin Jahrgang '81 - also nicht ganz von Anfang an dabei.
Aber bei der Recherche haben wir uns viele Titelseiten angeschaut.
Da gibt's natürlich positive wie auch traurige Ereignisse.
Im Mittelpunkt stehen oft Themen, die die Lebensqualität in Graz verbessern - etwa Bauprojekte, kulturelle Highlights, wirtschaftliche Entwicklungen oder große Events.
Aber auch einschneidende Ereignisse wurden thematisiert - wie etwa die Amokfahrt in Graz.
Die BIG bildet eben das ganze Spektrum des Stadtlebens ab.
Simone Koren-Wallis:
Alle Grazer:innen kennen sie - die BIG kommt immer zu Monatsbeginn kostenlos in jeden Haushalt.
Warum ist das so wichtig?
Max Mazelle:
Die Stadt Graz bietet viele Services, Dienstleistungen und Angebote - aber sie bringen nichts, wenn niemand davon weiß.
Deshalb ist es unsere Aufgabe, die Menschen aktiv zu informieren:
Was gibt es Neues? Was kann ich wo nutzen?
Dafür haben wir eine breite Medienlandschaft:
- Print - wie die BIG,
- Online - über unsere Website,
- Audio - wie diesen Podcast,
- Social Media,
- und Info-Screens in Bus und Bim.
So erreichen wir unterschiedliche Zielgruppen - mit unterschiedlichen Bedürfnissen.
Simone Koren-Wallis:
Und die BIG ist da euer Print-Flaggschiff?
Max Mazelle:
Genau.
Mit einer Auflage von rund 150.000 Stück decken wir fast alle Haushalte in Graz ab.
Und die BIG hat eine hohe Verweildauer - sie bleibt oft über eine Woche im Haushalt.
Aber: Nicht alle sind Print-affin.
Deshalb bespielen wir auch andere Kanäle - zum Beispiel die Info-Screens in Bus und Bim mit dem Stadttelegramm, das wir redaktionell betreuen.
Oder Social Media - für alle, die lieber am Handy lesen.
Oder eben Podcasts - für alle, die lieber hören.
Das Tolle am Podcast-Format ist ja, dass man tiefer in Themen eintauchen kann - 15 bis 20 Minuten für ein Fachthema, das ist schon etwas Besonderes.
Simone Koren-Wallis:
Ich bin jetzt seit vier Jahren bei der Stadt - und ich habe in dieser Zeit so viel gelernt.
Weil man oft gar nicht weiß, was die Stadt alles macht.
Ist das auch euer Ziel - zu zeigen: „Schaut mal her, das alles passiert für euch"?
Max Mazelle:
Unser Ziel ist nicht Eigenpromotion - also nicht, dass die Stadt Graz sagt: „Schaut her, was wir alles machen."
Es geht nicht um Selbstzweck.
Wenn die Stadt Ressourcen - sei es Zeit, Geld oder Personal - in ein Projekt, ein Service oder eine Dienstleistung investiert, dann ist dieses Angebot erst dann erfolgreich, wenn es bei den Menschen ankommt und genutzt wird.
Ob es eine neue Schule ist, eine geförderte Kulturveranstaltung oder ein Ausbildungsangebot in den geriatrischen Gesundheitszentren - all das muss kommuniziert werden.
Denn das beste Projekt bringt nichts, wenn es in der Schublade verstaubt.
Deshalb denken wir bei jedem Projekt auch die Kommunikationskomponente mit.
Und wir haben das Glück, dass die Stadt Graz für alle Zielgruppen etwas bietet:
Für ältere Menschen, für Jugendliche, für Menschen mit Migrationsgeschichte, für Familien - für alle Lebenslagen.
Unsere Aufgabe ist es, zu überlegen:
Welcher Kanal passt zu welchem Inhalt?
Manchmal gehen wir sogar noch einen Schritt weiter - etwa bei Themen, die besondere Aufmerksamkeit brauchen:
- Barrierefreiheit,
- Mehrsprachigkeit,
- Lesbarkeit (Schriftgröße, Zeilenabstand).
Das können wir nicht bei jedem Thema umsetzen - aber bei bestimmten Inhalten ist es uns besonders wichtig, die Informationen so zugänglich wie möglich zu machen.
Simone Koren-Wallis:
Und jetzt musst du uns noch loben - dein Team!
Ich glaube, du kannst wirklich stolz sein.
Max Mazelle:
Absolut - ein Weltklasse-Team.
Ein sehr flexibles Team mit einem der spannendsten Aufgabenbereiche im Magistrat.
Die Themen sind unglaublich facettenreich - und das verlangt auch Flexibilität.
Jede:r hat seinen Tagesplan, aber dann kommt ein externes Ereignis, ein neues Thema - und wir müssen schnell reagieren und anpassen.
Aber: Wir sind nicht nur als Abteilung für Kommunikation stark - sondern auch im Zusammenspiel mit allen Dienststellen und den politischen Büros.
Gerade im Bereich Pressearbeit ist das Zusammenspiel entscheidend - und das funktioniert sehr gut.
Kommunikation ist nicht nur Medienarbeit - sondern auch zwischenmenschlich.
Telefonate, Webex-Meetings, E-Mails - all das gehört zur Vorbereitung.
Und ich glaube, das meistern wir gemeinsam sehr gut.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt bekomme ich sicher von allen einen Kaffee spendiert.
Happy 50 - darf ich zu dir sagen, obwohl du es noch nicht bist.
Wie wird gefeiert?
Max Mazelle:
Die große Jubiläumsausgabe erscheint im April.
Wir gestalten einen besonderen Mantel - also einen Umschlag - mit ausgewählten Titelseiten und Highlights aus 50 Jahren BIG.
Das wird ein buntes Bild der Stadtgeschichte.
Und wir möchten uns auch bedanken - bei den Kolleg:innen, bei den Dienstleistern, bei den Verteiler:innen, die oft schon in aller Früh unterwegs sind, damit die BIG zuverlässig in jedem Haushalt landet.
Vielleicht keine große Feier - aber ein kleines Dankeschön für alle, die den BIG-Prozess möglich machen.
Simone Koren-Wallis:
Und ein riesiges Dankeschön an euch da draußen - dass ihr die BIG jeden Monat lest.
Denn ohne euch - die Leser:innen - wäre eine Zeitung nichts.
Ihr macht möglich, dass die BIG schon 50 Jahre alt ist.
Max Mazelle:
Und neben der BIG möchte ich noch auf eine ganz wichtige Informationsquelle hinweisen:
Unsere Website graz.at.
Sie ist ein echter Informations-Hub für die Stadt Graz - mit aktuellen News, Serviceinfos, Veranstaltungshinweisen, Infos zu den Dienststellen und vielem mehr.
Deshalb ist es wichtig, dass unsere Informationsverteilung auf mehreren Säulen steht:
- Print (wie die BIG),
- Digital (graz.at),
- Social Media,
- Audioformate (wie dieser Podcast),
- Info-Screens in Bus und Bim.
So erreichen wir möglichst viele Menschen - auf möglichst vielen Wegen.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Beim nächsten Mal geht's ums Grazer Wasser.
Woher kommt es? Wie viel verbrauchen wir? Und wie können wir Wasser sparen?
Alles rund um den Weltwassertag - in der nächsten Folge.
Wir hören uns - ich freu mich!
Folge 66: Kinder- und Jugendstadt Graz
Mitreden. Mitgestalten. Mitfeiern. Graz gibt Kindern und Jugendlichen eine Stimme. Ob Spielstraßen, coole Workshops oder Partys ohne Eltern: die Kinder- und Jugendstadt bringt frischen Wind in die Landeshauptstadt. Wie das alles funktioniert und welche Highlights es gibt, erzählt Nadine Aichholzer vom Amt für Jugend und Familie.
🎵 Stadt Graz Jingle / Simone Koren-Wallis:
In Graz leben rund 50.000 Kinder und Jugendliche.
Deshalb sehen wir unsere Stadt heute einmal durch junge Augen - und sprechen über Spielstraßen, Youth Clubbings und Co.
Willkommen in der Kinder- und Jugendstadt Graz.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation - und unterwegs mit Nadine Aichholzer.
Nadine Aichholzer:
Hallo, ich bin Nadine Aichholzer und Koordinatorin der Kinder- und Jugendstadt Graz.
Simone Koren-Wallis:
Wir sind heute im Augarten - dort, wo Kinder und Jugendliche unterwegs sind.
Nadine, „Kinder- und Jugendstadt" klingt schon selbsterklärend - aber erklär uns bitte trotzdem, was genau dahintersteckt.
Nadine Aichholzer:
Die Kinder- und Jugendstadt ist ein Projekt, das vom Gemeinderat beschlossen wurde.
Die Grundidee entstand nach einer Studie, die gezeigt hat, wie stark die Covid-Pandemie Familien belastet hat.
Mit der Kinder- und Jugendstadt wollen wir dem entgegenwirken - und mittlerweile wissen wir:
Es steckt noch viel mehr Potenzial darin.
Wir setzen Beteiligungsprojekte um, bei denen Kinder und Jugendliche mitreden können - und ihre Wünsche auch tatsächlich umgesetzt werden.
Simone Koren-Wallis:
Du bist ja selbst noch jung - nicht mehr ganz jugendlich, aber jung.
Und du leitest das Projekt seit zwei Jahren?
Nadine Aichholzer:
Genau - ich habe im Herbst 2022 begonnen und darf die Kinder- und Jugendstadt bis 2027 koordinieren.
Simone Koren-Wallis:
Erzähl uns ein bisschen von den Projekten - was ist da alles dabei?
Nadine Aichholzer:
Ganz unterschiedlich!
Uns war wichtig, zuerst die Kinder und Jugendlichen zu fragen, was sie eigentlich wollen.
Deshalb haben wir zwei große Befragungen durchgeführt - eine für Kinder, eine für Jugendliche - mit insgesamt fast 3.000 Rückmeldungen.
Daraus sind viele Projekte entstanden:
- Spielstraßen: Einmal im Monat sperren wir ein Straßenstück, damit Kinder dort frei und sicher spielen können - mit Spielmaterialien vor Ort.
- Schwimmkurse für Kindergartenkinder: Weil wir erfahren haben, dass viele noch nicht schwimmen können - und das ist wichtig.
- Open Atelier: Ein offenes Kreativangebot für Jugendliche - dreimal pro Woche kostenlose Workshops von Nähen bis Acrylmalerei.
- Pumptrack im Sommer: Für alle, die gerne Rad fahren und sich austoben wollen.
- Sportangebote: Weil Bewegung gerade für Jugendliche ein großes Thema ist.
- Jugendzentren: Wir unterstützen die bestehenden Einrichtungen in Graz und machen sie über Instagram bekannter - denn sie sind tolle Orte für junge Menschen.
Dort kann man chillen, Freunde treffen, kochen, Workshops besuchen, neue Instrumente ausprobieren, PlayStation spielen - einfach vieles erleben.
Simone Koren-Wallis:
Und ein großes Thema ist natürlich auch Party, oder?
Nadine Aichholzer:
Ja - und dafür haben wir das Youth Clubbing.
Das ist für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, die noch nicht in Lokale gehen dürfen.
Es findet einmal im Monat im Explosiv statt - mit DJs, Tanz und alkoholfreien Getränken zu jugendgerechten Preisen.
Und ganz wichtig: Kein Alkohol, kein Tabak, keine Drogen - das wird streng kontrolliert.
Simone Koren-Wallis:
Wo findet man alle diese Veranstaltungen?
Nadine Aichholzer:
Am einfachsten unter graz.at/meineStadt - dort ist alles gesammelt.
Für Jugendliche ist unser Instagram-Kanal besonders spannend:
👉 @junge_stadtgraz
Simone Koren-Wallis:
Die Jugend kennt dich ja wahrscheinlich - also auch, wenn man jetzt nur deine Stimme hört. Aber die Jugend kennt dich eben von Instagram. Wo würdest du sagen, wo geht's da hin? In welche Richtung entwickelt sich das für die Jugendlichen?
Nadine Aichholzer:
Da wollen wir hauptsächlich Projekte vorstellen, die wir machen, aber auch solche, die sonst in der ganzen Stadt passieren - auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, also in dem Referat, in dem ich angesiedelt bin. Da möchten wir ganz viel zeigen. Zusätzlich wollen wir auch ein bisschen witzigen Content machen, damit der Kanal interessant bleibt.
Wir möchten mit dem Kanal aber auch ein Sprachrohr für Jugendliche sein. Das heißt: Wenn sie sich etwas wünschen oder irgendwo unsicher sind, können sie sich bei uns melden. Ich beantworte ihre Fragen natürlich auch gerne - die, die sie uns eben über Instagram schicken.
Simone Koren-Wallis:
Was sind das zum Beispiel für Fragen?
Nadine Aichholzer:
Ganz unterschiedlich. Das fängt an bei „Was kann ich am Wochenende unternehmen?" bis hin zu „Ich bin gerade in einer schwierigen Lebenssituation, kann vielleicht nicht zu Hause schlafen - wo kann ich mich hinwenden, wo gibt's sichere Orte für mich?" Also wirklich alles von A bis Z, was man sich vorstellen kann.
Simone Koren-Wallis:
Falls jetzt jemand den Kanal noch nicht kennt - wie findet man den?
Nadine Aichholzer:
Einfach bei der Instagram-Suchleiste „junge_stadtgraz" zusammengeschrieben eingeben - und dann ist es schon der erste Kanal, der auftaucht. Natürlich im typischen Stadt-Graz-Blau, also leicht zu finden.
Simone Koren-Wallis:
Was möchtest du gerne für die Stadt Graz umsetzen - für die Kinder und Jugendlichen? Gibt es da etwas, wo du sagst: Das ist mein Ziel, das möchte ich unbedingt machen?
Nadine Aichholzer:
Ein spezielles Projekt, das ich unbedingt umsetzen möchte, gibt es wahrscheinlich gar nicht - einfach weil ich so viele verschiedene Projekte machen darf, die mir richtig Spaß machen.
Was mir wichtig ist: Dass am Ende dieses Projektes - also Mitte 2027 - für die ganze Stadt gilt, dass man bei Entscheidungen immer auch die Brille der Kinder und Jugendlichen aufsetzt. Dass man schaut: Ist das auch für sie gut oder nur für Erwachsene? Und dass Kinder und Jugendliche so viel wie möglich einbezogen werden.
Simone Koren-Wallis:
Und merkst du das auch irgendwie über Feedback, dass das jetzt schon besser läuft und Kinder und Jugendliche mehr einbezogen werden?
Nadine Aichholzer:
Ja, auf jeden Fall. Das merkt man auch in der Stadt. Wir bekommen als Amt ganz oft Anfragen, ob wir Expertinnen und Experten zur Verfügung stellen können, die mit der Kindersicht unterstützen.
Und wir merken auch, dass zum Beispiel die Kinderbürgermeisterin oder der Kinderbürgermeister ganz oft in Projekte der Stadt Graz eingebunden werden. Das ist für mich richtig schön zu sehen - dass Kinder und Jugendliche wirklich ein wichtiges Thema sind in Graz.
Simone Koren-Wallis:
Für mich ist der Zug leider schon abgefahren - aber wie wird man Kinderbürgermeisterin oder Kinderbürgermeister?
Nadine Aichholzer:
Das ist ganz einfach...
Nadine Aichholzer:
Da muss man zuerst einmal Teil des Kinderparlaments sein. Und das geht ganz leicht: Man schreibt einfach eine E-Mail an unseren Kooperationspartner, das Kinderbüro. Dort können Kinder dann ins Kinderparlament eintreten.
Wenn man ein Jahr dabei war, kann man sich als Kinderbürgermeisterin oder Kinderbürgermeister aufstellen lassen. Dann gibt es eine Wahl - die findet einerseits digital in den Schulen statt. Und zusätzlich kommen ganz viele Kinder ins Rathaus, in den Gemeinderatssitzungssaal. Dort findet dann auch vor Ort noch einmal eine Wahl statt.
Aus allen Stimmen wird dann berechnet, wer die Wahl gewonnen hat. Und die gewählte Person ist dann für ein Jahr Kinderbürgermeisterin oder Kinderbürgermeister.
Simone Koren-Wallis:
Du strahlst so dermaßen - kann es sein, dass du diesen Job wirklich total gern machst?
Nadine Aichholzer:
Ja, auf jeden Fall! Es macht so viel Spaß. Vor allem, wenn man bei verschiedenen Projekten die Kinder sieht, die eine Riesengaude haben an dem, was wir machen. Oder wenn man von Jugendlichen hört: „Das ist cool, was ihr da umsetzt!" - „Es ist cool, dass wir ein Graz-Haus haben!"
Das macht mir immer große Freude. Unser Ziel ist es, die Stadt ein bisschen jünger zu machen.
Jingle / Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge feiern wir - und zwar den 50. Geburtstag der BIG, der BürgerInnen-Information Graz, der offiziellen Zeitung der Stadt Graz.
Wir hören uns - ich freu mich!
Folge 65: Unterwegs in Graz mit dem besten Schneepflugfahrer Europas
Unterwegs mit dem besten Schneepflugfahrer Europas und das in der Landeshauptstadt: John Meierhofer von der Holding Graz/Stadtraum. Wobei: was machen er und seine Kolleg:innen, wenn es, so wie in diesem Winter, kaum schneit? Ein Einblick in die Welt des Winterdienstes der Stadt Graz.
Jingle / Intro
Es ist eine Ehre - ich bin heute unterwegs mit dem besten Schneepflugfahrer Europas, und das in Graz!
Wobei: Was macht so jemand eigentlich in einem Winter wie diesem, wenn kaum Schnee liegt?
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation und ich darf heute einsteigen bei John Meierhofer.
John Meierhofer:
Hallo, ich bin der John Meierhofer von der Holding Graz - Stadtraum. Ich arbeite im zentralen Kraftfahrdienst, und wir sind zuständig für die Straßenreinigung und den Winterdienst.
Simone Koren-Wallis:
Also man könnte ja fast glauben, dass Frau Holle Graz bis jetzt vergessen hat.
Umso lustiger, dass ich heute mit dem Europameister im Schneeräumen unterwegs bin - mit dem John.
John, erzähl mal: Wie schaut das eigentlich aus, wenn es schneit? Wie läuft dann dein Arbeitstag?
John Meierhofer:
Im Winterdienst beginnen wir um vier Uhr früh und arbeiten bis zwölf Uhr mittags - das sind unsere normalen Dienstzeiten.
Wenn es früher oder später losgeht, bekommen wir eine sogenannte Alarm-SMS. Dann rücken wir zum Stützpunkt aus, holen unser Fahrzeug, machen es einsatzbereit - Schneeketten montieren, Pflug anbringen - und dann fahren wir auf unsere Strecke.
Wir räumen den Schnee, streuen Splitt oder Salz und machen die Straßen wieder verkehrstauglich.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt mal ganz unter uns, gell? Können die Grazer bei Schnee nicht Autofahren?
John Meierhofer:
Es wird spektakulärer, sagen wir mal so, wenn Schnee liegt und es angezuckert ist.
Aber Gott sei Dank geht die meiste Situation gut aus.
Die Obersteirer behaupten das ja immer über uns - aber so schlimm ist es nicht.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, du räumst dann. Wo bekommst du dein Fahrzeug her, wo musst du hin - und dann steigst du ein in deinen Schneepflug und weißt: Heute schiebe ich die Straßen frei.
John Meierhofer:
Unser Stützpunkt ist in der Puchstraße, genauer gesagt in der Hedwig-Katschinka-Straße, wo der Stadtraum stationiert ist.
Dort rücke ich ein, hole den Schlüssel aus dem Schlüsselsafe für mein dienstlich zugewiesenes Fahrzeug - ein großer LKW mit Salzstreuer hinten drauf.
Dann schauen wir nochmal die Wetterprognosen an - meistens merkt man es eh schon am Boden und an den Temperaturen.
Man hat immer die gleiche Strecke, also weiß man schon: In gewissen Ecken ist es kälter.
Dann entscheidet man, ob Schneeketten montiert werden müssen - und das macht man lieber im Depot als draußen auf der Strecke.
Ich bin speziell auf der Platte oben unterwegs.
Dann montiere ich den Schneepflug, lade Salz oder Splitt - und dann geht's los.
Simone Koren-Wallis:
Wie geht's dir eigentlich als Schneepflugfahrer, wenn die Autofahrer schimpfen: „Da ist überhaupt nicht geräumt, da kann man nicht fahren!"
Du kennst das ja - wir sind das Land der Motschgerer. Wie gehst du damit um?
John Meierhofer:
Ja, das geht uns allen ziemlich gleich. Natürlich muss man sich da manchmal beschimpfen lassen.
Aber wir besänftigen die Leute dann meistens mit den gleichen Worten:
Wir können nicht überall gleichzeitig sein.
Wir haben einen Streckenanfang und ein Streckenende - und dazwischen brauchen wir drei bis fünf Stunden.
Da hoffe ich auf den Hausverstand und die Vernunft der Leute, dass sie das verstehen und akzeptieren.
Simone Koren-Wallis:
Und außerdem - es schneit ja auch hinter dem Schneepflug.
Aber heute bin ich nicht mit dir in Schneepflug-Mission unterwegs, sondern wir sammeln Christbäume ein.
John Meierhofer:
Genau - heute machen wir die Christbaumsammelstelle bzw. Christbaumabfuhr.
Simone Koren-Wallis:
Was macht ein Schneepflugfahrer im Sommer - oder wenn es nicht schneit, wie heuer?
John Meierhofer:
Die Skills und Fähigkeiten trainieren und auffrischen - damit man nichts verlernt!
Nein, im Sommer fahren wir Kehrmaschinen, Waschwagen oder Kranwagen.
Ich bin speziell ein Springerfahrer - das heißt, ich habe meine Fixaufgaben mit Kehrmaschinen, Waschwagen oder Kranwagen.
Die Arbeit geht uns nicht aus.
Simone Koren-Wallis:
Es gibt immer etwas zu tun.
Aber ich bin auch mit dir unterwegs, weil du letztes Jahr den Titel „Europameister im Schneepflugfahren" gewonnen hast.
John Meierhofer:
Genau, richtig.
Simone Koren-Wallis:
Erstens: Ich habe gar nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt!
Aber bitte erzähl mal - wie kommt man dazu, wie läuft das ab?
John Meierhofer:
Das kennen tatsächlich viele nicht.
Alle schauen einen zuerst blöd an und sagen: „Du bist Schneepflug-Europameister?"
Es heißt offiziell „Schneepflug-Geschicklichkeitsfahren".
Und wenn man denkt: Im September Schneepflugfahren - das geht ja gar nicht.
Aber die Europameisterschaft läuft so: Im Sommer gibt es die Vorentscheidungen.
Ich habe beim internen Bewerb gut abgeschnitten, dann beim Landesentscheid, bei der Staatsmeisterschaft - und schlussendlich bei der Europameisterschaft.
Simone Koren-Wallis:
Wie läuft das dann im September ab?
John Meierhofer:
Es geht um Geschicklichkeit - also darum, wie gut du mit dem Fahrzeug umgehen kannst.
Es zählt die Schnelligkeit und die Präzision - wobei die Präzision mehr zählt.
Man muss zwischen Verkehrshütchen durchfahren, über Rampen drüber, mit dem Pflug Betonfässer schieben.
Dann hat man einen Spieß am Pflug montiert, mit dem man einen Ring aufnehmen muss - also wirklich höchste Präzisionsarbeit.
Und die Zeit zählt natürlich auch - wobei sie relativ ist.
Wenn man z. B. ein Verkehrshütchen umführt, bekommt man gleich 15 bis 30 Sekunden Strafzeit - da ist man schnell raus.
Simone Koren-Wallis:
Und dann - im Winter drauf - vergisst Frau Holle auf Graz.
Ganz ehrlich: Bist du einer, der dann sagt „Hoffentlich schneit's bald", weil du einfach so viel Freude am Schneeräumen hast?
Oder ist dir das wurscht?
John Meierhofer:
Es ist bei uns immer so: Entweder ist eine volle Hütte da - oder es ist überhaupt nichts los.
Eine gesunde Mischung wäre eigentlich ideal, sage ich mal - dass es alle zwei Tage ein bisschen schneit, dann hat man was zu tun, und zwischendurch fährt man die normale Tour.
Aber wenn man im Winterdienst eingeteilt ist, dann muss man sowieso die Strecken abfahren - auch bei Temperaturen rund um den Nullpunkt.
Wie gesagt, ich bin zum Beispiel auf der Platte unterwegs, oder es gibt andere Ecken und „geheime Gegenden", wo nicht alle Leute hinkommen.
Wir fahren zum Beispiel bis auf den Plabutsch rauf, auf den Fürstenstand - das gehört auch zu uns.
Und natürlich hat es am Jakominiplatz 3 Grad plus, aber am Plabutsch oder auf der Platte minus 2 Grad.
Man muss also immer die Tour abfahren und kontrollieren.
Es ist eine schöne Bestätigung, wenn es dann wirklich Schnee gibt, wir mit dem Pflug ausrücken und nachstreuen können.
Simone Koren-Wallis:
Dein Dienst startet um 4 Uhr früh - der Frau Holle ist das aber meistens egal, oder?
Wenn es dann einmal schneit - muss man mittlerweile dazusagen - dann schneit es oft schon lange durch.
Und es ist ganz egal, ob das ein Sonntag oder ein Feiertag ist, oder?
John Meierhofer:
Genau.
Speziell in den Wintermonaten, rund um Weihnachten, wird es spannend.
Da sind wir durchgehend in Bereitschaft - also ich nicht, ich bin einer der jüngeren Kollegen.
Aber speziell die älteren Kollegen sind wirklich vier Wochen im Monat durchgehend in Bereitschaft.
Ich bin nur zwei Wochen im Monat dran - im Wechsel mit meinem Kollegen.
Wenn es dann wirklich hart kommt, gerade zu besinnlichen Zeiten, tut es schon weh - vor allem, wenn man kleine Kinder oder sogar Enkel hat.
Dann geht der Alarmserver los, und man muss weg vom Weihnachtstisch, Schnee räumen und schauen, dass die Leute sicher unterwegs sind und gut nach Hause kommen.
Feiern kann man dann natürlich nicht so wie andere - weil man immer im Hinterkopf hat: Es könnte jederzeit etwas sein.
Also ja - wir sind eigentlich immer einsatzbereit.
Simone Koren-Wallis:
Man muss sich das einmal vorstellen: Bis zu 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den Winterdienst „aktivierbar", wie es so schön heißt - weil man ja auf den Schnee warten muss.
Und bis zu 76 Fahrzeuge sind dann im Einsatz.
Aber das ist noch lange nicht alles, oder?
John Meierhofer:
Nein, da gibt's natürlich neben unserem zentralen Kraftfahrdienst auch die sogenannte „händische Bereitschaft".
Das sind die händischen Partien, die speziell für Fußgängerübergänge, Zebrastreifen, Blindenstreifen usw. zuständig sind - damit dort der Schnee geräumt und gestreut wird.
Mit den großen LKWs - und auch mit den kleineren - kommt man da schwer hin, speziell bei Ampelsäulen oder zwischen Verkehrseinrichtungen.
Da ist dann die händische Partie unterwegs.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es etwas, das dich ärgert, wenn du im Winterdienst unterwegs bist?
Leute, die grantig sind, obwohl du gerade arbeitest?
John Meierhofer:
Ja, genau.
Es gibt natürlich Personen, die null Verständnis haben.
Wenn du mit dem Pflug daherkommst, musst du schauen, dass du die parkenden Autos links und rechts nicht berührst - du kämpfst mit deinem Gerät, musst den Pflug bedienen, LKW fahren - und dann kommt dir jemand entgegen, macht keinen Platz, zeigt keine Rücksicht.
Wenn man dann bergauf stehen bleibt, mit einer Schneewurst vor dem Schild, und nochmal wegfahren muss - ohne etwas kaputt zu machen - ist das echt schwierig.
Oder die Leute regen sich auf, wenn bei den Hauseinfahrten 10 bis 20 Zentimeter Schnee liegen.
Da sage ich immer: Den Schmelzpflug hat man noch nicht erfunden.
Ich kann den Schnee nicht einfach verschwinden lassen - das geht technisch nicht.
Simone Koren-Wallis:
Also würdest du dir wünschen, dass die Leute ein bisschen mehr Rücksicht auf dich und deinen Job nehmen?
John Meierhofer:
Auf jeden Fall.
Das würden sich sicher alle wünschen.
Und wer's nicht glaubt, wie schwer das ist - der kann sich gerne mal ein Bild davon machen.
Dann lassen wir ihn eine Runde fahren.
Simone Koren-Wallis:
Bei dir im Auto - muss man sich das vorstellen wie in einem LKW?
Und rechts sind dann die Bedienelemente, oder wie nennt ihr das?
John Meierhofer:
Genau - das sind so „Strahkastln"...
Simone Koren-Wallis:
Und ein Joystick.
Das heißt: Wenn ihr die Straßen räumt, musst du was alles machen?
John Meierhofer:
Ich muss zuerst schauen, dass hinten Salz rauskommt - also das Strahkastl bedienen.
Damit kann man die Salzmenge einstellen, die Wurfweite, ob mehr links oder rechts gestreut wird.
Ich kann auch eine „Max-Taste" drücken, wenn irgendwo mehr Schnee liegt oder es vereist ist.
Nebenbei muss ich - wenn Schnee liegt - den Pflug mit dem Joystick bedienen.
Wenn ich einen Spitzpflug habe, kann ich die Flügel einzeln steuern.
Simone Koren-Wallis:
Was ist ein Spitzpflug?
John Meierhofer:
Ein Spitzpflug ist - wie der Name sagt - spitz.
Der andere Pflug ist wie ein Schild.
Der Spitzpflug geht vorne zusammen und ist etwas kleiner - räumt meistens nur eine Fahrzeugbreite.
Das Schild räumt links und rechts mehr.
Den Spitzpflug kann man „spitz stellen" oder „V-stellen", also die Flügel nach vorne.
Damit kann man den Schnee besser lenken - ob man ihn links oder rechts ablegen will.
Und den muss ich natürlich auch bedienen.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt: Du musst fahren, den Joystick bedienen, den Pflug steuern - und dann soll noch jemand sagen, Männer sind nicht multitaskingfähig, oder?
John Meierhofer:
Ja, genau so ist es.
Das ist der beste Beweis dafür.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es einen Satz, den du öfter hörst, bei dem du dir denkst: „Na bitte..."?
John Meierhofer:
Ja, natürlich.
Der berühmte Satz: „Die Gemeinde oder das Magistrat schepft nix."
Den hört man fast täglich.
Man braucht nur draußen unterwegs sein in der Stadt - da sieht man genug.
Speziell von meinem Bereich - Stadtraum, Kehrmaschinen, Waschwagen, Kranwagen, Winterdienstfahrzeuge.
Aber im Winterdienst sind wir meistens unterwegs, wenn die Leute noch schlafen - damit sie sicher zur Arbeit kommen.
Jingle / Outro:
In der nächsten Folge stellen wir euch die Kinder- und Jugendstadt genauer vor - mit allen Infos, Tipps für Veranstaltungen und vieles, vieles mehr.
Wir hören uns - ich freu mich!
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 64: Das neue Kinderportal für Krippe, Kindergarten oder Hort
Das neue Kinderportal des Landes Steiermark - eine zentrale Anlaufstelle für alle Familien, die in der Steiermark (und natürlich auch in Graz) einen Betreuungsplatz für ihre Kinder suchen. Egal ob Krippe, Kindergarten oder Hort: Das Portal soll die Suche erleichtern und sicherstellen, dass jedes Kind den passenden Platz bekommt. Gabriele Wilfinger von der Abteilung für Bildung und Integration erklärt, wie das Portal funktioniert, wann Eltern mit einer Rückmeldung rechnen können und was passiert, wenn doch kein Platz verfügbar ist.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Dieses Mal geht es um das neue Kinderportal vom Land Steiermark - betrifft nämlich auch alle Grazer Familien.
Damit soll sichergestellt werden, dass jedes Kind den Betreuungsplatz bekommt, den es braucht.
Die Suche nach diesem Platz soll damit erleichtert werden.
Wir schauen uns das heute genauer an.
Mein Name ist Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation und ich bin zu Gast bei Gabriele Wilfinger.
Gabriele Wilfinger:
Mein Name ist Gabriele Wilfinger, ich arbeite in der Abteilung für Bildung und Integration und leite den Geschäftsbereich Bildungsservice - kurz „Abi-Service" genannt, das wahrscheinlich in Graz eh schon relativ bekannt ist bei Eltern.
Simone Koren-Wallis:
Viele Eltern werden es schon kennen - das Kinderportal, kurz „KIPO", bei euch abgekürzt.
Liebe Gabi, erzähl mal ganz kurz: Was ist das genau?
Gabriele Wilfinger:
KIPO ist das neue Portal vom Land Steiermark, das unser altes, bewährtes System in der Stadt Graz ablöst.
Jetzt können sich Eltern aus der gesamten Steiermark über ein einheitliches System für Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen anmelden.
Man kann sich für die Kinderkrippe, den Kindergarten und den Hort anmelden.
Inkludiert sind auch Kinderhäuser, die es eher in der Steiermark gibt, und alterserweiterte Gruppen - also Gruppen, in denen Krippen- und Kindergartenkinder gemeinsam betreut werden.
Diese Möglichkeiten gibt es für Kinder von 0 bis etwa 14 Jahren - und das alles über dieses neue Portal.
Simone Koren-Wallis:
Wie funktioniert das genau?
Gabriele Wilfinger:
Man steigt über die Webseite des Landes ein - einfach „Kinderportal" eingeben, dann kommt schon die Seite vom Land.
Man klickt drauf und macht eine Registrierung - das ist der erste Schritt.
Man registriert sich mit Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
Dann bekommt man eine Nachricht mit einem Link zur Freischaltung.
Wenn man auf den Link klickt, kommt man direkt ins Vormerkformular.
Dort kann man sich die gewünschten Einrichtungen aussuchen, ansehen und seine persönlichen Daten eingeben, damit die Vormerkung abgesendet und gespeichert wird.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, das mache ich nur einmalig - wenn mein Kind gerade in den Kindergarten kommt? Oder muss ich das jetzt jedes Jahr machen?
Gabriele Wilfinger:
Das macht man nur dann, wenn man eine neue Einrichtung braucht.
Wenn das Kind bereits in der Krippe ist, meldet man sich nicht nochmal für die Krippe an - sondern erst, wenn es drei Jahre alt wird und in den Kindergarten wechseln soll.
Wenn das Kind dann ein Schulkind wird, kann man sich für einen Schülerhort anmelden - je nach Alter.
Kinder, die bereits in Betreuung sind und dort bleiben, müssen nicht neu vorgemerkt werden - die sind schon erfasst.
Es geht nur um neue Kinder, neue Plätze, neue Einrichtungen.
Simone Koren-Wallis:
Und was ist, wenn mein Kind in die Schule kommt und ich eine schulische Tagesbetreuung brauche - also keinen Hort im klassischen Sinn?
Gabriele Wilfinger:
Diese Anmeldung läuft weiterhin über das System der Stadt Graz.
Die Direktorinnen und Direktoren fragen bei der Einschreibung meist schon ab, ob ein Bedarf besteht, und weisen die Eltern darauf hin, dass es auch für die schulische Tagesbetreuung eine Vormerkfrist gibt - die parallel zur Vormerkung über das Land läuft.
Aber da ist das System der Stadt Graz noch im Einsatz.
Auch da unterstützen wir Eltern, wenn sie Probleme haben, ihr Kind für die schulische Tagesbetreuung anzumelden.
Das ist übrigens nur notwendig, wenn man ein sogenanntes „Erstklasskind" hat.
Wenn man einmal im System ist, muss man sich nicht jedes Jahr neu vormerken - nur bei einem Schulwechsel oder beim Übergang von der Volksschule in eine Mittelschule, wenn man weiterhin Tagesbetreuung braucht.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt aber wieder zurück zum KIPO.
Es ist ja vor Kurzem angelaufen - wie lange läuft es noch?
Gabriele Wilfinger:
Es läuft noch bis zum 28. Februar.
Dann wird zumindest das Hauptvormerksportal für die Eltern geschlossen.
Das heißt aber nicht, dass man sich danach nicht mehr vormerken kann - es nennt sich dann „nachträgliche Vormerkung" und ist weiterhin möglich.
Auch die Leiterinnen und Träger sehen, dass sich Eltern nachträglich vorgemerkt haben.
Simone Koren-Wallis:
Gut - ich habe mich angemeldet, mein Kind angemeldet, es möchte in einen bestimmten Kindergarten gehen.
Was bedeutet das jetzt für euch?
Gabriele Wilfinger:
Die Arbeit beginnt dann für alle Träger und Leiterinnen.
Dann startet die Bearbeitungsphase.
Das heißt: Die Eltern müssen nichts mehr tun - aber die Leiterinnen und Träger wählen jetzt die Kinder aus, die sie im nächsten Jahr aufnehmen können.
Im Kindergarten müssen zuerst Pflichtkinder aufgenommen werden.
In der Krippe sind berufstätige Eltern vorrangig.
Die Leiterinnen wissen ungefähr, wie viele Plätze sie im Herbst frei haben - und dementsprechend treffen sie ihre Auswahl.
Sie setzen ein Häkchen: „Ja, nehme ich auf" - oder „Nein, tut mir leid, im Moment kein Platz".
Simone Koren-Wallis:
Und jetzt sind wir beim Thema: „Nein, leider kein Platz."
Was passiert dann?
Gabriele Wilfinger:
Ja, natürlich bleiben immer wieder Kinder übrig - manchmal auch solche, deren Eltern sich früh vormerken, aber erst unterjährig einsteigen möchten, etwa im Februar oder März nächsten Jahres, wenn die Karenz ausläuft.
Da ist es so, dass die Leiterinnen das Jahr im Voraus noch nicht vollständig durchplanen können.
Das heißt: In einem ersten Schritt erhalten diese Eltern möglicherweise eine Absage - weil die Einrichtungen im Herbst zuerst gefüllt werden müssen.
In den Krippen ist es dann so, dass Plätze frei werden, wenn Kinder zwei Jahre alt werden - dann können andere nachrücken.
Eine Absage bedeutet also nicht zwangsläufig, dass man gar keinen Platz bekommt - sondern vielleicht nur nicht in der Wunscheinrichtung oder nicht in den drei angegebenen Einrichtungen, weil diese bereits überlaufen sind.
Es gibt immer wieder Einrichtungen mit besonders vielen Anmeldungen - und andere, wo noch Plätze frei bleiben.
Wir sind im Abi-Service in enger Kooperation mit allen Trägern, die sich nach den Kriterien der Stadt Graz richten.
Diese Kriterien sind allen Trägern, Leiterinnen und auch den meisten Eltern bekannt - und auf unserer Website nachlesbar.
Wenn uns Träger melden, dass sie noch freie Plätze haben, können wir Eltern, die eine Absage erhalten haben, eventuell eine andere Einrichtung anbieten - vielleicht in der Nähe der Arbeitsstelle, bei der Oma oder einfach dort, wo es noch freie Plätze gibt.
Diese Phase dauert erfahrungsgemäß relativ lange, bis sich alles zurechtrüttelt - bis alle Eltern ihren Platz bestätigt haben oder einen neuen gefunden haben.
Simone Koren-Wallis:
Nur nochmal zur Sicherheit: Wenn ich jetzt wissen will, wie lange ich auf eine Zusage warten muss - du hast gesagt, ungefähr im April?
Gabriele Wilfinger:
Genau - das Land hat uns mitgeteilt, dass die Zusagen im April automatisch versendet werden, sobald alle Leiterinnen im Hintergrund die Bearbeitung abgeschlossen haben.
Dann gibt es ein vorgefertigtes Mail - entweder mit einer Zusage oder einer Absage.
Wahrscheinlich wird es auch die Möglichkeit geben, dass im Mail steht, dass man auf der Warteliste bleibt - das klärt das Land gerade noch.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt gibt es vielleicht einige Mamas und Papas, die sagen: „Ich komme mit dem System nicht ganz klar" oder „Ich habe noch Fragen".
Kann man sich da immer an euch wenden - und wenn ja, wohin?
Gabriele Wilfinger:
Immer - man kann sich jederzeit an uns wenden.
Wir bieten Workshops unter dem Titel „Anmeldung leicht gemacht" an.
Wenn man sich online oder telefonisch dafür anmeldet, kann man teilnehmen - die Workshops finden jeden Donnerstag von 9 bis 11 Uhr statt, in der letzten Woche sogar täglich.
Wenn wir merken, dass die Kapazitäten erreicht sind, schieben wir Zusatztermine ein.
Eltern kommen zu uns, wir stellen Laptops bereit - und bei jedem Laptop sitzt eine Betreuerin, die beim Erstellen des Kontos und bei der Vormerkung hilft.
Wir haben auch Unterstützung in anderen Sprachen - auf unserer Website sieht man genau, welche Sprache an welchem Tag verfügbar ist.
Und auch ohne Dolmetsch schaffen wir es meistens, die Vormerkung gemeinsam durchzuführen.
Simone Koren-Wallis:
Und wenn ich sonst irgendeine Frage habe - ihr habt immer ein offenes Ohr?
Gabriele Wilfinger:
Genau - so ist es.
Es gibt unsere Bildungshotline unter der Nummer 7474.
Dort sind die Kolleginnen von 7:30 bis 14:30 Uhr erreichbar und beantworten alle Fragen - zur Vormerkung, aber auch zu anderen Themen rund um Bildung und Betreuung.
Simone Koren-Wallis:
Also egal, welche Frage ich habe - zu welcher Bildungseinrichtung auch immer - ihr seid die richtige Anlaufstelle?
Gabriele Wilfinger:
Genau.
Das Abi-Service ist auch für Kund:innen da, die persönlich mit uns sprechen oder beraten werden möchten.
Bitte einfach einen Termin buchen - entweder selbst online über unsere Website oder über die Hotline 7474.
Die Kolleginnen buchen gerne einen passenden Termin.
So können wir besser koordinieren - und es entstehen keine Wartezeiten.
Simone Koren-Wallis:
Aber falls wirklich der Hut brennt und ich ganz dringend etwas brauche - kann ich auch einfach vorbeikommen?
Gabriele Wilfinger:
Ja - im äußersten Notfall kann man natürlich jederzeit vorbeikommen oder anrufen.
Die Kollegin in der Hotline verbindet dann direkt zu uns und sagt: „Da kommt jemand, da brennt der Hut - könnt ihr helfen?"
Für solche Fälle halten wir uns immer ein kleines Zeitfenster und einen Raum frei - damit wir auch in schwerwiegenden Situationen beraten und unterstützen können.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Ganz, ganz böse Zungen behaupten ja, dass Menschen aus Graz bei Schnee nicht so gut Autofahren können.
Heuer hatten wir zwar noch keinen richtigen Schnee - aber einer fährt nicht nur gut, sondern sorgt auch dafür, dass die Straßen perfekt geräumt sind.
Nächstes Mal geht's um den Schneepflug-Europameister.
Wir hören uns - ich freu mich!
Folge 63: Das Heimwegtelefon der Stadt Graz
Es ist eine Erfolgsgeschichte: Das Heimwegtelefon der Stadt Graz, sozusagen ein kostenloser Begleitservice. Geschulte Mitarbeiter:innen der Ordnungswache sorgen nämlich telefonisch dafür, dass sich die Anrufer:innen am Nachhauseweg sicher und wohlfühlen. Wie viele Anrufe gibt es durchschnittlich? Und wie klingt das Ganze? Das berichten Sicherheitsmanager Gilbert Sandner von der Stadt Graz und Peter Telsnig von der Ordnungswache.
Info 10/2025: das Heimwegtelefon wurde eingestellt!
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Neues Jahr, neue Podcast-Folgen!
Wir starten das Jahr 2025 mit dem Heimweg-Telefon der Stadt Graz.
Was ist das genau, wie funktioniert es - und vieles, vieles mehr.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation.
Meine Gäste: Gilbert Sandner und Peter Telsnig.
Gilbert Sandner:
Mein Name ist Gilbert Sandner, ich leite das Referat Sicherheitsmanagement und Bevölkerungsschutz in der Magistratsdirektion der Stadt Graz.
Peter Telsnig:
Mein Name ist Peter Telsnig, ich bin bei der Ordnungswache der GPS tätig und betreue auch das Heimweg-Telefon.
📞 Telefonat wird nachgestellt:
„Heimweg-Telefon der Ordnungswache Graz. Wir sind für Sie an Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen von 22 bis 3 Uhr erreichbar."
Peter Telsnig:
„Heimweg-Telefon, Sie sprechen mit Peter. Mit wem habe ich die Ehre?"
Simone Koren-Wallis:
„Ja hallo, da ist die Simone. Ich bräuchte jemanden, der mit mir zusammen quasi heimgeht."
Peter Telsnig:
„Sehr gerne. Darf ich fragen, wo Sie sich gerade befinden?"
Simone Koren-Wallis:
„Direkt am Grazer Hauptplatz."
Peter Telsnig:
„Gut. Ist es das erste Mal, dass Sie beim Heimweg-Telefon anrufen?"
Simone Koren-Wallis:
„Ja, das ist das erste Mal - ich kenne mich gar nicht aus."
Peter Telsnig:
„Okay, ich erkläre Ihnen kurz, wie es funktioniert. Wir reden ganz normal miteinander - über alles Mögliche, wenn Sie möchten.
Falls Ihnen irgendwie unwohl ist, bitte sofort unterbrechen - ich kann Ihnen dann sofort helfen und das auch weiterleiten."
Simone Koren-Wallis:
„Okay, alles klar - das heißt, wir reden jetzt einfach miteinander?"
Peter Telsnig:
„Korrekt, ja."
Simone Koren-Wallis:
So klingt es zum Beispiel, wenn man beim Heimweg-Telefon anruft.
Und ich glaube, das Gefühl kennen viele - vor allem wir Frauen.
Es beginnt oft mit einem mulmigen Gefühl in der Bauchgegend, manchmal ist es ein Kribbeln im ganzen Körper, wenn man nachts alleine nach Hause geht.
Man schaut sich öfter um und hofft einfach, dass man schnell und sicher daheim ankommt.
Und genau deshalb gibt es das Heimweg-Telefon.
Gilbert Sandner:
Ja Simone, das Grazer Heimweg-Telefon wurde 2016 ins Leben gerufen.
Es wird von der Ordnungswache des Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice durchgeführt und soll - genau wie du gesagt hast - das subjektive Sicherheitsgefühl stärken.
Mit einem Telefonanruf kommt man mit einem Profi auf der anderen Seite der Leitung ins Gespräch.
Das hebt nicht nur das Sicherheitsgefühl, sondern kann auch potenzielle Angreifer abschrecken - denn jemand bekommt mit, was passiert.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt gibt es das Heimweg-Telefon ja schon einige Jahre.
Kann man sagen, wie viele Anrufe es bisher gegeben hat?
Gilbert Sandner:
Seit der Einführung 2016 gab es mehrere hundert Anrufe.
Wir sprechen von null bis fünf Anrufen pro Wochenende, wenn das Heimweg-Telefon aktiv ist.
Und etwa 90 Prozent dieser Anrufe kommen von Frauen.
Simone Koren-Wallis:
Da sind wir jetzt beim Thema: Das Heimweg-Telefon gibt es nur am Wochenende?
Gilbert Sandner:
Genau - es ist freitags, samstags und vor Feiertagen von 22 bis 3 Uhr im Dienst und wird von der Ordnungswache betreut.
Simone Koren-Wallis:
Peter, das ist also ein Nachtdienst für dich, oder?
Peter Telsnig:
Das ist korrekt - aber ich mache das wirklich sehr gerne.
Man möchte den Bürgerinnen und Bürgern ein gutes Sicherheitsgefühl mitgeben und dafür sorgen, dass sie sicher und glücklich nach Hause kommen.
Simone Koren-Wallis:
Du machst das ja schon länger.
Wie ist das - beschreib mal, wenn plötzlich das Telefon läutet und du weißt, du begleitest jetzt jemanden nach Hause?
Peter Telsnig:
Wichtig ist, dass man sich am Anfang vorstellt und die anrufende Person beruhigt - ihr ein gutes Gefühl gibt.
Sie soll wissen: Sie ist nicht allein.
Da ist jemand auf der anderen Seite der Leitung, der sie begleitet und im Ernstfall sofort helfen kann.
Wir haben dafür ein eigenes Sicherheitskonzept entwickelt - wie man Menschen unterwegs schützen kann oder wo sie Schutz suchen können.
Wir fragen auch immer den genauen Standort ab - damit wir im Ernstfall sofort die Polizei verständigen können, die dann direkt dorthin kommt.
Simone Koren-Wallis:
Ist das schon einmal passiert - oder ist es in den meisten Fällen Gott sei Dank „nur" unter Anführungszeichen ein Gespräch, bei dem du jemanden am Telefon nach Hause begleitest?
Peter Telsnig:
Mir persönlich ist noch kein Ernstfall untergekommen, aber natürlich haben wir schon Tipps gegeben - gerade wenn jemand plötzlich ein mulmiges Gefühl bekommt.
Das passiert meistens dann, wenn man durch schlecht beleuchtete Straßen oder Gassen geht oder wenn andere Personen auftauchen, die ein ungutes Gefühl auslösen.
Simone Koren-Wallis:
Kann sich da eigentlich jeder hinsetzen und das Heimweg-Telefon betreuen - oder seid ihr speziell geschult?
Peter Telsnig:
Wir sind speziell geschult - und die Schulungen werden laufend aktualisiert.
Wir werden regelmäßig weitergebildet, wenn neue Themen oder Anforderungen dazukommen, damit wir immer auf dem neuesten Stand sind.
Simone Koren-Wallis:
Wichtig ist natürlich auch die Telefonnummer - am besten gleich einspeichern.
Ich spreche da jetzt auch als Mama: Ich würde meinem Kind die Nummer direkt ins Handy speichern und sagen: Wenn du ein mulmiges Gefühl hast - ruf an.
Wie lautet die Nummer?
Gilbert Sandner:
Ja, das ist eine gute Idee.
Die Nummer lautet: 0316 / 872 - 2277.
Da erreicht man die Ordnungswache zu den genannten Zeiten - also freitags, samstags und vor Feiertagen von 22 bis 3 Uhr.
Simone Koren-Wallis:
Und weil ich das gerade angesprochen habe - ich als Mama - habt ihr seit 2018 noch etwas Neues dazubekommen?
Gilbert Sandner:
Ja, genau.
Seit 2018 gibt es in Kooperation mit dem Amt für Jugend und Familie der Stadt Graz die sogenannte Jugendschutz-Hotline.
Die Ordnungswächter:innen sind auch ausgebildete Aufsichtsorgane nach dem steiermärkischen Jugendgesetz und können während der Dienstzeiten Auskunft geben - für Eltern, Jugendliche und Kinder - zu allen Themen rund um den Jugendschutz.
Simone Koren-Wallis:
Und das Heimweg-Telefon sowie die Jugendschutz-Hotline wurden sogar ausgezeichnet?
Gilbert Sandner:
Ja, richtig.
2019 hat sich die Stadt Graz gemeinsam mit dem Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice über den Österreichischen Sicherheitspreis gefreut, der in Eisenstadt verliehen wurde.
Das zeigt, dass das Heimweg-Telefon eine sehr gute Einrichtung ist - eine Institution, die dazu beiträgt, das objektive und subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken.
Simone Koren-Wallis:
Und ich glaube, eine Sache ist noch ganz wichtig:
Es ist egal, wo man gerade unterwegs ist - man wird nicht abgewiesen, oder?
Gilbert Sandner:
Ja, genau.
Das Grazer Heimweg-Telefon hat Kooperationen mit Städten wie Wiener Neustadt und Villach - echte Partnerstädte.
Aber auch Anrufe aus anderen Teilen Österreichs oder sogar aus Deutschland werden von unseren Kolleg:innen professionell betreut.
Auch wenn wir dort nicht dieselben Datengrundlagen wie bei den Partnerstädten haben, leisten wir Hilfe und halten den Draht offen.
Simone Koren-Wallis:
Damit wirklich jeder gut und sicher nach Hause kommt.
Gilbert Sandner:
Das ist das Ziel - ganz genau.
🎵 Jingle / Vorschau:
Nächstes Mal geht es um das neue Kinderportal - über das sich Eltern für einen Platz in Krippen, Kindergärten, Horten und bei Tageseltern anmelden können - beziehungsweise anmelden müssen.
Es geht nämlich gar nicht mehr anders.
Mehr dazu in der nächsten Folge.
Wir hören uns - ich freu mich!
Folge 62: Einblick ins Albert Schweitzer Hospiz
Viele von uns sind im Vorweihachtsstress, deshalb möchte ich mit dieser Folge ein wenig entschleunigen, uns alle daran erinnern, was wirklich zählt, wie kostbar jeder Moment mit unseren Lieben ist. Treten wir gemeinsam einen Schritt zurück. Petra Valda und Lisa Steinberger erzählen nämlich von ihrer Arbeit im Albert Schweitzer Hospiz.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
In dieser Folge möchte ich euch ein bisschen runterholen vom Vorweihnachtsstress.
Ich möchte uns alle daran erinnern, was wirklich zählt - wie kostbar jeder Moment mit unseren Lieben ist.
Treten wir gemeinsam einen Schritt zurück und entdecken die wahre Bedeutung von Weihnachten wieder.
Mein Name ist Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation - und ich bin dieses Mal zu Gast im Albert Schweitzer Hospiz.
Petra Valda:
Hallo, mein Name ist Petra Valda. Ich bin die Stationsleitung im Albert Schweitzer Hospiz.
Lisa Steinberger:
Mein Name ist Lisa Steinberger. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin mit Spezialisierung auf Palliativmedizin und arbeite im Albert Schweitzer Hospiz.
🎙️ Brigitte aus Graz erzählt vom Aufenthalt ihres Mannes im Hospiz:
Wir waren im Hospiz - und für mich war das der Lotto-Sechser meines Lebens.
So gut und so hervorragend, wie mein Mann dort betreut wurde - ich glaube nicht, dass das in irgendeinem Krankenhaus möglich gewesen wäre.
Ich habe immer nur lächelnde Gesichter gesehen.
Es war nie jemand da, der keine Zeit gehabt hätte.
Irgendjemand hatte immer Zeit für ein paar Worte.
Auch bei der Pflege wurde gelacht.
Man hat vergessen, dass man eigentlich sehr krank ist.
Simone Koren-Wallis:
So beschreibt Brigitte aus Graz die Zeit im Hospiz, als sie ihren Mann nicht mehr selbst pflegen konnte.
Liebe Petra, liebe Lisa - starten wir vielleicht einmal ganz grundsätzlich:
Was ist eigentlich ein Hospiz?
Petra Valda:
Ein Hospiz ist ein Ort, an dem Menschen am Lebensende - meist mit einer unheilbaren Erkrankung - zur Ruhe kommen können.
Ein Ort, an dem sie begleitet werden, an dem ihre Symptome gelindert werden und an dem sie in Würde und mit Unterstützung versterben können.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, ihr habt tagtäglich mit dem Lebensende zu tun - mit dem Tod.
Und trotzdem seid ihr zwei Frauen, die mich hier anstrahlen und offensichtlich ihren Job lieben.
Wie schafft ihr das?
Lisa Steinberger:
Der Tod ist ein Teil des Lebens.
Wir sind ein großes Team - und gemeinsam versuchen wir, für die Menschen da zu sein, die uns am Lebensende brauchen.
Mit all unseren Fähigkeiten.
Petra Valda:
Wichtig ist, dass man sich diesen Job bewusst aussucht.
Dass man nicht einfach irgendwohin geschickt wird, sondern sagt: „Ich möchte hier arbeiten."
Man weiß, dass es auch schwer sein kann - aber auch wenn es traurig klingt, ist am Ende des Tages ganz viel Liebe und Dankbarkeit da.
Und das ist das, was zählt - was wir erleben.
Manchmal ist es sogar leicht.
Wir gehen nicht jeden Tag traurig zur Arbeit und warten, bis jemand stirbt.
Ja, das gehört dazu - aber es ist auch ganz viel Leben da.
Ganz viel Normalität.
Wir lachen viel - mit unseren Patient:innen und im Team.
Und ich glaube, das Wichtigste ist dieses große Team, das nicht nur die Patient:innen unterstützt, sondern auch uns gegenseitig.
Simone Koren-Wallis:
Nehmt ihr da auch manchmal etwas mit nach Hause - im Kopf, im Herzen?
Petra Valda:
Man nimmt immer jemanden mit - das ist Beziehung.
Ich nehme nicht alle hunderten Patient:innen mit, die ich begleitet habe - aber es gibt immer ein oder zwei, deren Lebensgeschichte einen besonders berührt.
Manchmal weine ich auch - ja, manchmal sehr.
Aber das gehört dazu.
Das macht uns menschlich und zeichnet uns aus.
Wir sind professionell, wir haben alle eine Ausbildung und Zusatzausbildungen - und damit können wir gut mit diesen Situationen umgehen.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Plätze gibt es im Albert Schweitzer Hospiz?
Lisa Steinberger:
Wir haben zwölf Betten - alles Einzelzimmer.
Das Hospiz ist Teil der geriatrischen Gesundheitszentren in Graz.
Es ist ein Haus im Grünen, über zwei Stockwerke.
Die Zimmer sind hell und farbenfroh gestaltet - jeder hat seinen Raum, seinen Platz, um bei uns anzukommen.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, wenn jemand kommt, bleibt er auch bis zum Schluss?
Es gibt keinen Weg zurück?
Lisa Steinberger:
Wir bieten die Möglichkeit, bis zuletzt bei uns zu sein.
Aber es gibt auch Fälle, in denen sich die Situation stabilisiert - und jemand wünscht sich, nach Hause zu gehen und dort mit einem guten Netzwerk zu versterben.
Grundsätzlich begleiten wir aber in der letzten Lebensphase bis zum Tod.
Simone Koren-Wallis:
Wie lange bleiben die Patient:innen bei euch im Durchschnitt?
Petra Valda:
Das ist unterschiedlich - aber im Schnitt sind es etwa 28 bis 38 Tage.
Es gibt aber auch Ausreißer nach oben und unten.
Wir haben zum Beispiel eine Patientin mit einer neurologischen Erkrankung, die ist jetzt schon im vierten Jahr bei uns.
Sie hält sich Gott sei Dank nicht ans Lehrbuch - sie hätte laut Prognose schon vor zehn Jahren versterben sollen.
Das darf auch sein.
Wir haben keinen Druck, sie zu entlassen.
Aber es gibt auch Fälle wie zuletzt - da kam ein Patient am Freitag und ist am Sonntagvormittag verstorben.
Das gibt es natürlich auch.
Simone Koren-Wallis:
Seid ihr eigentlich viel mehr als das, was ihr beruflich macht?
Seid ihr auch Psychologin, Familienbetreuerin - also irgendwie so ein Allround-Paket?
Lisa Steinberger:
Ich glaube, so wie Petra vorher gesagt hat: Wir gehen ganz stark in Beziehung mit den Menschen.
Natürlich haben wir unseren Beruf - manchmal auch ein bisschen Berufung - aber wir sind auch ganz normale Menschen.
Und ich denke, viele von uns, eigentlich alle, haben ein gutes Gespür dafür, was Patient:innen brauchen.
Wir sind ein großes Team - niemand übernimmt die Rolle des anderen.
Wir haben eine Psychologin, eine Musiktherapeutin, eine Physiotherapeutin, ein großes Pflegeteam.
Jede:r hat seine Kompetenz.
Was uns auszeichnet, ist die Zeit, die wir haben - und die Zuwendung, die wir den Menschen schenken.
Es ist ein sehr intimer Bereich.
Petra Valda:
Die Geburt ist ein intimer Bereich - und das Sterben ebenso.
Geburt und Tod - diese Lebensspanne.
Die Geburt ist natürlich freudig, aber wir haben alle eine hundertprozentige Sterblichkeit.
Das vergessen wir oft - wir wissen es zwar, aber niemand will am Ende dabei sein.
Man geht in einen sehr intimen Bereich.
Man lernt die Menschen in einer besonderen Lebensphase kennen - sie haben davor ein Leben gelebt, das wir uns manchmal gar nicht vorstellen können, wenn sie es uns nicht erzählen.
Und genau diese besondere Lebenszeit macht die Begleitung so wertvoll.
Lisa Steinberger:
Meistens gibt es auch eine Familie, Angehörige, Freund:innen - und auch für sie sind wir da.
Mit ihnen gehen wir den Weg gemeinsam.
Da kommt es oft zu ganz besonderen Begegnungen.
Es gibt viel Berührungsangst mit dem Thema Hospiz, Tod, Trauer - und ich glaube, wir können da viel Unterstützung bieten.
Vielleicht gelingt es uns, das Thema wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft zu holen und das Tabu ein Stück weit zu brechen.
Simone Koren-Wallis:
Gab es in den letzten Jahren Fälle, bei denen ihr sagt: Diese Person werde ich nie vergessen - oder ein ganz besonderes Ereignis?
Petra Valda:
Es gibt viele solcher Fälle.
Das Schöne ist: Angehörige oder Freund:innen besuchen uns oft noch Jahre später.
Vor sieben Jahren hatten wir eine sehr intensive Begleitung - ein Ehepaar, sie war die Patientin, er war noch berufstätig.
Er hat neun Monate mit seiner Frau hier gewohnt.
Er kam morgens im Pyjama raus, holte sich Tee oder Frühstück, ging zurück ins Zimmer, frühstückte mit seiner Frau, zog sich dann um und fuhr zur Arbeit - und kam abends wieder.
Wir haben sie in einer ganz besonderen Lebensphase kennengelernt - und er kommt uns heute noch besuchen.
Viele sagen: „Ich komme gern zu euch - auch nur für fünf Minuten. Ihr habt das miterlebt, euch muss ich nichts vormachen."
Einmal im Jahr veranstalten wir eine Gedenkfeier für alle Verstorbenen des vergangenen Jahres - mit einem Wortgottesdienst.
Da laden wir Angehörige und Freund:innen ein.
Heuer war sie im November - und es sind sehr viele gekommen.
Da gibt es nochmal Begegnungen, Umarmungen, Dankbarkeit - und manchmal auch eine Träne am Kircheneingang.
Der Kontakt besteht oft weit über den Tod hinaus.
Lisa Steinberger:
Es ist auch schön, dass wir oft die Rückmeldung bekommen:
„Es ist so schön zu hören, dass bei euch so viel gelacht wird."
Unser Stationsstützpunkt ist offen - die Zimmer sind davor, es gibt viel Austausch, Gespräche mit Patient:innen und Angehörigen.
Und dieses Lachen spüren alle - das macht es leichter, bei uns anzukommen.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es auch Ereignisse hier im Hospiz, die ihr nie vergessen werdet?
Petra Valda:
Ein besonders schönes Ereignis war eine Hochzeit, die wir mitgestalten durften.
Die Tochter einer Patientin hat geheiratet.
Es war die Sorge: „Schaffe ich es ins Rathaus?"
Und wir haben gesagt: „Wir haben einen schönen Hörsaal im Dachgeschoss - ihr könnt auch hier heiraten, wenn ihr wollt."
Das Brautpaar war begeistert - und die Brautmutter, unsere Patientin, auch.
Sie war im Rollstuhl mobil und sagte: „Ich bin so nervös - ich glaube, ich schaffe das gar nicht im Rollstuhl."
Da habe ich gesagt: „Gut, dass es im Haus ist - dann fährst du einfach mit dem Bett hinauf. Und wenn du umfällst, bist du schon im Bett."
Und genau so hat sie die Hochzeit miterlebt - ganz entspannt.
Wir haben Essen und Trinken organisiert - und sie haben bis zum späten Nachmittag gefeiert.
Das Standesamt war da, alle konnten dabei sein - es war wirklich schön für uns alle.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt sind wir in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit - Weihnachten steht bevor.
Darf ich fragen: Wie „feiert" ihr Weihnachten hier im Hospiz?
Petra Valda:
Die Station ist bereits dekoriert - ganz viel Weihnachtliches.
Das Team, das am 24. Dienst hat, macht mit den Patient:innen eine kleine Feier - in den Zimmern oder in unseren Nischen, wenn gewünscht.
An den Adventssonntagen zünden wir Lichter am Adventkranz an - auch da gibt es kleine Feiern.
Die, die möchten, holen wir zusammen - das macht das Team ganz selbstverständlich.
Das ist kein Zusatz, sondern gehört einfach dazu.
Wir feiern die Jahreszeit, das Ereignis - und laden die Patient:innen ein.
Wer nicht möchte, ist genauso willkommen.
Es findet auch viel in den Zimmern statt.
Ich hatte selbst einmal am 24. Nachmittag Dienst - ein Kollege und ich sind durch die Zimmer gegangen und haben Weihnachtslieder angestimmt.
Ich glaube, wir haben sogar richtig gesungen.
Für manche hat das gut gepasst - Familien waren da, und es war stimmig.
Simone Koren-Wallis:
Und damit wünsche ich euch allen frohe Weihnachten.
Denkt daran: Es gibt Menschen, die sich nur eines wünschen - Gesundheit.
Ich hoffe, wir hören uns im neuen Jahr wieder.
Einen guten Rutsch und alles Liebe für 2025.
Folge 61: Die Bedeutung der Koralmbahn für Graz
26 Jahre hat der Bau gedauert - für die 130 Kilometer lange Koralmbahn zwischen der Steiermark und Kärnten. Der erste reguläre Zug wird Ende 2025 fahren. Wir fragen uns jetzt schon: was bedeutet die Koralmbahn eigentlich für Graz?
Welche Vorteile bringt die Verbindung Graz-Klagenfurt für den Wirtschafts- und Lebensraum? Die Antworten kommen von Stadtbaudirektor Bertram Werle, der Abteilungsleiterin für Wirtschaft und Tourismusentwicklung Andrea Keimel, Kulturamtsleiter Michael Grossmann, Messe Congress Graz Vorstand Armin Egger und Tourismus Graz Chef Dieter Hardt Stremayr.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
26 Jahre hat der Bau gedauert - für die 130 Kilometer lange Koralmbahn zwischen der Steiermark und Kärnten.
Der erste reguläre Zug wird Ende 2025 fahren.
Wir fragen uns jetzt schon: Was bedeutet die Koralmbahn eigentlich für Graz?
Welche Vorteile bringt die Verbindung Graz-Klagenfurt für den Wirtschafts- und Lebensraum?
Die Antworten kommen von Stadtbaudirektor Bertram Werle, der Abteilungsleiterin für Wirtschaft und Tourismusentwicklung Andrea Keimel, Kulturamtsleiter Michael Grossmann, Messe-Congress-Graz-Vorstand Armin Egger und Tourismus-Graz-Chef Dieter Hardt-Stremayr.
🎵 Jingle
Es ist das große Thema: die Koralmbahn - die Verbindung zwischen Klagenfurt und Graz.
Lieber Stadtbaudirektor Bertram Werle, was bedeutet das für die steirische Landeshauptstadt?
Bertram Werle:
Für Graz bedeutet das, dass wir an eine europäische Achse mit sehr hoher Leistungsfähigkeit angebunden sind.
Konkret heißt das: Graz und Klagenfurt rücken näher zusammen und spannen eine Region auf mit über einer Million Einwohner:innen.
Und obwohl die Bahn ursprünglich für den Güterverkehr geplant wurde, erwarten wir, dass sich der „Nebennutzen" für den Personenverkehr enorm entfalten wird.
Denn es geht ja nicht nur um Graz-Klagenfurt - sondern auch um Wien-Graz-Klagenfurt und weiter bis nach Oberitalien.
Das bedeutet für uns: Wir müssen unsere Infrastruktur in Graz ausbauen - neue Nahverkehrsknoten, Straßenbahnlinien, Busverbindungen - und diese an die neuen Anforderungen anpassen.
Nur so können wir die Fahrgastströme attraktiv abwickeln und die Lebensqualität in Graz weiter steigern.
Simone Koren-Wallis:
Aber wie ist das alles finanzierbar?
Bertram Werle:
Diese großen Ausbauvorhaben bis 2040 kann die Stadt natürlich nicht alleine stemmen.
Wir sind in sehr guten Gesprächen mit Land und Bund - beide haben ja bereits den Ausbau des Straßenbahnnetzes in Graz mitfinanziert.
Und mit der Anbindung an die Koralmbahn und der überregionalen Bedeutung unseres städtischen Verkehrs sind wir zuversichtlich, dass wir auch hier wieder auf Unterstützung zählen können.
Simone Koren-Wallis:
Andrea Keimel, Abteilungsleiterin für Wirtschaft - liebe Andrea, was bedeutet die Bahn für den Wirtschaftsstandort Graz?
Andrea Keimel:
Die Strecke zwischen Graz und Klagenfurt kennen wir meist von Autofahrten über die Pack.
Aber die Vorstellung, dass man in 45 Minuten mit dem Zug von Graz nach Klagenfurt kommt, ist noch nicht wirklich in unseren Köpfen verankert.
Wenn man sich zum Beispiel die Strecke zwischen Wiener Neustadt und Wien-Karlsplatz anschaut - da pendeln Menschen täglich zur Arbeit, zum Einkaufen - das ist dort ganz normal.
Und ich denke, dass diese neue Erreichbarkeit auch bei uns wachsen muss - in den Köpfen der Menschen und in den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
Der erweiterte Raum Graz-Klagenfurt umfasst über eine Million Einwohner:innen und rund eine halbe Million unselbstständig Beschäftigte.
Das eröffnet enorme Chancen.
Wir im Wirtschaftsressort analysieren gerade die Potenziale in beiden Regionen - mit dem Ziel, Gemeinsamkeiten zu stärken.
Das betrifft Bildung, Fachkräfte, Digitalisierung - und die Vernetzung entlang der Alpe-Adria-Achse.
Ein Beispiel: Im Bereich Umwelttechnologie hat sich eine steirische Entwicklung über unsere Clusterorganisationen etabliert und wurde dann auf Kärnten ausgeweitet.
Solche Projekte wollen wir jetzt ganz pragmatisch mit unseren Partner:innen in Klagenfurt und Kärnten weiterentwickeln.
Simone Koren-Wallis:
Vom Stadtbaudirektor über die Wirtschaft - jetzt zur Kultur.
Was bedeutet die Koralmbahn für die Kultur in Graz?
Kulturamtsleiter Michael Grossmann.
Michael Grossmann:
Eine enorme Hoffnung - nämlich die Hoffnung auf viel mehr Publikum in Graz.
Wir wachsen zusammen mit Klagenfurt - und 45 Minuten sind keine Entfernung.
In dieser Zeit kann man sich gut beschäftigen - und dann in Graz Ausstellungen besuchen, an den Galerientagen teilnehmen, Museen besichtigen.
Und wenn die Koralmbahn einen guten Takt bekommt, kann man auch abends ins Theater, in die Oper, ins Ballett oder zum zeitgenössischen Tanz.
Das ist ein echter Hoffnungsschimmer - für die großen Häuser in Graz genauso wie für die freie Szene.
Simone Koren-Wallis:
Was bedeutet das organisatorisch?
Denn dann könnten ja - nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch - deutlich mehr Menschen kommen, um Vorstellungen zu besuchen.
Michael Grossmann:
Das ist richtig.
Das wird die Bühnen freuen, das wird die freien Theater freuen, das wird die Museen freuen - und auch die Ausstellungen.
Ich glaube, wir haben durchaus noch Kapazitäten, um mehr Publikum in Graz willkommen zu heißen.
Aber mir ist auch etwas anderes wichtig:
Der Zug fährt ja nicht nur in eine Richtung.
Er eröffnet auch für uns in Graz die Möglichkeit, das Kulturleben in Klagenfurt viel stärker wahrzunehmen.
Auch das wird ein gegenseitiger Austausch sein - und möglicherweise ergeben sich daraus ganz neue Kooperationen, die uns kulturell ein gutes Stück weiterbringen.
Simone Koren-Wallis:
Was bedeutet die Koralmbahn für die Messe Congress Graz?
Lieber Vorstand Armin Egger - ich sehe da schon ein Lächeln, weil das eigentlich nur positiv sein kann.
Armin Egger:
Ganz genau.
Die Koralmbahn wird für die Stadt Graz, für die Umgebung, für die gesamte Steiermark - und natürlich auch für uns als MCG - ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
Aus Sicht unserer Kund:innen bedeutet das:
Wir sind plötzlich sehr schnell und einfach erreichbar - für Menschen aus Kärnten, von Klagenfurt bis Villach, aber auch aus den Seitentälern, die über mehrere Haltestellen an die Koralmbahn angebunden sind.
Unser Markt wird dadurch erheblich erweitert - und das auf einfache Weise.
Denn plötzlich ist Klagenfurt nur noch 45 Minuten von der Messe Graz entfernt - also näher als viele obersteirische Städte.
Wir freuen uns sehr auf diese Chance - auf die Möglichkeiten, die sich für uns, für Graz, für die Unternehmen und für die Region ergeben.
Simone Koren-Wallis:
Koralmbahn und Tourismus Graz - da strahlt schon jemand: Dieter Hardt-Stremayr.
Was sagt der Tourismus dazu, wenn bald die Koralmbahn fährt?
Dieter Hardt-Stremayr:
Koralmbahn und Tourismus - das wird eine Liebesbeziehung, ganz ohne Zweifel.
Sowohl Klagenfurt als auch Graz werden davon profitieren.
Die Einheimischen profitieren - und die Gäste natürlich auch.
Die Wege werden kürzer.
Wenn man sich vorstellt: In 45 Minuten steht man am Hauptbahnhof Klagenfurt - und zehn Minuten später klopft man schon an die Tür des Strandbads.
Das ist eine schöne Richtung.
Die andere Richtung führt nach Graz - eine tolle Stadt, die für viele Klagenfurter:innen dann plötzlich direkt vor der Haustür liegt.
Das wird Auswirkungen haben: auf Besucher:innen im Opernhaus, im Schauspielhaus, in der Museumslandschaft, in der Gastronomie - und überall sonst.
Das wird ein Festival für die Festivals - weil das Einzugsgebiet größer wird.
Und wir könnten sogar mitpartizipieren, wenn in Klagenfurt ein großes Stadionkonzert stattfindet und dort nicht genug Hotelbetten vorhanden sind.
Dann können wir sagen: „Hurra - wir haben Platz! Nur 45 Minuten entfernt, mit Shuttlebus."
Wir hoffen natürlich, dass das in der Champions League nicht wieder passiert - dass man ausweichen muss - aber das sind alles Möglichkeiten, die dann realistisch werden.
Es beginnt eine neue Zeitrechnung.
Denn wenn man sich überlegt, wohin man bisher in 45 Minuten von Graz aus gekommen ist - dann hatte man vielleicht Deutschlandsberg oder südlich von Leibnitz im Blick.
Aber sicher nicht jenseits der Koralpe - und ganz sicher nicht Klagenfurt oder Villach.
Das wird uns weiterbringen.
Denn eine Schwäche war bisher immer die Erreichbarkeit per Bahn.
Es war kaum vermittelbar, dass man mit dem Zug von Klagenfurt oder Villach nach Graz fahren sollte.
Der Postbus über die Pack hat da einiges abgefangen - aber das ist nicht mehr zeitgemäß.
Oder wenn man von Triest nach Graz wollte - da brauchte man einen starken Willen, um das mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu schaffen.
Da wurde empfohlen: mit der Bahn bis Klagenfurt, dann in den Postbus umsteigen.
Mit der Koralmbahn wird das alles anders - und auf diese neue Zeit freuen wir uns sehr.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Wir sind auf alle Fälle gespannt - und freuen uns auf diesen Meilenstein:
Die Koralmbahn als große Chance für Graz und die gesamte Region.
🎵 Intro / Simone Koren-Wallis:
In dieser Folge geht es um das neue Doppelbudget der Stadt Graz.
Und ja - das klingt irgendwie extrem kompliziert.
Es geht schließlich um Einnahmen, um Ausgaben, um ganz viele Zahlen.
Aber glaubt mir: Das wird sehr einfach erklärt.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation - und ich bin zu Gast bei Johannes Müller.
🎵 Jingle / Johannes Müller:
Mein Name ist Johannes Müller, ich bin der Finanzdirektor der Landeshauptstadt Graz.
Simone Koren-Wallis:
Das Budget der Stadt Graz für die nächsten zwei Jahre ist fertig.
Lieber Herr Finanzdirektor - wie waren die letzten Tage?
Wie geht es dir, wie geht es deinem Team?
Johannes Müller:
Mein Team wirkt noch entspannt - aber sie haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet.
Es ist immer eine große Aufregung, bis alle Zahlen stehen und technisch alles funktioniert.
Aber es schaut gut aus - und wie man sieht: Es ist fertig.
2000 Seiten Budget und Zahlen liegen nun zur Einsichtnahme auf.
Simone Koren-Wallis:
Fangen wir ganz von vorne an:
Was ist eigentlich das Budget?
Johannes Müller:
Das Budget der Stadt bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen für das jeweilige Budgetjahr ab.
Diesmal haben wir ein Doppelbudget - für 2025 und 2026.
Es ist nicht nur eine Übersicht, sondern auch der Rahmen, in dem wir arbeiten können.
Alles, was die Stadt macht - von A wie Abwasser bis Z wie Zebrastreifen - findet sich im Budget wieder.
Und man muss ganz offen sagen: Budgets bedeuten auch Knappheit.
Es ist immer ein bisschen weniger drin, als die Fachabteilungen gerne hätten.
Simone Koren-Wallis:
Aber wie geht das dann?
Johannes Müller:
Bis jetzt - könnte man flapsig sagen - ist es immer noch gut ausgegangen.
Aber das Budget muss bestimmten Regeln entsprechen.
Wir dürfen nicht dauerhaft mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen.
Simone Koren-Wallis:
Und wie viel geben wir aus - und wie viel nehmen wir ein?
Du hast Zahlen vor dir.
Johannes Müller:
Ja, das kann ich sagen.
Wir geben sowohl im Jahr 2025 als auch 2026 im laufenden Geschäft mehr Geld aus, als wir einnehmen.
Das ist natürlich nicht ideal.
Das liegt vor allem an zwei Dingen:
Erstens sind die Einnahmen gesunken.
Der größte Brocken unserer Einnahmen sind die sogenannten Ertragsanteile - das sind Steueranteile, die bundesweit eingehoben und dann verteilt werden.
Durch Steuerreformen und die schlechte Wirtschaftslage sinken diese Einnahmen - und Länder und Gemeinden sind da einfach Passagiere.
Für 2025 bekommen wir „nur" 426 Millionen Euro Ertragsanteile netto - also nach Abzug der Landesumlage.
Im Vorjahr waren es über 430 Millionen Euro - das macht sich bemerkbar.
Simone Koren-Wallis:
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln - denn ich glaube, nur der Finanzdirektor der Stadt Graz darf bei 426 Millionen Euro „nur" sagen.
Das ist ja eine Wahnsinnszahl - sie ist neunstellig!
Okay - das sind die Ertragsanteile.
Johannes Müller:
Genau - und wenn man sagt, das ist wahnsinnig viel Geld, muss man auch bedenken, was wir alles zahlen müssen.
Oder besser gesagt: was unsere Aufgabe ist.
Ein großer Teil sind Personalkosten - denn viele unserer Leistungen werden durch Menschen erbracht.
Von der Kinderbetreuung bis zum Passamt - das sind Mitarbeiter:innen, und nicht wenige.
Und dazu kommen auch noch die Pensionen.
Allein diese Kosten liegen bei über 375 Millionen Euro.
Das heißt: Die Zahlen dürfen einen nicht abschrecken.
In Summe haben wir über 1,2 Milliarden Euro Einnahmen - und ein bisschen mehr Ausgaben.
Für Privatpersonen sind das unvorstellbare Summen - aber wir sind ja auch die größte Stadt Österreichs, die kein Bundesland ist.
Hier leben über 300.000 Menschen - und wir erbringen viele Leistungen.
Da relativieren sich diese Beträge wieder.
Denn im Detail sind es ganz viele kleine Beträge, die sich summieren.
Simone Koren-Wallis:
Was haben wir da zum Beispiel noch?
Kannst du ein paar Dinge aufzählen?
Johannes Müller:
Vielleicht systematisch:
Bei den Einnahmen ist ein großer Block - wie gesagt - die Ertragsanteile.
Die sind vom Bund geregelt und können sich durch Gesetzesänderungen stark verändern.
Dann haben wir eigene Abgaben und Steuern, die die Stadt selbst einheben darf.
Die wichtigste ist die Kommunalsteuer - rund 192 Millionen Euro im Voranschlag 2025.
Diese Steuer hängt stark von der wirtschaftlichen Entwicklung ab - von Arbeitsplätzen, Gehaltsabschlüssen usw.
In der aktuellen Lage - schlechte Konjunktur, sinkende Bundessteuereinnahmen - ist das alles unter Druck.
Um nicht zu sagen: beängstigend schlecht, was da auf uns zukommt.
Simone Koren-Wallis:
Aber was heißt das jetzt für die Grazer:innen?
Könnte dadurch irgendetwas teurer werden?
Johannes Müller:
Die Steuern, die ich vorhin genannt habe - wie etwa die Ertragsanteile oder die Kommunalsteuer - kann die Stadt Graz nicht selbst verändern.
Das ist reine Bundesangelegenheit.
Was in der öffentlichen Diskussion manchmal auftaucht, sind die sogenannten Gebühreneinnahmen - etwa Kanal- und Müllgebühren.
Diese Gebühren dienen aber nicht dem allgemeinen Haushalt, sondern sind zweckgebunden.
Das heißt: Die Mittel dürfen ausschließlich für Abfallwirtschaft und Abwasserversorgung verwendet werden.
Und auch hier gilt: Wir dürfen diese Gebühren nicht willkürlich erhöhen oder senken - sie folgen einer kostenrechnerischen Logik.
Nur um eine Zahl zu nennen: Im Jahr 2025 sind das rund 115 Millionen Euro - und diese Einnahmen decken unsere Kosten in diesem Bereich.
Aber auch hier steigen die Kosten - das ist klar.
Dann gibt es noch einen weiteren großen Einnahmenblock - rund 340 Millionen Euro.
Das sind sogenannte Rückersätze.
Simone Koren-Wallis:
Rückersätze - das klingt positiv. Da bekommt man Geld zurück?
Johannes Müller:
Genau.
Bei bestimmten Sozialleistungen - etwa Sozialunterstützung, Pflegeheime, Leistungen nach dem Behindertengesetz oder Schulassistenz - teilen sich das Land Steiermark und die Gemeinden die Kosten.
In Graz ist es so, dass wir diese Leistungen vorfinanzieren - und das Land ersetzt uns einen Teil davon.
Das ist also der Anteil, den wir rückerstattet bekommen.
Unterm Strich kommen wir - hier habe ich die Zahl markiert - auf 1,23 Milliarden Euro laufende Einnahmen.
Das ist das laufende Geschäft der Stadt.
Zusätzlich kommen noch Einnahmen aus Kreditaufnahmen dazu - etwa für große Investitionsprojekte.
Auf der Ausgabenseite - wie schon angesprochen - stehen die Personalkosten inklusive Pensionen.
Und die landesgesetzlich geregelten Leistungen, die aktuell stark steigen.
Das betrifft alle Gemeinden und auch das Land selbst.
Im Budget 2024 waren dafür 338 Millionen Euro vorgesehen - jetzt sind wir schon bei über 400 Millionen Euro.
Das liegt einerseits an Gehaltssteigerungen und Inflation, die diese Leistungen teurer machen - was logisch ist, denn auch Pflegeheime haben höhere Kosten.
Andererseits steigt auch die Anzahl der Menschen, die diese Leistungen benötigen - und dafür sind wir als Stadt natürlich da.
Budgetär ist das eine große Belastung - und wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, macht uns das schon große Sorgen.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt ist Mitte Dezember - der Budgetgemeinderat steht an.
Was bedeutet das für das Budget?
Johannes Müller:
Die erste Frage ist: Entspricht das Budget dem Statut - also ist es gesetzeskonform?
Und da kann ich sagen: Ja, es ist technisch ausfinanziert.
Wir haben zwar mehr Auszahlungen als Einzahlungen - aber wir können das durch Geldbestände aus Vorperioden und durch gesetzlich definierte Überziehungsrahmen unserer Konten ausgleichen.
Das heißt: Das Budget für 2025 und 2026 ist grundsätzlich vollzugsfähig.
Aber - und das muss man ehrlich sagen - der Ausblick bis 2030 ist zappenduster.
Da sind wir nicht allein: Der Bund hat Budgetprobleme, die Länder haben Budgetprobleme, die Gemeinden auch.
Aber unser Voranschlag zeigt klar: Es muss sich etwas ändern - auf Stadt-, Landes- und Bundesebene.
Das heißt:
- Freiwillige Ausgaben noch kritischer prüfen.
- Landesgesetzliche Leistungen, die stark anwachsen, müssen vom Land geregelt werden.
- Und die Frage, warum die Bundesabgaben - also die Ertragsanteile - so schlecht geworden sind, muss mit dem Bund verhandelt werden.
Der Bund muss sicherstellen, dass Städte und Gemeinden - dort, wo die Menschen leben - genug Geld haben, um ihre Aufgaben zu erfüllen.
Simone Koren-Wallis:
Also schauen wir mal, wie es weitergeht, oder?
Weil das ist aktuell noch ein bisschen Kaffeesudlesen.
Johannes Müller:
„Schauen wir mal" klingt immer ein bisschen fatalistisch.
Aber auf Verwaltungsebene kämpfen wir - mit allen, die etwas verändern können - für positive Entwicklungen.
Wir müssen einerseits den Fokus auf das nächste Jahr legen - denn durch jede tägliche Entscheidung können wir etwas verändern.
Das liegt bei uns: Wie wir unser Geld einsetzen, wie streng wir den Budgetvollzug auslegen - das ist unsere Verantwortung.
Gleichzeitig muss man sagen: Die langfristigen Aussichten sind im Moment nicht veränderbar.
Und es bringt nichts, das Budget schönzurechnen - das hilft niemandem.
Wichtig ist, dass wir die Zeit 2025-2026 aktiv nutzen - mit der neuen Bundesregierung, mit Veränderungen im Land, mit neuen Entscheidungsträger:innen.
Gemeinsam mit dem Städtebund und dem Gemeindebund - die übrigens viele gute Vorschläge haben - müssen wir in Verhandlungen treten.
Und dann gilt es, dafür zu sorgen, dass es den Städten und Gemeinden in Österreich - und in der Steiermark - in Zukunft besser geht als jetzt.
Simone Koren-Wallis:
Es sind 2.000 Seiten, die jetzt niedergeschrieben wurden - und es kann wirklich jede:r einen Blick hineinwerfen, oder?
Johannes Müller:
Ja, genau.
Wenn man hört „2.000 Seiten", ist das Interesse vielleicht nicht sofort riesig - aber das ist typisch für öffentliche Budgets.
Sie müssen verpflichtend öffentlich zugänglich sein - auch vor der Beschlussfassung.
Man findet sie auf der Website der Stadt Graz unter www.graz.at - dort kann man sie durchblättern.
Und wer lieber Papier mag: Das Budget liegt auch physisch bei uns in der Finanzdirektion zur Einsicht auf.
Aber um gleich die Angst zu nehmen:
Man muss nicht alle 2.000 Seiten lesen.
Es reicht, die ersten 10 bis 15 Seiten durchzublättern - da findet man sogar mehr Informationen, als wir jetzt besprochen haben.
Man sieht dort die wesentlichen Ergebnisse unserer Beteiligungsunternehmen, die Investitionsvolumina, viele Details, die auch im Alltag interessant sind.
Zum Beispiel: Wie viel geben wir für die Straßenreinigung aus? Wie funktionieren bestimmte Leistungen?
Je weiter man blättert, desto detaillierter wird es.
Wer also wirklich wissen will, wie hoch der Stromverbrauch in einem bestimmten Amt ist - findet das auch.
Aber da verliert man sich dann schnell in den Zahlenkolonnen.
Simone Koren-Wallis:
Und was könnte jede:r von uns tun, damit das Budget besser ausschaut?
Johannes Müller:
Naja - eine Möglichkeit wäre, dass jede:r einmal pro Woche falsch parkt...
Simone Koren-Wallis:
(lacht) Okay... vielleicht doch lieber nicht, gell?
Johannes Müller:
Naja - jede:r leistet seinen Beitrag.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
Und wer jetzt mehr über das städtische Budget erfahren möchte:
Einfach reinschauen unter graz.at/budget
Folge 59: Advent, Silvester, Sport und vieles mehr: Tipps für den Winter in Graz
Sie ist da - die kälteste Jahreszeit! Aber das heißt auch: es geht bald los mit den Adventmärkten, was ist neu in Graz, was schon Tradition, was darf man sich nicht entgehen lassen in puncto Silvester, Ballsaison und Wintersport. Graz Tourismus Chef Dieter Hardt-Stremayr hat die besten Tipps für den Winter.
🎵 Intro / Simone Koren-Wallis:
Ja, wir merken es an den Temperaturen - es ist die kälteste Jahreszeit.
Aber das heißt auch: Bald geht's los mit den Adventmärkten!
Und außerdem: Was ist mit Silvester, mit der Ballsaison, mit dem Wintersport?
Wir haben sie - die besten Tipps für den Winter in der wunderschönen Stadt Graz.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation - und mein Gast ist Dieter Hardt-Stremayr.
Dieter Hardt-Stremayr:
Hallo, mein Name ist Dieter Hardt-Stremayr.
Ich habe seit vielen, vielen Jahren das Vergnügen, Geschäftsführer von Graz Tourismus zu sein.
🎵 Jingle
Simone Koren-Wallis:
Wir haben uns entschieden, rauszugehen - denn Weihnachten ist zwar noch nicht da, aber es adventelt.
Dieter Hardt-Stremayr:
Ab sofort adventelt es - und da ich ins Adventeln und Weihnachten verliebt bin, ist das für mich eine der schönsten Zeiten im Jahr, ohne Zweifel.
Simone Koren-Wallis:
Übermorgen, also am Freitag, den 21. November, sperren die Glühweinstandln und Adventmärkte auf.
Der Christbaum steht schon - und wir stehen gerade davor.
Wir haben gesagt, wir gehen ein bisschen weg vom Trubel.
Was sagst du zum Christbaum heuer?
Dieter Hardt-Stremayr:
Alle Jahre wieder ist er wunderschön.
Und wenn er mal nicht schön genug erscheint - einfach zweimal hinschauen, dann ist jeder Christbaum schön.
Übrigens: Ich sehe zuerst die Marktstände - und dann kommt das Glühweintrinken. Damit das auch mal gesagt ist.
Simone Koren-Wallis:
Du hast vollkommen recht - wir spazieren gerade durch die Schmiedgasse.
Letztes Jahr war dort die neue Adventlounge. Gibt's heuer auch etwas Neues?
Dieter Hardt-Stremayr:
Die gute Nachricht: Die Lounge war letztes Jahr so beliebt, dass sie heuer wieder da ist - in der Schmiedgasse.
Neu ist, dass der Charitymarkt am Eisernen Tor nicht mehr zentral ist, sondern auf die einzelnen Märkte aufgeteilt wurde.
Dort entsteht ein „normaler" Weihnachtsmarkt.
Und ein großes neues Projekt ist der zusätzliche Markt am Karmeliterplatz - eine echte Herausforderung, diesen Platz zu bespielen.
Aber wir freuen uns sehr darauf, denn dadurch werden einige Wege in Graz noch kürzer - etwa zur Winterwelt oder hinauf zum Schlossberg.
Simone Koren-Wallis:
Winter in Graz - was gehört für dich alles dazu?
Dieter Hardt-Stremayr:
Der Winter beginnt für mich mit dem Advent - und das ist auch der Grund, warum wir uns auf den Winter freuen können.
Dann kommt Silvester als nächster Höhepunkt.
Danach wird's mit den Highlights etwas überschaubar - denn die Menschen haben in den letzten Jahrzehnten nicht gelernt, im Winter Städte zu bereisen.
Aus Angst vor Gatsch, Schnee und Kälte.
Aber inzwischen wissen wir: In der Innenstadt gibt's kaum noch Schnee - und das macht es viel angenehmer, auch im Winter durch die Stadt zu spazieren.
Was ich besonders liebe:
Wenn man durch die Gassen geht und das warme Licht aus den Wirtsstuben leuchtet.
Wenn's ein bisschen fröstelt, bekommt man richtig Lust, hineinzugehen, sich hinzusetzen, etwas Gutes zu essen und zu trinken - und sich Zeit zu lassen.
Das geht im Jänner, Februar und März ganz hervorragend.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Menschen besuchen Graz eigentlich im Winter?
Du sagst, es ist nicht die Hauptsaison - aber vielleicht doch?
Dieter Hardt-Stremayr:
Wenn man genau zählen könnte, würde ich's sofort sagen.
Aber wir wissen: In der Adventzeit sind es inzwischen sehr, sehr viele.
Statistisch gesehen sind Jänner und Februar die schwächsten Monate - was aber auch heißt: Da ist am meisten Luft nach oben.
Ein echter Geheimtipp - zumindest bis jetzt - ist:
Ohne Laub auf den Bäumen und mit der tief stehenden Wintersonne entstehen wunderschöne Fotomotive in der Stadt.
Da lohnt es sich wirklich, die Fassaden anzuschauen.
Solche Kleinigkeiten wollen wir im Winter stärker vor den Vorhang holen.
Simone Koren-Wallis:
Gut - starten wir trotzdem mal im Advent, denn der steht ja direkt bevor.
Hast du ein paar Zahlen, Daten, Fakten?
Welche Termine sollte man sich unbedingt im Kalender anstreichen?
Dieter Hardt-Stremayr:
Was man sich wirklich merken sollte:
Am 21. November wird das Licht eingeschaltet.
Einen Tag später, also am 22. November, sperren alle Adventmärkte auf - mit Ausnahme der beiden Kunsthandwerksmärkte, die eine Woche später starten.
Und am 30. November ist es dann soweit: Der Christbaum wird illuminiert und die Eiskrippe eröffnet.
Das sind die großen Highlights - und dann läuft alles bis zum 23. bzw. 24. Dezember.
Danach heißt es: Blick auf das Silvesterspektakel, das uns am Silvesterabend wieder begeistern wird.
Wir machen wieder fünf Shows - und dann hätten wir das Jahr hinter uns gebracht.
Simone Koren-Wallis:
Zumindest das Jahr - aber nicht den Winter.
Was kann man sportlich in Graz unternehmen?
Gerade im Jänner denkt sich ja jede:r: „Ein bisschen mehr tun, abnehmen, sporteln..."
Ich sage nur: Winterwelt.
Dieter Hardt-Stremayr:
Die Grazer Winterwelt hat da schon geöffnet.
Man kann bis weit ins neue Jahr hinein Eislaufen, für die ganz Mutigen auch Eishockey spielen oder Eisstockschießen.
Und wenn wir schon beim Eis sind - es wird zwar kein Eis auf der Mur geben, aber Eisschwimmen wäre theoretisch auch eine Option.
Nicht für mich - definitiv nicht für mich.
Der Schneemangel, den wir in der Stadt haben - Gott sei Dank, sage ich - lädt dazu ein, dass man Laufrunden auch im Winter drehen kann.
Winterwandern wird immer beliebter.
Und auch die Mountainbikes werden nicht mehr über den Winter eingesperrt.
Selbst der Schöckl bietet sich da wunderbar an.
Simone Koren-Wallis:
Du hast es jetzt ganz sicher verschrieben - heuer wird wahrscheinlich der schneereichste Winter überhaupt!
Dieter Hardt-Stremayr:
Ja, da lasse ich mich gern verschreiben - und exportieren wir ein bisschen Schnee aus der Stadt in die Skigebiete, die ihn für die Saison dringend brauchen.
Sollte tatsächlich Schnee kommen, haben wir im Tal draußen eine schöne Loipe.
In der Theorie laufe ich sie jedes Jahr - in der Praxis in den letzten Jahren eher weniger.
Simone Koren-Wallis:
Tanzen ist ja eigentlich auch ein Sport - und tanzen kann man auf den verschiedensten Bällen in Graz.
Dieter Hardt-Stremayr:
Wenn man tanzen kann, kann man auf den Bällen tanzen - ganz genau.
Unser überregionales, ja sogar internationales Aushängeschild ist die Opernredoute.
Den Wiener Freund:innen sage ich immer:
„Wollt ihr eine Tanzveranstaltung in einem schöneren Haus als der Wiener Staatsoper? Dann kommt nach Graz."
Mit dem großen Vorteil - manche sagen, es sei ein Nachteil - dass man dort auch wirklich tanzen kann.
Simone Koren-Wallis:
Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr - von den Maturabällen abgesehen.
Wir sind ja wirklich eine Ballhochburg.
Dieter Hardt-Stremayr:
Da haben wir einiges Außergewöhnliches zu bieten.
Auch der Bauernbundball - man kann ihn mögen oder nicht - aber was sich dort abspielt, ist gigantisch.
So viele Trachten, Lederhosen und eine Riesengaude - das gibt's selten.
Auch der Tuntenball ist etwas, das mittlerweile weit über Graz hinausstrahlt.
Und wir haben einfach wunderschöne Locations - da lässt sich richtig gut feiern.
Simone Koren-Wallis:
Wenn du jetzt jemanden triffst, der noch nie in Graz war - und der fragt dich:
„Warum sollte ich im Winter unbedingt nach Graz kommen?"
Wie würdest du das kurz und knackig beantworten?
Dieter Hardt-Stremayr:
Es ist einfach schön - ganz einfach.
Und das ist auch die Rückmeldung, die wir immer öfter von unseren Gästen bekommen.
Man macht sich das Leben oft schwer, analysiert viel, schaut sich dies und jenes an.
Aber die schlichte und ehrliche Rückmeldung vieler Besucher:innen ist:
„Es ist einfach schön bei euch. Es ist gemütlich. Und wir fühlen uns willkommen."
Und „willkommen" heißt nicht nur Architektur - sondern vor allem: Menschen.
Wir sind unfassbar gastfreundlich - und das spüren die Menschen.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge geht es um Ausgaben, Einnahmen, Aufteilung - kurz: ums Budget der Stadt Graz.
Wir hören uns - ich freu mich!
Folge 58: Was macht die Stadt Graz mit den Toten?
Eine etwas eigene, aber doch interessante Frage. Es geht um Leichenbeschau, Familienrecherche uvm.: das ist die tägliche, sehr einfühlsame Arbeit des Gesundheitsamts der Stadt Graz.
Wie viele Menschen sterben im Jahr in der Landeshauptstadt? Welche Fälle gehen einem besonders nahe? Das beantworten Eva Winter und Elke Köhler-Strohrigl.
🎵 Jingle
Simone Koren-Wallis
Nein, es ist heute kein einfaches Thema. Es geht nämlich darum, was die Stadt Graz mit den Verstorbenen macht - also um Leichenbeschau und Todesfeststellung.
Das ist die tägliche, sehr einfühlsame Arbeit des Gesundheitsamts der Stadt Graz. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste heute: Eva Winter und Elke Köhler-Strohrigl.
🎵 Jingle
Eva Winter
Ich heiße Eva Winter, bin die Leiterin des Gesundheitsamts, und viele behördliche Aufgaben rund um den Tod fallen in unseren Zuständigkeitsbereich.
Elke Köhler-Strohrigl
Ich bin Elke Köhler-Strohrigl, Sachbearbeiterin im Gesundheitsamt der Stadt Graz, im Referat Sterbeauskunft. Ich habe täglich mit dem Tod in all seinen Facetten zu tun.
🎵 Jingle
Simone Koren-Wallis
Auch wenn Halloween und Allerheiligen vorbei sind, bleibt der Tod bei uns ein Thema. Denn ich stelle heute die Frage: Was machen wir mit den Verstorbenen? Was macht die Stadt Graz mit den Toten?
Eva Winter
Wie schon eingangs erwähnt: Wir sind eine Behörde - und zwar in zweierlei Hinsicht.
Wir sind Bezirkshauptmannschaft und gleichzeitig auch Gemeinde. In Graz fällt das beides zusammen. In die Gemeindekompetenz fallen viele Aufgaben, die mit dem Tod zu tun haben - und zwar unmittelbar ab dem Zeitpunkt, an dem er eintritt. Wir sind zum Beispiel zuständig für die Totenbeschau.
Alle Menschen, die außerhalb von Krankenanstalten versterben, müssen beschaut werden. Das liegt in der Zuständigkeit der Gemeinde und wird bei uns von den Amtsärztinnen und Amtsärzten durchgeführt - zusätzlich zu ihren anderen amtlichen Aufgaben. Das ist gar nicht so wenig, denn immerhin versterben etwa 1.000 Personen pro Jahr außerhalb von Krankenanstalten in Graz.
Simone Koren-Wallis
Das sind ja drei pro Tag, eigentlich.
Eva Winter
Genau, das sind drei pro Tag. Wir haben das im Vorfeld ein bisschen ausgerechnet: Von insgesamt rund 4.000 Personen, die jährlich in Graz versterben, sind etwa 1.000 jene Fälle, bei denen Graz die Menschen erst kennenlernt, wenn ihr Leben zu Ende geht. Die restlichen 3.000 sind tatsächlich Grazerinnen und Grazer, die versterben - davon etwa 1.000 zu Hause oder im Pflegeheim. Und viele wünschen sich, zu Hause zu sterben.
Leider schaffen das nur wenige, obwohl sich das viele wünschen.
Simone Koren-Wallis
Wie geht man als Arzt oder Ärztin damit um? Es ist ja nicht „Ich rette Leben", sondern das Leben ist da vorbei.
Eva Winter
Ja - nur ohne Tod hätte das Leben keinen Wert.
Das gehört irgendwie unmittelbar zusammen. Der Gedanke daran wird im eigenen Leben aber so lange wie möglich nach hinten geschoben. Wir haben auch ein bisschen verlernt, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Wenn man es aufs Behördliche herunterbricht, muss man unterscheiden: Die Todesfeststellung - das macht der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin. Laut gesetzlicher Regelung muss es ein Arzt sein, der den Tod unmittelbar feststellt. Und dann, mit einem gewissen Abstand, anhand sicherer Todeszeichen - so traurig das klingt - wie Totenstarre und Totenflecken, wird festgestellt: Es gibt keinen Weg zurück, das ist endgültig.
Zusätzlich versucht man, die Todesursache zu eruieren - anhand von Befunden, Wahrnehmungen vor Ort und natürlich auch Unterlagen wie Vorbehandlungsergebnissen.
Simone Koren-Wallis
Jetzt sind Sie ja keine Ärztin - was machen Sie mit dem Tod und der Stadt Graz?
Elke Köhler-Strohrigl
Ich bin täglich damit beschäftigt, sämtliche Beschaumeldungen, die von den Bestattungen bei uns eingemeldet werden, weiterzuverarbeiten. Wir haben - ich sage bewusst „wir" - sehr viele Nahtstellen, also intensiven Kontakt zur Polizei, zur Rettung, zur Gerichtsmedizin, zur Anatomie, zur Pathologie und auch zu Versicherungen.
Jeder einzelne Todesfall, den eine Amtsärztin oder ein Amtsarzt untersucht und begutachtet, wird individuell und genau betrachtet und recherchiert.
In diesem Kontext heißt das: möglichst viele Befunde, Vorgeschichten und Informationen zum Verstorbenen einholen, damit die Amtsärztin oder der Amtsarzt die Todesursache entsprechend festlegen kann.
Simone Koren-Wallis
Warum ist es so wichtig, die Todesursache festzustellen? Wird das irgendwo vermerkt? Entschuldigung, das klingt vielleicht blöd - ich bin Gott sei Dank mit dem Thema Tod noch nicht oft in Berührung gekommen.
Elke Köhler-Strohrigl
Bei jedem Verstorbenen werden die sogenannten Totenpapiere - das sind im Wesentlichen vierseitige Formulare - ausgefüllt und erstellt.
Und ja, jeder Mensch, der in Graz verstirbt - ganz egal ob in einer Krankenanstalt, einem Pflege- oder Wohnheim - muss an die Behörde, also an uns im Gesundheitsamt, gemeldet werden. Dabei wird auch die Todesursache übermittelt. Deshalb wissen wir so genau, dass wir jährlich etwa 4.000 Verstorbene in Graz „bearbeiten" - unter Anführungszeichen, bitte.
Eva Winter
Die einfachste Antwort, warum wir die Totenbeschau machen und die Todesursache brauchen, ist: Statistik.
Das klingt nüchtern, aber aus den Zahlen lassen sich Rückschlüsse ziehen. Es ist wichtig zu wissen, wie viele Menschen in Österreich versterben, weil sie geraucht haben, an Krebs erkrankt waren, einen Herzinfarkt hatten oder Risikofaktoren aufwiesen. Daraus lassen sich Strategien für Gesundheitsmaßnahmen entwickeln.
Es gibt aber auch menschlichere Gründe: Wir wollen eine gewisse Qualitätskontrolle. Es kann bei einer Behandlung etwas schiefgelaufen sein, etwas übersehen worden sein - das versuchen wir abzufangen. Und die Angehörigen wollen es wissen. Es gehört zum Abschiednehmen dazu, zu wissen, was den Schlusspunkt gesetzt hat.
Simone Koren-Wallis
Auch wenn Sie täglich damit zu tun haben - gibt es Fälle, die Ihnen besonders nahegehen?
Elke Köhler-Strohrigl
Ja, absolut. Es gibt jeden Tag Schicksale, bei denen man sich denkt: Meine Güte.
Wenn kleine Kinder versterben, wenn junge Menschen versterben - auch bei Selbsttötung stellt sich die Frage: War es wirklich so schlimm? Hätte man nicht doch etwas tun können? Da merke ich schon, dass mich das emotional beschäftigt.
va Winter
Der zweite große Bereich, der uns nicht ganz loslässt, sind die Menschen, die in Einsamkeit sterben - bei denen der Tod erst nach Wochen festgestellt wird. Menschen, die niemandem abgegangen sind, bei denen niemand nachgeschaut hat. Das kommt leider vor. Wir sind ein Ballungsraum, und solche Fälle treten bei uns mit einer Regelmäßigkeit auf, die uns nicht kaltlässt.
Das sind dann meistens auch Menschen, um die sich nach dem Versterben niemand kümmert, bei denen sich niemand zuständig fühlt. Auch das nimmt dann seinen Lauf. Auch hier gibt es gesetzliche Regelungen - wie eigentlich für fast alles, womit wir zu tun haben. In solchen Fällen greift die sogenannte sanitätsbehördliche Bestattung.
Das ist keine anonyme Bestattung, sondern eine, die notwendig ist, weil ja bestattet werden muss. Und wir als Behörde treten in Vorleistung und führen die Bestattung durch.
Simone Koren-Wallis
Wie oft kommt das vor?
Elke Köhler-Strohrigl
In den letzten drei Jahren waren es im Schnitt etwa 55 Fälle pro Jahr. Ich kann aber sagen, dass wir heuer - Stand gestern - bereits bei 87 sind. Im Jahr. Das sind Fälle, die wir bearbeitet haben, weil sich niemand um die Bestattung gekümmert hat.
Es besteht eine gesetzliche Bestattungspflicht. Wir beginnen dann in viele Richtungen zu recherchieren, um vielleicht doch noch Angehörige oder Verwandte zu finden.
Eva Winter
Eine Sozialbestattung ist dann notwendig, wenn kein Geld vorhanden ist.
Da muss ein entsprechender Antrag gestellt werden. Das ist aber ein Prozess, der mit der eigentlichen Bestattung nichts zu tun hat, sondern mit der Finanzierung. Bei uns geht es wirklich darum, dass bestattet werden muss - unabhängig von der finanziellen Situation.
Simone Koren-Wallis
Und wie oft - weil Sie das vorhin angesprochen haben - kommt es vor, dass Menschen einfach alleine sterben und man erst Wochen später davon erfährt? Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke. Wie viele Fälle gibt es da in Graz?
Eva Winter
Ich würde sagen: Sicher im zweistelligen Bereich pro Jahr - auf jeden Fall.
Elke Köhler-Strohrigl
Ich kann Ihnen keine exakte Zahl nennen, aber vor allem in den letzten Wochen habe ich das Gefühl, dass wir pro Woche mindestens einen verstorbenen Menschen auffinden.
Simone Koren-Wallis
Der schon länger verstorben ist?
Eva Winter
Ja, wir reden von Wochen, in denen der Verstorbene niemandem abgegangen ist.
Simone Koren-Wallis
Ich bin ganz baff - es gibt doch Nachbarn.
Elke Köhler-Strohrigl
Es gibt durchaus Situationen, in denen eine Nachbarschaft vorhanden ist. Da sagt dann zum Beispiel eine Nachbarin: „Wir hatten regelmäßig Kontakt, aber ich habe seit fünf oder sieben Tagen nichts mehr gehört." Es gibt aber auch viele Fälle, in denen die Polizei von Nachbarn kontaktiert wird - wegen eines intensiven Geruchs, einer Geruchsbelästigung oder dem vermehrten Auftreten von Insekten. Tut mir leid, aber das ist wirklich so.
Simone Koren-Wallis
Ich glaube, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich denke, jeder von uns kann sich an der Nase nehmen und sagen: „Ich schaue vielleicht ein bisschen mehr auf meine Nachbarn."
Eva Winter
Das ist sicher eine Folge unserer gesellschaftlichen Entwicklung.
Es sind oft Menschen, die keine Kinder haben oder keinen Kontakt zu ihnen. Oder die Kinder leben irgendwo auf der Welt verstreut. Man muss sich selbst an der Nase nehmen: Wie lange hat man seine Liebsten schon nicht mehr kontaktiert?
Simone Koren-Wallis
Wenn jemand diesen Podcast hört und sich nur deswegen denkt: „Hey, ich rufe jetzt wieder einmal meine Tante an, meinen Großonkel, keine Ahnung" - dann haben wir Graz schon ein Stück besser gemacht, oder?
Eva Winter
Ja, genau. Wenn es dazu führt, freuen wir uns. Und es ist ja auch etwas Schönes, wieder einmal mit den eigenen nahestehenden Personen zu sprechen, oder?
🎵 Jingle - Graz, die Stadt meines Lebens
Simone Koren-Wallis
Von Frau Doktor Winter zur Jahreszeit Winter - denn in der nächsten Folge dreht sich alles um den Winter in Graz. Wir hören uns. Ich freue mich.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 57: Über den Tod, Begräbnisse und die Bestattung Graz
Keiner von uns will wahrscheinlich an das denken: aber was man eigentlich, wenn jemand aus der Familie stirbt, also im Trauerfall? Wir sprechen jetzt kurz vor Allerheiligen mit Gregor Zaki von der Bestattung Graz über den letzten Weg eines Menschen - über die verschiedenen Möglichkeiten, die Kosten und die Arbeit der Bestatter:innen.
🎵 Jingle / Simone Koren-Wallis
Irgendwie will natürlich kaum jemand daran denken. Aber was macht man eigentlich, wenn jemand aus der Familie stirbt?
Wir sprechen heute - so kurz vor Allerheiligen - über den Tod, über Begräbnisse und über die Grazer Bestattung. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast heute: Gregor Zaki.
Gregor Zaki
Mein Name ist Gregor Zaki. Ich leite in der Holding Graz den kommunalen Bereich Bestattung, Friedhof und Feuerhalle.
🎵 Jingle
Simone Koren-Wallis
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist das natürlich ein extremer Einschnitt im Leben der Hinterbliebenen - der Familie, der Freunde. Und ich muss ganz ehrlich gestehen: Ich kann mit dem Tod ganz, ganz schwer umgehen.
Aber heute sprechen wir darüber. Denn ihr habt tagtäglich damit zu tun. Lieber Herr Zaki, was bedeutet für Sie persönlich der Tod?
Gregor Zaki
Na ja, das kommt darauf an, wie man sich der Thematik nähert. Für Gläubige ist es Wiedergeburt, für nüchterne Betrachter das Ende von allem - für manche nur eine Zwischenstufe.
Der Tod ist sicher eines der großen Themen der Menschheit - wie Macht und Liebe. Er ist ein unvermeidbares, unausweichliches Ereignis, das jeden betrifft und mit dem jeder irgendwie umgehen muss. Aber jeder tut das auf seine eigene Weise.
Simone Koren-Wallis
Ihr habt ja wirklich täglich mit Trauer zu tun. Wie gehen Sie - und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - damit um?
Gregor Zaki
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht nur hervorragend geschult, sondern brauchen auch ein gewisses Gespür - ich würde fast sagen: eine Berufung.
Denn sie verbringen ihre gesamte Dienstzeit damit, in Tränen zu blicken, Trauer zu sehen - acht Stunden lang. Und das muss man irgendwie verarbeiten.
Ein Rezept dafür ist sicher, die persönliche Betroffenheit nicht zu nahe an sich heranzulassen, aber dennoch den Willen zu haben, dem Gegenüber zu helfen, ihn zu begleiten, die Trauer zu lindern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht nur Unternehmer, Verkäufer oder Organisatoren für Begräbnisse - sie sind oft auch Seelsorger, Psychologen, Therapeuten.
Das zeigt sich auch darin, dass so ein Gespräch, die Organisation einer Verabschiedung oder eines Begräbnisses, oft zwei Stunden dauert. Warum? Weil die Menschen in dieser Ausnahmesituation Zeit brauchen. Da wird nicht nur schnell eine Anzeige aufgegeben oder ein Begräbnis organisiert - mit oder ohne Pfarrer, mit oder ohne Parte. Die Angehörigen erzählen vom letzten Urlaub, von schönen Erinnerungen, von besonderen Momenten mit dem Verstorbenen.
Da muss man gut zuhören und die richtigen Worte finden. Meistens muss man gar nicht viel sagen - aber es tut den Hinterbliebenen gut, jemanden zu haben, mit dem sie im ersten Moment des Verlusts sprechen können.
Simone Koren-Wallis
Und genau das ist es ja: Ihr macht irgendwie alles rund um den Tod.
Gregor Zaki
Ja, wir sagen auch - das ist ein Werbespruch von uns: „Wir kümmern uns um alles. Sie kümmern sich um Ihre Lieben."
Denn in der Trauer hat man oft gar nicht den Kopf für all die Dinge, die notwendig sind. Zum Beispiel: die Beurkundung des Todes, Sterbeurkunden, Parte schalten, Floristik - will man eine Sargdecke aus Blumen oder einen Kranz? Will man Sterbebilder machen, ein Foto aufstellen? Behördenwege?
Das alles bieten wir als Dienstleistung an. Denn man kann den Angehörigen nicht einfach sagen: „Gehen Sie dorthin, da machen Sie die Parte. Dann zur Druckerei, da lassen Sie die Bücher drucken." Das ist unser Gesamtdienstleistungspaket der Bestattung.
Und dafür braucht es viel Erfahrung, viel Empathie und das Gespür dafür, was die Hinterbliebenen wirklich brauchen.
Simone Koren-Wallis
Gott sei Dank - ich klopfe auf Holz - habe ich noch keine persönliche Erfahrung damit. Aber was kostet so etwas eigentlich, wenn man ein Begräbnis organisieren muss?
Gregor Zaki
Die Kosten für ein Begräbnis liegen im Schnitt zwischen 3.000 und 5.000 Euro - für eine schöne, größere Bestattung. Aber ich antworte auf diese Frage gerne mit einer Gegenfrage: Was kostet ein Auto? Fahren Sie einen Ford, einen Kia oder einen Bentley? Einen Jaguar oder einen Opel?
Und genauso ist es bei einer Bestattung: Was will ich? Welche Ausstattung wünsche ich mir? Habe ich einen Gruftsarg aus Metall, eine polierte Eiche massiv oder einen schlichten Sarg? Möchte ich eine ganzseitige Parte oder nur eine kleine Anzeige? Das alles beeinflusst die Rechnung.
Wobei ich dazu sagen möchte: Die Bestattungskosten sind bei der Bestattung zu entrichten. Wer ein Begräbnis bestellt, bezahlt die Bestattung. Aber in den meisten Fällen macht die eigentliche Bestattungsdienstleistung nur etwa die Hälfte der Gesamtkosten aus.
Die Rechnung wird größer, weil alle Positionen zusammenkommen - wir sind ja ein Dienstleister im Sinne eines One-Stop-Shops. Wir organisieren den Kranz, das Sarggesteck - das ist keine Bestatterleistung, aber wir sorgen dafür, dass es da ist. Wir gestalten und schalten die Parte in der Zeitung. Wir organisieren den Totengräber auf kirchlichen Friedhöfen. Die Gebühren dafür stehen auf der Rechnung: Totengräber, Parte, Kranz - ob groß oder klein, ein Gesteck um 200 Euro - das alles wird aufgeführt.
Aber daran verdienen wir nichts. Das sind Nebenleistungen, die wir organisieren. Die eigentlichen Bestattungsdienstleistungen - wie Überführung, Sarg, Aufbahrung, Träger - die sind natürlich zu bezahlen.
Am Ende ergibt sich eine große Rechnung, und dann heißt es oft: „Sterben ist teuer, die Bestatter verdienen sich eine goldene Nase." Aber das stimmt so nicht. Es sind die Eigenleistungen der Bestattung und die Nebenleistungen, die zusammenkommen. Selbst die 9,80 Euro für eine Sterbeurkunde stehen auf der Rechnung - wir holen sie, übergeben sie den Hinterbliebenen, aber das ist keine Bestattungsleistung im engeren Sinn.
Die Grazer Bestattung ist ein kommunales Unternehmen und muss natürlich auch unternehmerisch denken. Aber wir haben geschultes, fest angestelltes Personal - keine Aushilfen oder, nicht böse gemeint, Studenten, die gerade Zeit haben. Unsere Träger sind geschult, unser Abholdienst ist geschult, unsere Aufnahmemitarbeiter sind geschult.
Und was die Grazer Bestattung als kommunales Unternehmen einnimmt, fließt zurück in die Stadt - in die Erneuerung des Urnenfriedhofs, in die Instandhaltung der Öfen und der Halle.
Simone Koren-Wallis
Gibt es eigentlich Begräbnisse, die Ihnen und Ihrem Team besonders in Erinnerung bleiben - weil sie etwas ganz Besonderes waren? Gibt es solche „Sonderthemen", die einfach hängen bleiben?
Gregor Zaki
Ja, oft steckt dahinter der Wunsch, der Persönlichkeit des Verstorbenen gerecht zu werden. Wie hat er gelebt - und wie können wir das in der Abschiednahme, in der Aufbahrung darstellen?
Da kann es durchaus sein, dass eine Harley-Davidson in der Aufbahrungshalle steht. Oder dass jemand gerne am Meer war und getaucht ist - dann liegt eine Pressluftflasche und ein Taucheranzug beim Sarg. Oder es wird mit Rasenziegeln ein schönes Green ausgelegt und ein Golfbag daneben gestellt, weil der Verstorbene gerne Golf gespielt hat.
Die Hinterbliebenen versuchen oft, in schöner Form zu zeigen, was der Verstorbene geliebt hat - und wir setzen das dann um.
Simone Koren-Wallis
Gibt es etwas, das Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Gregor Zaki
Ja, zum Beispiel die Gestaltung einer Trauerfeier. Denn Trauer und Schwarz sind für viele Menschen nicht unbedingt der Ausdruck von Abschied.
Manchmal steht in der Parte sogar: „In fröhlicher Alltagskleidung."
Ein Fall ist mir besonders erinnerlich: Ein junger Mensch war verstorben. Wir mussten unseren Zeremoniensaal komplett ausräumen - also die Bestuhlung entfernen. Dann wurden Teppiche und Decken ausgelegt, und die ganze Trauergemeinde - darunter viele Kinder - hat Spielsachen mitgebracht. Sie saßen am Boden, neben dem aufgebahrten Sarg.
Der Verstorbene war dabei, aber es gab keine traurigen Reden oder Musik. Die Kinder haben gespielt, die Leute haben musiziert, gejausnet - und so über mehrere Stunden Abschied genommen. Das war sehr beeindruckend und für mich auch völlig neu.
Simone Koren-Wallis
Ist es eigentlich erlaubt, die Asche eines Verstorbenen irgendwo zu verstreuen - bei uns?
Gregor Zaki
Naturbestattungen - also die Bestattung in einem Waldstück oder das Verstreuen der Asche in einem Fluss - sind bei uns möglich. Die gesetzlichen Regelungen orientieren sich zunehmend an den Wünschen der Menschen.
Grundsätzlich sind Erd- und Feuerbestattung die erlaubten Formen. Das heißt: Entweder wird der Sarg auf einem Friedhof beigesetzt oder - nach einer Feuerbestattung - die Urne.
Die Asche kann auch auf einem Friedhof verstreut werden. Es ist möglich, die Urne mit nach Hause zu nehmen oder eine kleine Menge der Asche zu entnehmen - für Gedenkzwecke, etwa in einem Ring oder Amulett.
Viele erkundigen sich auch nach besonderen Formen: Die Asche zu einem Diamanten pressen oder ins All schicken. Dabei wird nicht der ganze Leichnam oder die Urne ins All geschossen, sondern eine winzige Menge der Asche - im Milligramm-Bereich - in einer Phiole, die mit einem Satelliten ins All fliegt.
Das nennt man dann Weltallbestattung - ein kleiner Teil der sterblichen Überreste befindet sich im Weltall.
Simone Koren-Wallis
Wir bleiben auch in der nächsten Folge bei der Thematik. Da stelle ich nämlich die spannende Frage: Was macht die Stadt Graz eigentlich mit den Toten?
Wir hören uns - ich freue mich.
🎵 Jingle - Graz, die Stadt meines Lebens
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 56: Pilze richtig sammeln und bestimmen
Das Universalmuseum Joanneum veranstaltet gemeinsam mit der Waldschule der Stadt Graz Pilzseminare. Da denken viele an Steinpilz oder Eierschwammerl. Aber: es gibt weitere vorzügliche Pilze für den Kochtopf, allerdings sind auch einige ungenießbar, andere giftig oder sogar tödlich. Gemeinsam mit Uwe Kozina, Michaela & Gernot Friebes wird versucht, Pilze zu finden, sie zu bestimmen, aber auch ihre Rolle in den Wäldern zu erörtern.
🎵 Jingle
Simone Koren-Wallis
Pilze richtig sammeln und bestimmen - ich bin heute mit dabei bei einem spannenden Pilztag mit fachkundiger Betreuung. Mein Name ist Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation, und ich bin zu Gast bei Michaela und Gernot Friebes sowie Uwe Kozina.
Michaela Friebes
Hallo, ich bin Michaela Friebes, Waldpädagogin bei der Stadt Graz.
Uwe Kozina
Ja hallo, ich bin Uwe Kozina, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Universalmuseum Joanneum beim Arbeitskreis „Heimische Pilze".
Gernot Friebes
Hallo, ich bin Gernot Friebes, arbeite am Universalmuseum Joanneum und bin für den pilzkundlichen Teil unserer wissenschaftlichen Sammlung zuständig.
🎵 Jingle
Simone Koren-Wallis
So, wir sind mitten in einem Grazer Stadtwaldgebiet. Liebe Michaela, bei den Pilzwanderungen der Stadt Graz und des Joanneums - die Meute ist schon ausgeströmt. Um was geht es jetzt eigentlich genau?
Michaela Friebes
Also bei unseren Veranstaltungen geht es nicht nur darum, Speisepilze zu sammeln. Wir möchten den Leuten die Vielfalt der Pilze näherbringen, ihre Bedeutung in der Natur - und dass sie genauer hinschauen. Auch auf das Kleine.
Es gibt so viele kleine Pilze, und wir wollen, dass die Teilnehmer lernen, Pilze wirklich genau zu betrachten. Dass sie sie aus der Erde holen - denn um einen Pilz zu bestimmen, braucht man den ganzen Pilz, also bis zum Myzel. Der eigentliche Pilz ist ja unter der Erde - diese feinen Fäden. Wir ernten nur die Fruchtkörper.
Und dann bringen die Teilnehmer ihre Funde zurück, die werden aufgelegt und gemeinsam besprochen. Ganz wichtig ist uns: Es geht nicht nur ums Essen.
Simone Koren-Wallis
Sondern auch ums Entdecken - und darum, was es alles im Wald zu sehen gibt.
Michaela Friebes
Genau.
Simone Koren-Wallis
Der Gernot ist schon unterwegs. Gernot, hast du schon was gefunden?
Gernot Friebes
Noch nicht.
Simone Koren-Wallis
Du machst das ja wirklich schon lange - du bist eigentlich seit deiner Kindheit ein Pilzfan. Warum sind die Pilzwanderungen für dich so wichtig?
Gernot Friebes
Es ist uns ein großes Anliegen, die Welt der Pilze - die ja unglaublich vielfältig ist - den Menschen näherzubringen. Und auch auf die verborgenen Aspekte hinzuweisen.
Viele Arten nimmt man mit einem untrainierten Auge gar nicht wahr. Und die Ökologie der Pilze spielt sich im Verborgenen ab - unter der Erde oder im Holz. Pilze übernehmen ökologische Rollen von enormer Bedeutung. Und darauf wollen wir aufmerksam machen - damit die Leute das wahrnehmen und schätzen lernen.
Simone Koren-Wallis
Was genau macht Pilze so wichtig?
Gernot Friebes
Viele Pilze leben in Symbiose mit Pflanzen - das ist besonders für unsere Wälder wichtig. Andere Pilze zersetzen totes organisches Material, wie abgestorbene Bäume, Laubstreu oder Nadelstreu. Sie machen die Nährstoffe wieder verfügbar für andere Organismen.
Und es gibt auch parasitische Pilze - die sind für uns Menschen oft weniger angenehm, aber sie haben ebenfalls eine wichtige Rolle im Ökosystem.
Simone Koren-Wallis
Gut, dann marschieren wir mal los. Schon was entdeckt?
Gernot Friebes
Ja!
Simone Koren-Wallis
Ja? Auf einem Ast oben?
Gernot Friebes
Genau. Das ist ein Schwindling. Die sitzen in der Streu - auf Laubstreu oder dünnen Laubholzästen. Und in diesem Fall haben wir eine ganz charakteristische Art. Wenn man daran riecht, nimmt man einen intensiven Knoblauchgeruch wahr.
Simone Koren-Wallis
Darf ich mal probieren?
Gernot Friebes
Gerne.
Simone Koren-Wallis
Wow! Bist du narrisch. Der ist aber nicht verzehrbar, oder?
Gernot Friebes
Das ist der langstielige oder seitenstielige Knoblauchschwindling. Der kann in kleinen Mengen als Würzpilz verwendet werden. In größeren Mengen kann er allerdings leicht magendarmgiftig wirken. Also eher nicht zu empfehlen - im Gegensatz zu seinem kleineren Bruder, dem echten Knoblauchschwindling.
Simone Koren-Wallis
Aha, es gibt also noch einen kleineren - und den kann man essen. Das ist ja voll kompliziert, oder? Hast du dich schon mal bei einem Pilz getäuscht? Sei ehrlich.
Gernot Friebes
Also eine Vergiftung ist mir zum Glück noch nie passiert - und ich hoffe, das bleibt auch so.
Simone Koren-Wallis
Vor allem du als Profi - das wäre wichtig, gell? Wie oft kommt es denn vor, dass jemand einen Pilz isst, den er besser nicht gegessen hätte?
Gernot Friebes
Leider passiert das öfter, als man sich wünschen würde. Man hört natürlich nicht von jeder Vergiftung. Manche Fälle sind dann in den Medien sehr präsent - etwa beim grünen Knollenblätterpilz, da gibt es leider immer wieder auch tödlich verlaufende Vergiftungen.
Das Einzige, was davor schützt, ist, dass man Speisepilze - und ihre Doppelgänger - wirklich hundertprozentig sicher kennt.
Simone Koren-Wallis
Der, der am häufigsten verwechselt wird, ist wahrscheinlich eh der Knollenblätterpilz, oder?
Gernot Friebes
Der grüne Knollenblätterpilz ist für etwa 90 Prozent aller tödlich verlaufenden Pilzvergiftungen verantwortlich. Es kann aber auch sein, dass andere Arten - die zwar nicht tödlich, aber magendarmgiftig sind - häufiger verwechselt werden. Davon hört man allerdings weniger.
Michaela Friebes
Das Spannende ist ja, dass Pilze nicht nur toll aussehen, sondern auch riechen! Die Vielfalt der Farben und Gerüche ist faszinierend. Und das noch Spannendere: Man kann sie nicht immer nach Lehrbuch bestimmen. Viele Pilze halten sich einfach nicht daran.
Simone Koren-Wallis
Die Pilze halten sich nicht ans Lehrbuch?
Michaela Friebes
Genau - sie sehen oft ganz anders aus, als sie laut Lehrbuch aussehen sollten.
Simone Koren-Wallis
Hier liegen ganz viele Äste herum - auch vom letzten Sturm. Und da sind schon Pilze drauf. Was ist das?
Gernot Friebes
Da sieht man sehr gut, wie wichtig Totholz im Wald für die Artenvielfalt ist - besonders für Pilze. Denn eine zentrale Aufgabe vieler Pilzarten ist es, dieses Totholz zu zersetzen.
Simone Koren-Wallis
Wie lange dauert das?
Gernot Friebes
Das ist ganz unterschiedlich. Manche Pilzarten können jahrzehntelang auf einem Baumstamm wachsen. Bei anderen geht es schneller. Es hängt auch davon ab, wie dick das Holz ist. In manchen Fällen ist es nach ein paar Jahren so weit zersetzt, dass man es kaum noch als Holz erkennt.
Simone Koren-Wallis
Wahnsinn, was Pilze alles leisten! Heuer ist das Pilzjahr aber nicht so gut, oder? Erst der heiße Sommer, dann plötzlich viel Regen?
Gernot Friebes
Ja, das heurige Pilzjahr hat im Frühsommer eigentlich gut begonnen - warm und feucht. Aber die lange Hitzeperiode im Sommer hat dazu geführt, dass viele Pilze momentan gar nicht fruktifizieren. Ob sich das im Herbst noch einmal erholt, wird man sehen. Das hängt von der weiteren Witterung ab. Aber es ist durchaus möglich, dass einige beliebte Speisepilze und andere Arten noch einmal Fruchtkörper ausbilden.
Simone Koren-Wallis
Hoffentlich! Wie viele Pilzarten gibt es eigentlich - kann man das sagen?
Gernot Friebes
In Österreich sind etwa 5.000 Großpilzarten bekannt - und noch deutlich mehr Kleinpilze, wie Schimmelpilze, die man mit freiem Auge oft gar nicht mehr wahrnimmt. Und es gibt noch viel zu entdecken - viele Arten sind noch gar nicht bekannt.
Simone Koren-Wallis
Aber du kennst alle 5.000?
Gernot Friebes
Niemand kennt alle 5.000 - aber ich gebe mein Bestes.
Simone Koren-Wallis
Für alle, die jetzt demnächst Pilze sammeln gehen: Was ist wichtig beim Abschneiden? Wenn ich mir sicher bin, das ist ein Steinpilz - muss ich da etwas beachten?
Gernot Friebes
Wenn man sich wirklich hundertprozentig sicher ist, dass es ein Speisepilz ist, kann man ihn ruhig abschneiden. Es ist dann egal, ob man ihn abschneidet oder herausdreht.
Ich sage nur immer: Wenn man zum Beispiel einen dicken Steinpilz herausdreht, bleibt oft ein kleines Loch im Boden zurück. Das sollte man wieder zumachen, damit das Myzel nicht austrocknet.
Anders ist es bei Pilzen, die man nicht kennt. Da ist es wichtig, sie mit allen möglichen Merkmalen zu sammeln - besonders an der Stielbasis, also ganz unten, wo der Stiel in der Erde steckt. Dort befinden sich oft entscheidende Bestimmungsmerkmale.
Denkt man nur an den grünen Knollenblätterpilz - der hat unten eine häutige Scheide. Wenn man den Pilz abschneidet, fehlt dieses wichtige Merkmal. Und das kann zu schweren Vergiftungen führen.
Simone Koren-Wallis
Aber hat es nicht früher einmal geheißen, dass man Pilze nur oben abschneiden soll, damit sie im nächsten Jahr wieder wachsen? Oder ist das völliger Humbug?
Gernot Friebes
Das ist tatsächlich völlig egal. Im Wald kommt es ja auch vor, dass Wildtiere - zum Beispiel Rehe - den Hut oder den ganzen Pilz abknabbern. Da bleiben dann unterschiedlich große Fruchtkörperstücke zurück.
Grundsätzlich wachsen Pilze ja nicht, damit wir sie sammeln, sondern um ihre Sporen zu verbreiten. Der Fruchtkörper würde ohnehin irgendwann verfallen oder gefressen werden. Deshalb ist es im Prinzip egal, ob man ihn abschneidet oder herausdreht.
Simone Koren-Wallis
Und wenn sie heuer hoffentlich doch noch ordentlich sprießen - wie viel darf man pro Person sammeln?
Michaela Friebes
Zwei Kilo pro Tag und Person.
Simone Koren-Wallis
Und daran sollte man sich auch halten. Es hat ja einen Grund, warum das so geregelt ist.
Michaela Friebes
Genau. Es geht nicht darum, dass man den Wald ausraubt - aber die Pilze gehören einem einfach nicht. Man schädigt den Wald nicht, wenn man die Fruchtkörper nimmt, denn der eigentliche Pilz - das Myzel - bleibt ja im Boden.
Aber es geht um Maß und Respekt. Wenn man große Mengen sammelt, ist das schon kommerziell. Man sollte für den Eigenbedarf sammeln und sich bewusst machen: Das ist Natur. Und wer die Leidenschaft hat, in den Wald zu gehen und Pilze zu sammeln, sollte diese Natur auch wertschätzen.
Simone Koren-Wallis
So, Uwe - wir sind zurück im Häuschen im Wald. Du schaust schon, bestimmst schon. Was sagst du zur Ausbeute?
Uwe Kozina
Leider nicht besonders artenreich. Es sind viele Holzbewohner dabei, beziehungsweise Bewohner der Streuschicht. Mykorrhiza-Pilze - also jene, die in Lebensgemeinschaft mit Gehölzen leben - sind kaum dabei.
Aber wir schauen, was noch kommt. Ein paar Leute sind da, ein bisschen was sehe ich schon - auch interessante Arten. Für die Ausstellung habe ich schon ein paar Bildkarten aufgelegt von Arten, von denen ich erwarte, dass sie heute nicht gefunden werden.
Simone Koren-Wallis
Was bedeutet das eigentlich, wenn heute nicht so viel gefunden wird? Ist das ein Alarmsignal für den Wald? Wir haben ja heute gelernt, dass Pilze in Symbiose mit Bäumen leben.
Uwe Kozina
Nein, im Moment nicht. Das liegt eher am heißen und trockenen Sommer. Das Pilzmyzel hat das Wachstum eingestellt - und das braucht Zeit, um sich zu regenerieren. Es braucht Wärme und Feuchtigkeit. Erst dann können die Pilze wieder Fruchtkörper bilden - also die Schwammerl, die wir finden.
Wenn es jetzt halbwegs feucht bleibt - warm ist es ja noch - dann werden wir vielleicht in ein bis zwei Wochen wieder mehr finden.
Simone Koren-Wallis
Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, einmal dabei zu sein - es gibt im Oktober noch Termine?
Uwe Kozina
Ja, genau. Drei Termine stehen noch an:
- Noch einmal dieses Seminar hier im Häuschen im Wald, am 16. Oktober.
- Dann zwei Wanderungen: Am 21. Oktober auf den Atmonterkogel bei St. Veit.
- Und am 23. Oktober in der Nähe der Sternwarte am Lustbühel.
Da gehen wir ganz niederschwellig gemeinsam in den Wald. Ich bringe eine Decke mit, auf der die Funde besprochen werden - direkt draußen. Es gibt keine Ausstellung, sondern wir gehen gemeinsam los, kommen zurück, legen die Pilze auf und besprechen sie vor Ort.
Simone Koren-Wallis
Alle Infos gibt's natürlich auch online unter www.graz.at - einfach nach „Waldschule" oder „Pilzwanderung" suchen.
Und wer im Herbst Pilze sammeln geht und sich bei einem Fund nicht ganz sicher ist, ob man ihn essen kann oder nicht: Es gibt Pilzberatungen in Graz - einerseits im Universalmuseum Joanneum bei Gernot Friebes, andererseits bei der Stadt Graz im Gesundheitsamt, im Referat für Lebensmittelsicherheit und Märkte. Dort gibt es bis November immer montags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr in der Lagergasse die Möglichkeit zur Beratung.
In der nächsten Folge sprechen wir über den Tod - ich besuche nämlich die Grazer Bestattung.
Wir hören uns - ich freue mich.
🎵 Jingle - Graz, die Stadt meines Lebens
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 55: Zum Tag der Demenz - rund ums Vergessen
Am 21. September war Tag der Demenz. Darum dreht sich in dieser Folge des Stadt Graz Podcasts alles rund ums Vergessen und darum, Demenz besser zu verstehen. Eva Wallack, Brigitte Eisel und Marion Schaffernak von den GGZ der Stadt Graz zeigen auf, welche Einrichtungen es gibt und was Angehörige von Demenzkranken wissen müssen.
🎵 Jingle
Simone Koren-Wallis
Am 21. September war der Tag der Demenz - deshalb dreht sich heute alles ums Vergessen. Es geht darum, Demenz besser zu verstehen und auch ein bisschen aufzuzeigen, welche Einrichtungen die GGZ - die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz - für Betroffene und Angehörige bieten.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste heute: Eva Wallack, Brigitte Eisel und Marion Schaffernak.
Marion Schaffernak
Mein Name ist Marion Schaffernak. Ich leite das Memory-Tageszentrum am Rosenhain, eine Einrichtung der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz.
Brigitte Eisel
Mein Name ist Brigitte Eisel, ich bin Pflegeassistentin in der Albert-Schweitzer-Klinik, in der Memoryklinik.
Eva Wallack
Eva Wallack - ich bin Neurologin und Geriaterin in der Albert-Schweitzer-Klinik. Ich behandle Menschen mit Demenz in der Gedächtnisambulanz und in der Memoryklinik.
🎵 Jingle
Simone Koren-Wallis
Liebe Frau Doktor - was ist eigentlich Demenz?
Eva Wallack
Demenz ist ein Überbegriff für verschiedene Erkrankungen. Die bekannteste ist die Alzheimer-Demenz - sie macht etwa 60 % aller Fälle aus. Dann gibt es vaskuläre Demenzen, die durch Gefäßerkrankungen entstehen, Demenzen im Zusammenhang mit Parkinson, frontotemporale Demenzen - also solche, die das Stirnhirn betreffen - und sogenannte sekundäre Demenzen. Bei letzteren liegt eine andere Erkrankung zugrunde, etwa ein Hirntumor, ein Schädel-Hirn-Trauma oder eine Blutung.
Man muss also verschiedene Organsysteme und das Gehirn genau untersuchen, um eine Demenz zu diagnostizieren.
Was die meisten unter Demenz verstehen, ist Vergesslichkeit. Und ja, Gedächtnisdefizite sind das Hauptsymptom der Alzheimer-Demenz. Aber es ist nicht das einzige. Es kommen sogenannte kognitive Störungen dazu - zum Beispiel Sprachstörungen, Wahrnehmungsstörungen oder Orientierungsprobleme. Wenn Menschen nicht mehr nach Hause finden, Wörter nicht mehr finden oder nicht mehr wissen, wie man kocht - das sind Hinweise auf eine Demenz.
Diese Veränderungen müssen über längere Zeit bestehen. Sonst spricht man von einem Verwirrtheitszustand - etwa bei hohem Fieber. Der geht aber wieder vorbei. Eine Demenz ist hingegen chronisch und fortschreitend. Wir sehen unsere Patientinnen und Patienten regelmäßig - etwa alle sechs Monate - und beobachten, ob sich etwas verändert hat. Dieser zeitliche Verlauf ist wichtig für die Diagnose.
Simone Koren-Wallis
Wie viele Menschen sind in Österreich davon betroffen?
Eva Wallack
In Österreich sind es derzeit etwa 130.000 bis 150.000 Menschen. Da wir aber immer älter werden, rechnen wir bis 2050 mit rund 250.000 Demenzbetroffenen in Österreich - und etwa 35.000 in der Steiermark.
Das ist eine sehr große Zahl. Deshalb wird Demenz häufiger werden, wir werden öfter damit konfrontiert sein - und wir sollten im Alltag mehr Normalität im Umgang mit der Erkrankung entwickeln. Es ist gut, wenn viele Menschen darüber Bescheid wissen.
Simone Koren-Wallis
Deshalb finde ich es so großartig, liebe Frau Eisel, dass Sie Angehörige schulen. Denn im ersten Moment denkt man ja gar nicht daran, dass es Demenz sein könnte - bei der eigenen Mutter, dem Vater oder jemand anderem. Gibt es etwas, worauf man achten sollte?
Brigitte Eisel
Wenn sich das Verhalten verändert. Zum Beispiel: Eine Frau, die früher täglich gekocht hat, verändert plötzlich ihren Kochstil. Es ist weniger im Kühlschrank, es werden Fertiggerichte gekauft - oder der Kühlschrank ist fast leer.
Auch die Kleidung verändert sich: Menschen kleiden sich nicht mehr der Jahreszeit entsprechend. Sie gehen bei Kälte mit kurzen Ärmeln hinaus, das Kälteempfinden verändert sich. Männer, die sich früher täglich rasiert und mit Anzug und Krawatte gekleidet haben, sind plötzlich ganz leger und rasieren sich nicht mehr. Sie kümmern sich nicht mehr um sich selbst - das sind Warnzeichen.
Eva Wallack
Im weiteren Verlauf kann es auch zu Sprachstörungen kommen - bis hin zum Sprachzerfall. Anfangs sind es Wortfindungsstörungen, später können sich Betroffene gar nicht mehr sprachlich ausdrücken.
Demenz beginnt irgendwo im Gehirn und breitet sich mit der Zeit aus - verschiedene Bereiche sind betroffen.
Simone Koren-Wallis
Die Stadt Graz und die GGZ machen wirklich viel. Es gibt verschiedene Einrichtungen - wir sind heute im Memory-Tageszentrum. Aber vielleicht erklären wir zuerst, was das genau ist.
Marion Schaffernak
Wir betreuen derzeit 34 Tagesgäste - 15 davon können täglich zu uns kommen. Unsere Öffnungszeiten sind von 8 bis 17 Uhr.
Menschen mit Demenz werden bei uns begleitet. Sie bekommen drei Mahlzeiten, dazwischen gibt es Aktivierungen - aber auch Ruhephasen. Denn Menschen mit Demenz brauchen beides: Aktivität und Entspannung.
Wir bieten Gruppenprogramme an - zwei bis drei Gruppen gleichzeitig. Dabei achten wir darauf, dass die Gruppen sowohl kognitiv als auch emotional gut zusammenpassen. Es geht nicht nur um Fähigkeiten, sondern auch darum, dass sich die Menschen in der Gruppe wohlfühlen.
Simone Koren-Wallis
Es gibt aber noch viel mehr in den GGZ. Frau Doktor, vielleicht können Sie das kurz erklären?
Eva Wallack
Wir arbeiten mit einem sogenannten abgestuften Versorgungssystem. Das bedeutet: Wir möchten die Patientinnen und Patienten dort abholen, wo die Demenz beginnt - in der Gedächtnisambulanz. Dort kommen Menschen mit einem Demenzverdacht zu uns, und wir stellen die Diagnose.
Dann gibt es die Memoryklinik. Dort betreuen wir Patientinnen und Patienten, die aufgrund ihrer Demenz verhaltensauffällig sind und deshalb weder zu Hause noch im Altersheim betreut werden können - oder die einen so hohen medizinischen Bedarf haben, dass eine stationäre Versorgung notwendig ist.
Und schließlich begleiten wir auch Menschen mit fortgeschrittener Demenz, die sich bereits in einer palliativen Situation befinden. Unser Ziel ist es, die Betroffenen über die gesamte Dauer ihrer Erkrankung zu begleiten.
Dabei setzen wir auf nichtmedikamentöse Maßnahmen - zum Beispiel Validation, also die Methode, Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Dazu kommen ergotherapeutische, physiotherapeutische und logopädische Angebote.
Es ist eine sehr herausfordernde Situation, wenn man mit jemandem lebt, der sich durch die Demenz verändert - der nicht mehr der Mensch ist, der er einmal war. Deshalb ist es wichtig, die Angehörigen gut zu begleiten und gleichzeitig dem Betroffenen zu ermöglichen, seine Fähigkeiten zu erhalten. Wir wollen Selbstvertrauen und Autonomie stärken - so weit es eben noch möglich ist.
Simone Koren-Wallis
Aber wie macht man das konkret?
Brigitte Eisel
Wichtig ist die Stärkung der Alltagsfähigkeiten - zum Beispiel beim Waschen und Anziehen. Man kann den Betroffenen unterstützen, indem man die Kleidung so hinlegt, wie sie angezogen werden soll. So fördert man die Selbstständigkeit und muss nicht in den Intimbereich eingreifen.
Musik spielt ebenfalls eine große Rolle. Wenn man zum Beispiel mittags die Glocken läutet, kann das bei schwer dementen Menschen etwas auslösen - sie verbinden das mit „Jetzt ist Essenszeit".
Auch die Milieuadaptierung zu Hause ist wichtig - also die Förderung der Orientierung. Man kann Türen beschriften, damit die Betroffenen selbst das WC oder die Küche finden. Schränke und Kommoden kann man ebenfalls beschriften - damit sie wissen, wo die Wäsche oder die Gläser sind. Das fördert die Selbstständigkeit.
Man sollte auch auf die Akustik achten. Ein ständig laufender Fernseher oder Radio kann überfordern. Ein geregelter Tagesablauf - wann wird gefrühstückt, wann gewaschen, wann gegessen - hilft sehr. Und eine überschaubare, stressfreie, aber auch anregende Umgebung ist besonders wichtig für Menschen, die sich zurückziehen. Sie brauchen Impulse, um wieder Sinn im Alltag zu finden.
Eva Wallack
Das darf man nicht unterschätzen - was das an Sicherheit und Selbstvertrauen bedeuten kann. Und auch, wenn der Druck aus der Familie wegfällt, dass der Betroffene „noch funktionieren muss". Wenn man ihn einfach so annimmt, wie er ist.
Das fällt Außenstehenden oft leichter als Angehörigen, die eine gemeinsame Biografie teilen. Aber - und das klingt jetzt vielleicht überraschend - wir haben auch oft Spaß miteinander. Denn vieles kommt ganz direkt, ungefiltert und ehrlich. Und bei aller Ernsthaftigkeit lachen wir auch viel.
Marion Schaffernak
Humor ist eine Form der Befreiung. Und wichtig ist auch, dass die Menschen wissen: Im Memory-Tageszentrum dürfen sie so sein, wie sie sind. So wie ich bin, bin ich gut. Ich kann noch viel. Die Scham soll in den Hintergrund treten, die Ressourcen sollen gefördert werden. Das Positive soll im Vordergrund stehen.
Deshalb ist die Angehörigen-Schulung so wichtig - damit das auch zu Hause weitergeführt werden kann. Damit Angehörige wissen: Wie spreche ich mit meinem Partner, der betroffen ist? Wie gehe ich mit ihm um? Was kann ich ausprobieren?
Vieles ist ja ein Ausprobieren - man merkt eh, ob es funktioniert oder nicht. Und ganz wichtig ist auch, dass man aus der Mimik liest. Wenn die Sprache nicht mehr trägt, wenn Worte nicht mehr verstanden werden - die Mimik wird verstanden. Wenn jemand angelächelt wird, auch wenn er nicht versteht, was gesagt wird, spürt er: Das ist etwas Positives. Und das fördert das Wohlgefühl.
Simone Koren-Wallis
Für alle?
Marion Schaffernak
Für alle.
Simone Koren-Wallis
In der nächsten Folge nehme ich euch mit auf eine Pilzwanderung. Ja - auch das macht die Stadt Graz.
Wir hören uns. Ich freue mich.
🎵 Jingle - Graz, die Stadt meines Lebens
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 54: Ratten in Graz
Auch wenn man sie nicht wirklich oft sieht: Ratten sind unliebsame Mitbewohner in Graz. Wer Ratten auf seinem Grundstück entdeckt, muss auch dagegen vorgehen. Aber was tun, damit es erst gar nicht so weit kommt? Ein Lokalaugenschein in einem Grazer Park mit Eva Winter und Erwin Wieser vom Gesundheitsamt.
🎵 Jingle
Simone Koren-Wallis
Ratten in Graz - auch wenn man sie nicht oft sieht, sind sie unliebsame Mitbewohner. Aber warum eigentlich? Wie viele gibt es überhaupt in Graz - geschätzt? Und wie geht man dagegen vor?
Das klären wir heute. Mein Name ist Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste: Eva Winter und Erwin Wieser.
Eva Winter
Ich heiße Eva Winter und leite das Gesundheitsamt der Stadt Graz seit mittlerweile neun Jahren. Zu unseren Aufgaben gehört auch, sich mit unangenehmen Themen zu befassen - wie Tauben, Wanzen, Kakerlaken, Tigermücken und eben auch Ratten.
Erwin Wieser
Mein Name ist Erwin Wieser. Ich arbeite im Gesundheitsamt im Bereich des strategischen Infektionsschutzes. Und neben den Tigermücken ist auch die Ratte ein ziemlich großes Thema.
🎵 Jingle
Simone Koren-Wallis
Wir sind heute im Volksgarten in Graz. Thema: Ratten. Ich erinnere mich - es ist schon lange her - meine Schwester hatte mal eine Ratte als Haustier. Jetzt lachen beide. Die war eigentlich ganz süß, hätte ich gesagt. Aber von „süß" sprechen wir heute nicht mehr, oder Frau Doktor?
Eva Winter
Nein, auf keinen Fall. Ratten sind zwar soziale und intelligente Tiere - und genau das macht das Zusammenleben mit ihnen oft schwierig. Sie überlisten uns - vorne und hinten. Sie leben in Clans, also in Gruppen von etwa 60 Tieren. Das heißt: Wo eine ist, sind viele.
Simone Koren-Wallis
Warum sind wir gerade hier im Volksgarten, Erwin?
Erwin Wieser
Weil der Volksgarten ein Hotspot ist. Hier gibt es alles, was die Ratte braucht: Wasser im Hintergrund, verwachsene Gänge, in denen sie sich verstecken kann, Müll und Essensreste. Das liebt sie - und deshalb vermehrt sie sich hier besonders stark.
Simone Koren-Wallis
Wie viele Ratten gibt es ungefähr in Graz?
Eva Winter
Ich habe ein bisschen recherchiert. Die Schätzungen gehen davon aus, dass es etwa eine Ratte pro Einwohner gibt. In manchen Städten liegt die Zahl deutlich höher - in Wien etwa zwei, in Paris sogar vier pro Einwohner.
Aber wie zählt man Ratten? Ob das wirklich realistisch ist, ist schwer zu sagen. Wichtig ist: Man muss ein Auge darauf haben, dass es nicht zu viele werden.
Simone Koren-Wallis
Und es werden mehr, hast du gesagt, Erwin?
Erwin Wieser
Ja, es gibt mehr Meldungen. In manchen Gegenden von Graz treten sie vermehrt auf. Die Stadt wächst, wird dichter besiedelt - und damit gibt es auch mehr Futter für die Ratten.
Simone Koren-Wallis
Warum sind Ratten ein Problem?
Eva Winter
Ratten können Krankheiten übertragen. Ihr schlechter Ruf stammt vor allem aus der Zeit der Pest. Heute weiß man, dass die Pestübertragung nicht allein der Ratte zuzuschreiben ist - vor allem nicht in dem Tempo, wie es im Mittelalter passiert ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Mensch-zu-Mensch-Übertragung eine größere Rolle gespielt hat.
Trotzdem: Die Ratte ist ein Symbol für mangelnde Hygiene. Dort, wo Menschen eng zusammenleben, wo Nahrungsmittel offen herumliegen, wo Müll nicht ordentlich entsorgt wird - dort finden wir viele Ratten. Und das kann gerade in Ballungszentren zum Problem werden.
Simone Koren-Wallis
Ich muss gestehen - abgesehen von der Ratte meiner Schwester habe ich in Graz noch nie eine gesehen. Was mache ich, wenn mir doch eine unterkommt?
Erwin Wieser
Du wirst wahrscheinlich keine sehen - Ratten sind nacht- oder dämmerungsaktiv. Aber du könntest Spuren bemerken oder Geräusche hören, wenn sie im Haus sind.
Wenn du den Verdacht hast, dass Ratten da sind, bist du laut ortspolizeilicher Gesundheitsschutzordnung verpflichtet, das dem Grundeigentümer zu melden. Der muss dann geeignete Maßnahmen setzen - zum Beispiel einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer beauftragen.
Und das muss auch dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Zuständig ist mein Kollege Bernd Reisinger, Gesundheitsaufseher - er macht das seit Jahren sehr gut und sorgt dafür, dass wir die Situation gut im Griff haben.
Simone Koren-Wallis
Das heißt, es muss gemeldet werden?
Erwin Wieser
Ja, unbedingt.
Eva Winter
Es besteht die Pflicht, einen Rattenbefall zu bekämpfen. Entweder man macht es selbst - wenn man Eigentümer ist - oder man informiert den Besitzer. Und wenn gar nichts passiert, kommen wir ins Spiel.
Simone Koren-Wallis
Jetzt haben wir gehört: eine Ratte pro Einwohner. Aber was kann ich tun, damit es gar nicht so weit kommt?
Eva Winter
Die wichtigsten Maßnahmen sind: Nahrungsmittel sicher aufbewahren, Müll verschließen, keine Essensreste auf den Kompost werfen. Und ganz wichtig: Keine Nahrungsmittel über die Toilette entsorgen!
Ratten leben in der Kanalisation - und wenn Futter dort vorbeischwimmt, folgen sie der Quelle. Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass eine Ratte aus dem WC kommt. Moderne Kanalisationen haben zwar Rückschlagklappen - aber es ist trotzdem eine unangenehme Vorstellung.
Simone Koren-Wallis
Ist das in Graz schon mal passiert?
Eva Winter
Ich kenne keinen aktuellen Fall - zumindest nicht in den letzten acht Jahren. Aber theoretisch ist es möglich.
Simone Koren-Wallis
Was kann man noch tun?
Eva Winter
Versteckmöglichkeiten beseitigen - keine Holzstapel ewig liegen lassen, keinen Unrat auf dem Grundstück. Auch dichtes Unterholz ist ein Rückzugsort für Ratten.
Und ganz wichtig: Keine anderen Tiere füttern - keine Tauben, keine Spatzen, keine Enten. Denn da fressen die Ratten mit. Übrigens: Tauben füttern ist in Graz verboten.
Simone Koren-Wallis
Die soll man ja eigentlich sowieso nicht füttern, oder?
Eva Winter
Genau. Das gilt für alle Wildtiere - Enten, Spatzen, Tauben. Sie können für sich selbst sorgen. Und wo zu viel gefüttert wird, wird das Zusammenleben mit dem Menschen schwieriger.
Simone Koren-Wallis
Und das Brot ist ja auch nicht gut - aber das ist schon wieder ein anderes Thema.
Eva Winter
Jetzt sind wir zwar bei den Enten und nicht bei den Ratten - aber beides darf man nicht füttern.
Erwin Wieser
Wichtig ist, wie Frau Dr. Winter schon gesagt hat: Zuerst muss man die Ursachen bekämpfen - und erst dann die Ratte selbst. Wenn man die Ursache nicht beseitigt, wird die Ratte auch nicht verschwinden. Das ist wie bei der Tigermücke: Wenn das Wasser bleibt, bleibt auch die Mücke. Also immer zuerst die Ursache - dann die Ratte.
Simone Koren-Wallis
Und wenn man die Ursache nicht bekämpft, dann passiert's - dann werden es immer mehr und mehr.
Eva Winter
Genau. Erstens explodiert die Population, und zweitens kommt das Problem wie ein Jojo zurück - das ist so sicher wie das Amen im Gebet.
Ratten sind extrem fruchtbare Tiere und echte Kulturfolger. Bei uns hat sich die Wanderratte durchgesetzt - und die schafft es, in einem Jahr 100 bis 150 Junge zu bekommen. Und da sind die Kindeskinder noch gar nicht mitgerechnet. Ratten werden innerhalb von sechs bis acht Wochen geschlechtsreif - das multipliziert sich rasant. Das kann zu einer regelrechten Explosion führen.
Und man muss sich vor Augen halten: So eine Ratte kann bis zu 28 cm Körperlänge erreichen - plus 20 cm Schwanz.
Simone Koren-Wallis
Aber wichtig ist auch, dass man sich selbst ein bisschen an der Nase nimmt, oder? Und einfach auf die Umwelt achtet - nichts irgendwo hinschmeißt, sondern sagt: „Ab in den Mistkübel - der wird ausgeleert."
Erwin Wieser
Genau.
Eva Winter
Ganz wichtig sind verschlossene Mülltonnen. Keine Nahrungsmittel in Gullis stopfen - weder ins Klo noch durch den Küchengulli pürieren. Das ist wie ein Buffet für Ratten.
Simone Koren-Wallis
Was macht die Stadt Graz im öffentlichen Raum gegen diese Viecher?
Eva Winter
Die wichtigste Maßnahme ist die Bekämpfung im Kanal. Durch Absperrmaßnahmen wird verhindert, dass sich die Ratten dort frei bewegen können.
Zweitens: eine funktionierende Müllabfuhr. Das ist ein Thema, das wir - Gott sei Dank - ganz anders als etwa Neapel sehr gut im Griff haben.
Und natürlich: Die öffentlichen Mistkübel werden regelmäßig geleert, damit die Ratten keine Jause finden.
Vom Gesundheitsamt aus gibt es außerdem die Gesundheitsschutzverordnung, in der steht, dass Wildtiere - also auch Tauben - nicht gefüttert werden dürfen. Bei den Tauben sind wir besonders streng - die gelten als „Ratten der Lüfte".
Simone Koren-Wallis
Im Volksgarten - war das Problem dort, dass einfach alles zusammenkommt?
Eva Winter
Genau. Im Volksgarten kommt alles zusammen: Unterholz, der Müllgang, Wasser - die Wanderratten lieben das. Dazu kommen viele Versteckmöglichkeiten und natürlich die Nahrungsquelle. Und die ist entscheidend.
Simone Koren-Wallis
Wie merkt man zu Hause, dass man Ratten hat? Worauf muss ich achten?
Erwin Wieser
Da gibt's mehrere Hinweise:
- Rattenkot - sieht aus wie dunkle Reiskörner.
- Nagelspuren - an Holz oder Kabeln.
- Geräusche in der Nacht - Kratzen, Scharren, das einem die Haare aufstellt.
- Löcher und Gänge - zum Beispiel unter dem Vogelhaus im Garten.
- Ammoniakgeruch - Rattenurin stinkt ziemlich.
- Schleifspuren oder Pfotenabdrücke - auf glatten Flächen.
Das sind die Klassiker. Denn wie gesagt: Sehen wird man sie eher nicht - sie sind nachtaktiv.
Simone Koren-Wallis
Und dann heißt es: reagieren - unbedingt. Egal ob man nur Spuren sieht oder Geräusche hört - es muss etwas getan werden.
Eva Winter
So ist es. Ich habe am Anfang über die Pest gesprochen - die ist heute nicht mehr im Vordergrund. Aber es gibt viele andere Krankheiten, die durch Ratten übertragen werden:
- Leptospirose - kennt kaum jemand, ist aber sehr gefährlich. Sie wird über verunreinigtes Wasser übertragen und kann zu Nieren- und Leberversagen führen.
- Hantavirus-Infektionen - durch Mäuse- und Rattenurin sowie Kot.
- Salmonellen - auch die können durch Ratten übertragen werden.
Man muss also wirklich auf seine Nahrungsmittelvorräte achten. Ein Kollege hat mir heute früh erzählt: Eine echte steirische Ratte hat bei ihm im Vorratskammerl nicht einmal vor dem Kernöl haltgemacht - sie hat den Deckel durchgefressen.
Erwin Wieser
Eine Gourmet-Ratte offensichtlich.
Simone Koren-Wallis
Im September gibt es den „Langen Tag der Demenz". In Graz wird gleich drei Tage lang auf Demenz und Alzheimer aufmerksam gemacht. Deshalb dreht sich in der nächsten Folge alles um dieses Thema.
Wir hören uns - ich freue mich.
🎵 Jingle - Graz, die Stadt meines Lebens
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 53: Inklusion in Graz leben
Graz ist die erste Hauptstadt Österreichs mit einer Inklusionsstrategie.
Aber was bedeutet das? Was steht da drin?
Und was macht eine inklusive Stadt aus?
Die Antworten kommen vom Inklusionskoordinator der Stadt Graz David Kriebernegg und von Bernhard Alber, der seit einem Freizeitunfall auf den Rollstuhl angewiesen ist.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Graz ist die erste Hauptstadt in Österreich mit einer Inklusionsstrategie.
Aber was heißt das überhaupt? Was steht da drinnen?
Was bedeutet überhaupt Inklusion? Und was macht eine inklusive Stadt aus?
Jingle
David Kriebernegg:
Ja, hallo, mein Name ist David Kriebernegg, ich bin der Koordinator für die Inklusionsstrategie und darf diese Aufgabe seit Mitte März ausführen für die Stadt Graz.
Bernhard Alber:
Hallo, ich bin der Bernhard Alber, ich bin Obmannstellvertreter vom Verein Wegweiser. Ich habe die Ehre gehabt, bei der Inklusionsstrategie aktiv mitzuarbeiten und habe mich da sehr intensiv mit meinen Ideen mit eingebracht und ich glaube, wir sind da am guten Weg, dass wir da die Stadt Graz inklusiv und barrierefrei machen.
Simone Koren-Wallis:
Heute ist so ein schöner Tag und wir haben uns gedacht, wir gehen vom Rathaus zum Franziskanerplatz und tratschen da ein bisschen für diese Podcast-Folge. Lieber Bernhard, du bist im Rollstuhl unterwegs und der Weg daher, der ja eigentlich ein relativ kurzer ist, war ein holpriger.
Bernhard Alber:
Ja, der Weg war insofern holprig, weil die Pflastersteine für Rollstuhlfahrer zu Erschütterungen führen, die uns dann unter anderem Muskelkrämpfe auslösen und dann das Fahren eben nimmer so lustig ist, wie es eigentlich sein sollte.
Zusätzlich durch die Bodenerschütterung geht es auf die Wirbelsäule und da ist ein entsprechender Bodenuntergrund schon, der was flach ist, ein angenehmeres Fahrgefühl.
Simone Koren-Wallis:
Darf ich fragen, warum sitzt du überhaupt im Rollstuhl?
Bernhard Alber:
Das war einfach ein Unfall, ein leichtsinniger halt, wo ich mir einen Tag gedacht habe, ich muss unbedingt ins Wasser köpfeln und meinen Freunden sagen, wie cool das ist, von diesem Erdhügel runterzuspringen, wo sich sonst keiner getraut hat. Habe mir dann dadurch den fünften und sechsten Halswirbel gebrochen, war dann von einer Sekunde auf die andere querschnittgelähmt, lebe jetzt seit über 25 Jahren im Rollstuhl, bin mittlerweile 40 Jahre, aber kann trotzdem sagen, dass ich ein schönes und erfülltes Leben habe, trotz Querschnittslähmung.
Simone Koren-Wallis:
Das ist schön, also wenn man das hört, muss ich ganz ehrlich sagen, da geht mir das Herz auf, aber so wie du sagst, Inklusion geht uns alle was an, deswegen auch die Inklusionsstrategie. Ich habe nachgelesen, in Österreich leben circa 1,3 Millionen Personen mit einer dauerhaften Beeinträchtigung. Wenn wir das jetzt auf Graz umlegen, entspricht das so roundabout 48.000 Menschen.
Das ist eigentlich jeder sechste, David.
David Kriebernegg:
Ja, das ist richtig und man muss dann natürlich auch unterscheiden, dass es da unterschiedliche Behinderungen gibt, wobei Behinderung ist ja ein Label, wo man einfach unterschiedliche Menschen wieder in eine Schublade steckt. Fast jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens, zumindest temporär, Situationen, wo er gewisse Beeinträchtigungen erfährt, beziehungsweise wo es einfach dann Barrieren gibt.
Das kann im öffentlichen Raum sein, das kann im Alltag, das können gewisse Lernschwierigkeiten sein, dass das die Stärke, die Sehstärke einfach nachlässt. Das sind ja Dinge, wo wir alle betroffen sind und bei der Inklusionsstrategie geht es genau darum, möglichst für alle Menschen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir die Stadt und alle Ressourcen, die hier zur Verfügung stehen, gut nutzen können.
Simone Koren-Wallis:
Bevor wir jetzt auf die Strategie allgemein eingehen, was ist überhaupt Inklusion für euch beide?
Bernhard Alber:
Also Inklusion ist für mich etwas, wo ich sage, wenn wir in 10, 15 oder 20 Jahren, egal wie lange das dauert, nicht mehr über Inklusion reden, sondern Inklusion gelebt wird, so wie es in Ländern wie Dänemark und Schweden schon größtenteils der Fall ist.
Da wird nicht mehr darüber diskutiert oder politisiert, sondern da ist es einfach ganz normal mit einer Behinderung im Kreise der Bevölkerung zu leben und man wird als gleichwertig wahrgenommen und so stellen wir das in Zukunft vor.
David Kriebernegg:
Ja, es ergibt sich schon vom Begriff her, also inklusiv heißt ja einschließend, ist das Gegenteil von exklusiv, also ausschließend. Inklusiv bedeutet, dass alle Menschen, egal welche Herkunft sie haben, welche Sprache sie sprechen, welche körperliche Konstitution sie haben, welches Geschlecht, sexuelle Orientierung sie haben, dass alle die Möglichkeit haben, als Individuen gleiche Chancen zu haben und überall sich mit zu beteiligen.
Inklusive Gesellschaft ist dann erreicht, wenn es keine Rolle mehr spielt, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht im Rollstuhl sitze, ob ich eine Lernschwäche habe oder ob ich keine Lernschwäche habe. Dahingehend geht es eigentlich immer um das Individuum. Es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, die für jedes Individuum nutzbar sind und dass jeder Mensch, egal in welcher Situation er ist, in welchem Alter er ist, wie die Familiensituation aussieht, alle gesellschaftlichen Zugänge hat, die es einfach braucht.
Simone Koren-Wallis:
Du sagst, du hoffst, dass es in zehn Jahren überhaupt kein Thema mehr ist. Was ist jetzt ein Thema? Wo sagst du, da funktioniert Inklusion noch gar nicht?
Bernhard Alber:
Es fängt einmal bei den Köpfen der Menschen an, vor allem bei der Bürokratie, wo wir noch viel zu arbeiten haben, dass wir dahingehend in die richtige Richtung kommen. Thema Wohnen ist ein großes Thema. Es gibt kaum Bauträger, die sich bereit erklären, wirklich Wohnungen zu bauen, die individuell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung angepasst werden. Da werden noch die Mindestbauvorschriften gebaut und nicht mehr. Mobilität haben wir noch Bedarf in Form von der Infrastruktur, sprich Gehwege, Eingänge bei Geschäften, die ganzen Rollstuhlrampen, die man als Rollstuhlfahrer mit einem manuell betriebenen Rollstuhl nicht immer schafft, dass man da einfach Lösungen entwickelt, wie zum Beispiel mit Liften oder was auch immer, wo halt dann Ideen gefragt sind, dass man in allen Bereichen der Stadt Graz, wo einfach dann inklusiv jeder sich fortbewegen kann oder leben kann, wie er möchte.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt ist im September die Inklusionstrategie ein Jahr alt. Happy Birthday, Inklusionstrategie, was steht da jetzt genau drinnen?
David Kriebernegg:
Es ist definiert, was die Zielsetzungen sind oder was der Zweck des Ganzen ist. Also hergeleitet wird sie von der UN-Behindertenrechtskonvention, die ist 2006 beschlossen worden. Österreich war das erste Land, wo das dann auch unterschrieben worden ist. Österreich ist eigentlich Vorreiter in diesem Bereich und seitdem gibt es verschiedene Aktionspläne auf nationaler Ebene, aber auch von Seiten des Landes Steiermark. Es hat auch einen Aktionsplan schon 2015 gegeben, wo man mal festgelegt hat, wo es überall Handlungsbedarf gibt und die Inklusionstrategie ist quasi eine Fortsetzung dieses Bekenntnisses zu einer UN-Behindertenrechtskonvention und da wird einfach strukturell aufgelistet, was sind die wichtigsten Querschnittsmaterien und Handlungsfelder.
Barrierefreiheit ist ein ganz zentrales Thema dabei, da geht es eben um die räumliche Barrierefreiheit, aber auch alles, was jetzt Informationen sind, was sensorische Barrieren einfach sind, zum Beispiel, dass man einfach Menschen mitdenken muss, die halt auf der Webseite nicht die Möglichkeit haben, das alles zu lesen, sondern die da einfach auch dann gewisse Rahmenbedingungen brauchen, zum Beispiel, was jetzt auch schon umgesetzt worden ist von der Öffentlichkeitsabteilung, dass es einen Reader gibt, wo dann die Webseite vorgelesen wird, das ist quasi so ein Beispiel, aber es geht auch um das Thema Sensibilisierung, Fortbildung, es geht um das Thema, dass man Wohnungen so gestalten muss, dass sie für alle nutzbar sind. Es wird nie so sein, dass ich eine Wohnung schon so einrichten kann, dass es für alle passt, aber es muss möglich sein, dass die Wohnungen adaptierbar sind, dass jeder Mensch, egal ob es jetzt um die körperliche Konstitution geht oder ob es aufgrund des Alters oder aufgrund der Zugänge notwendig ist, hier Änderungen vorzunehmen, dass es für alle irgendwie möglich ist, das zu nutzen. Und genau darüber hinaus sind ganz, ganz viele Themen, also eben Bildungssensibilisierung ist ganz wichtig, Arbeit und Beschäftigung ist ganz wichtig, wie schaffen wir es Menschen am ersten Arbeitsmarkt so Möglichkeiten zu eröffnen, dass sie gut partizipieren können, dass sie nicht in irgendwelche Sondereinrichtungen abgeschoben werden, sondern im Gegenteil, dass wir irgendwann einmal in einer Welt leben, wo egal ob in Verwaltung oder in Unternehmen es keine Rolle mehr spielt, ob ich zum Beispiel im Rollstuhl sitze, ob ich Deutsch als Erstsprache habe oder welches Geschlecht ich habe oder welche sexuelle Orientierung ich habe.
Darüber hinausgehend gibt es dann je nach Themen, Abteilungen, also Pflege, Kindergärten, Schulen, was eine Riesenbaustelle ist, weil gerade im Schulbereich können wir wirklich Inklusion leben, aber dafür braucht es dann natürlich auch die notwendigen Ressourcen, das heißt sowohl in der Ausbildung als auch genügend Lehrer und Lehrerinnen, die geschult sind zum Beispiel mit Menschen mit Sehbeeinträchtigungen oder bei Lernschwierigkeiten das gut zu unterstützen und die Schulassistenz, die ja jetzt erneut beschlossen worden ist, ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wie notwendig es eigentlich in der Schule ist, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Simone Koren-Wallis:
Und du hast da auch mitgearbeitet, also es ist auch so, dass diese Inklusionsstrategie auch wirklich schon inklusiv begonnen hat, allein bei der Mitarbeit.
Bernhard Alber:
Ja, das stimmt und nicht nur ich habe daran mitgearbeitet, sondern auch die ganze Stadt Graz, also konkret meine ich damit Menschen mit Behinderung, die in der Stadt Graz leben, sind aktiv am Prozess beteiligt worden. Das war einfach ein laufender Prozess, wo dann alle Ideen von jedem mit aufgenommen worden sind, wo auch ich und auch Didi Ogris von „Selbstbestimmt leben Steiermark" sich aktiv mit eingebracht haben, bei dieser Inklusionsstrategie mitzuarbeiten und bin auch heute dankbar über das Ergebnis, was wir da alle zusammen zustande gebracht haben und schlussendlich hat dann der Gemeinderat dem Ganzen zu 100 Prozent zugestimmt und ich denke, dass wir da was Gutes für die Zukunft geschaffen haben und da in ganz Europa wirklich federführend und einzigartig sind.
Simone Koren-Wallis:
Was würdet ihr euch für die Stadt Graz wünschen in Sachen Inklusion?
Bernhard Alber:
Ach, das ist eigentlich ganz kurz und einfach gesagt, das was wir in der Inklusionsstrategie beschlossen haben, dass es einfach jeder in sich im Herzen trägt und sich aktiv beteiligt und alle zusammenarbeiten, also sprich alle Abteilungen der Stadt Graz. Inklusion geht uns alle was an, es kann jeden betreffen, egal ob ich es bin mit einer Querschnittslähmung, einer mit Lernschwierigkeiten oder einfach, wo man von einem Tag auf den anderen eine Erkrankung hat wie MS, so es ist keiner davon gefeit, es kann jederzeit passieren und dann irgendwann ist jeder von uns dankbar, dass man eben sowas in der Stadt Graz hat und vom System quasi profitiert, weil daran in der Vergangenheit gearbeitet worden ist.
David Kriebernegg:
Ich würde mir wünschen, dass es in Zukunft sowas wie eine Inklusionsstrategie oder auch eine Koordinationsstelle Inklusion gar nicht mehr braucht.
Simone Koren-Wallis:
Aber dann bist du einen Job los! (lacht)
David Kriebernegg:
Ja, dann bin ich meinen Job los, aber dafür ist die Gesellschaft dann insgesamt natürlich eine ideale, weil das würde ja bedeuten, dass Inklusion wirklich in allen Bereichen gelebt wird und dass man es nicht mehr extra definieren muss und nicht als Extrastrategie überhaupt festlegen muss, weil es tatsächlich noch immer, und wir sind gerade beim Hergehen vom Rathaus hier zum Franziskanerplatz, wo wir uns ja jetzt aktiv erleben dürfen, sind einfach viele Bereiche nicht, werden einfach gewisse Gruppen nicht mitgedacht, sondern es gibt einen gewissen Mainstream, würde ich jetzt einmal sagen, die definieren einfach, wie Gesellschaft gestaltet wird, ob das jetzt baulich ist, ob das jetzt gesetzlich ist, ob das jetzt die Frage ist, wie eine Zeitung zum Beispiel ausschaut, wie eine Homepage zum Beispiel ausschaut, wie in der Schule Bildung vermittelt wird und da werden oft dann Gruppen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich so stark einzubringen, sich zu Wort zu melden, werden oft vergessen und die Inklusionsstrategie hat ja genau diesen Zugang zu sagen, okay, wir müssen genau diese Perspektiven mit einfließen lassen und dahingehend die Rahmenbedingungen ändern und in einer idealen Gesellschaft wird das überall schon mitgedacht werden. Ich müsste nicht extra erwähnen, dass ich an Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen denken muss, wenn ich zum Beispiel ein öffentliches Gebäude habe, weil das wird einfach von vornherein würd da schon eine Rampe sein, würd da ein Lift sein, der immer funktioniert und in dieser Gesellschaft sind wir leider noch nicht, es ist da kein Einzelfall, sondern es ist natürlich international ein grundlegendes Thema noch immer und da sind manche Länder weiter, manche noch nicht so weit und ich glaube, dass die Inklusionsstrategie ein wichtiger Schritt ist für uns in Graz, da wieder auch ein Vorreiter zu sein, wenn es darum geht, es wirklich zu leben und da auch als Verwaltung voranzugehen oder Vorbild zu sein für größere Unternehmen oder auch für andere Kommunen.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge wird es tierisch, aber mit eher unliebsamen Tierchen, nämlich Ratten. Wir hören uns, ich freu mich.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 52: Arbeiten, wo andere baden gehen: als Badeaufsicht in der Auster
Er ist Lebensretter, Techniker, Gästebetreuer und noch vieles mehr: Bademeister Christoph Tamm. Er und seine Kolleg:innen schauen in der Grazer Auster darauf, dass es den 130.000 Menschen, die sich hier in den Sommermonaten abkühlen, gut geht. Ein Besuch im besucherstärksten Grazer Bad über Lebensrettungen und vieles mehr.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Dort arbeiten, wo andere baden gehen. Er ist Lebensretter, er ist Techniker, Gästebetreuer und wahrscheinlich noch vieles, vieles mehr. Bademeister Christoph in der Auster. Ein Besuch im besucherstärksten Grazer Bad.
Christoph Tamm:
Ich bin der Tamm Christoph, ich bin da bei der Graz Freizeit als Bademeister angestellt. Ich mache den Job jetzt schon seit über 17 Jahren und es macht noch immer Spaß.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Die Serie ist zwar schon doch ein bisschen älter, ich glaube 89, aber hast du zu viel Baywatch geschaut als Kind?
Christoph Tamm:
Ja sicher, wer kennt das nicht?
Simone Koren-Wallis:
Jetzt bist du selber mit der roten Badehose in der Auster. Du bist Bademeister. War das immer schon ein Berufswunsch, wo du gesagt hast, das will ich mal machen?
Christoph Tamm:
Nein, das ist eigentlich durch einen Zufall passiert, dass ich da in die Badeaufsicht gerutscht bin. Ich bin gelernter Zahntechniker, das habe ich zehn Jahre lang gemacht und dann irgendwann einmal war der Zeitpunkt da, dass ich gesagt habe, ich möchte mich beruflich verändern und habe dann durch Zufall, damals noch im alten Eggenberger Bad, als Saisonmitarbeiter angefangen und das hat mir dann so viel Spaß gemacht. Seitdem bin ich da, ich bin nie mehr weggekommen.
Simone Koren-Wallis:
Man hört es im Hintergrund, wir sitzen heraus. Es ist aber noch relativ ruhig, liegt daran, dass wir vor 8 Uhr da sind, vor den Öffnungszeiten. Was machst du schon so früh da? Da ist ja niemand zum Aufpassen.
Christoph Tamm:
Naja, mein Dienstbeginn ist um 6 Uhr in der Früh. Zum einen haben wir ja auch das Hallenbad, das sperrt ja schon um 7 Uhr auf, das Freibad eben, wie gesagt, um 8 Uhr. Naja, es müssen die Becken gereinigt werden, die Wasserqualität wird überprüft, die ganzen Attraktionen werden kontrolliert, also Sprungturm, Rutsche, die Sandkiste, muss man ja schauen, ob nicht irgendwo irgendwas liegt, wo man sich vielleicht verletzen könnte oder ob was kaputt ist. Ja und dann, wie gesagt, um 7 Uhr kommen die ersten Gäste und dann geht es eh schon los.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt machst du das schon so lange, was ist in dieser Zeit schon passiert, wo du sagst, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen?
Christoph Tamm:
Da ist schon einiges passiert. So die schlimmsten Sachen, das sind ja meistens dann die Badeunfälle, da habe ich dreimal schon was gehabt, also zweimal wirklich eine Reanimation, wo jemand ertrunken ist, ist Gott sei Dank gut ausgegangen und einmal habe ich jemanden gehabt, der hat sich beim Sprungturm ziemlich schwer verletzt, der ist vom 1-Meter-Brett runtergefallen, aber nicht ins Wasser, sondern auf dem Beton und das war auch nicht so lustig, war dann ziemlich eine blutige Geschichte. Das sind die Sachen, was man nicht so vergisst.
Simone Koren-Wallis:
Wie ist es, einen Menschen wiederzubeleben? Das ist schon, glaube ich, so eine einschneidende Geschichte, oder? Kannst du dich noch erinnern, wie du dich damals gefühlt hast?
Christoph Tamm:
Naja, wie gesagt, vergessen tut man das nie, aber es ist dann in dem Moment, wo das passiert, da tut man einfach. Das geht dann einfach automatisch. Man hat dann so viel Adrenalin und solche ungeahnten Kräfte, sage ich mal, dass man da jemanden aus dem Wasser rausholt und wir sind ja auf das geschult. Wir machen da alle drei Jahre einen Auffrischungskurs, aber trotzdem ist da nie, wenn so etwas passiert, das ist nie gleich. Also es gibt immer andere Situationen, immer neue Situationen, aber wie gesagt, in so einer Situation, da tut man einfach und da ist immer ganz wichtig, dass man auch keine Angst hat, hinzugehen. Bei uns in meinem Beruf müssen wir das ja sowieso, aber es ist ja privat auch, im Privatleben, wenn man zu einem Unfall kommt, da haben wir die Leute, auf die man ein bisschen scheu, aber wie gesagt, man kann nichts falsch machen. Man kann nur falsch machen, indem man nicht hilft.
Simone Koren-Wallis:
Das sind jetzt Gott sei Dank die Ausnahmen. Was machst du sonst? Wie viele Leute sind in der Auster tagsüber im Sommer? Heute wird es sehr, sehr heiß. Was erwartet es?
Christoph Tamm:
Naja, unter der Woche bei Schönwetter, sage ich mal, sind so 1.500 bis maximal 2.000 Gäste bei uns zu Besuch. Am Wochenende geht es dann schon mehr rund. Also da haben wir schon zwischen 3.000 bis 4.000 Gäste bei Schönwetter.
Simone Koren-Wallis:
Und was machst du dann hauptsächlich?
Christoph Tamm:
Naja, als Bademeister schaue ich, dass die Haus- bzw. Badeordnung eingehalten wird. Ich bin ja auch vor Ort die erste Ansprechperson für die Badegäste. Ich gebe Auskunft, löse Konflikte, nehme Beschwerden entgegen, leiste, wie wir schon gesagt haben, erste Hilfe. Das fängt an mit einem kleinen Pflaster, mit einem Bienenstich bis hin zu jemandem, der wirklich im Wasser ertrunken ist, den man dann retten und reanimieren muss. Wie gesagt, die Wasserqualität muss ich dreimal am Tag überprüfen. Ja, ich schaue einfach, dass die Gäste zufrieden sind und glücklich wieder nach Hause gehen und unverletzt.
Simone Koren-Wallis:
Musst du manchmal schimpfen?
Christoph Tamm:
Kommt schon hin und wieder vor. Ja, eben so Kleinigkeiten, Beckenrandsprünge. Es wird in der Halle gelaufen, es rutscht jemand aus oder es wird jemand geschupft oder es wird gegessen in der Halle, was man auch nicht darf. Es werden Glasflaschen mit ins Freibadareal genommen oder in die Halle, was eben auch ganz eine blöde Geschichte ist. Kommt auch hin und wieder vor, die fallt dann um, dann haben wir tausende Glasscherben am Boden, die Leute gehen bloß für sich herum. Die Sachen muss man halt immer schauen, dass man vermeidet. Es kommt auch hin und wieder vor, dass Gäste kommen, die keinen Eintritt zahlen, die irgendwo über den Zaun klettern. Zumindest versuchen sie es. Aber auf die Sachen schauen wir halt auch immer. Oder dass geraucht wird im Freibad. Im Freibad ist ja nicht Raucherbereich. Da haben wir nur eigene Areale, wo man rauchen darf. Also das ist auch immer wieder, dass dann trotzdem irgendwo auf der Liegewiese geraucht wird. Das sind halt so die Sachen.
Simone Koren-Wallis:
Eine richtige Aufsicht?!
Christoph Tamm:
Ja, genau.
Simone Koren-Wallis:
Du hast gesagt, du kontrollierst die Wasserqualität. Wie viele Liter Wasser fließen da in der Auster?
Christoph Tamm:
Also wenn man alle Becken zusammenzählt, kommen wir auf ca. 8 Millionen Liter.
Simone Koren-Wallis:
Also eigentlich ganz schön viel Wasser, muss man sagen. Du aber merkst du irgendwie, können die Leute weniger gut schwimmen?
Christoph Tamm:
Ja, definitiv. Vor allem junge Menschen gibt es immer mehr, die nicht schwimmen können. Also das fällt mir jetzt eigentlich schon die letzten Jahre auf.
Simone Koren-Wallis:
Ja, aber das ist ja eigentlich, also ich habe ja ein kleines Kind zu Hause, du auch. Und man hört ja immer, das ist das Wichtigste, oder? Schwimmen zu können, damit sie zumindest an den Rand kommen. Weil passieren kann ja immer alles.
Christoph Tamm:
Ja, wir haben erst letzte Woche den Fall gehabt, wo die ganze Familie nicht schwimmen hat können. Also Papa, Mama und auch die Tochter nicht. Und da haben wir, da müssen die Tochter auch aus dem Wasser rausholen. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, weil mein Kollege das rechtzeitig gesehen hat. Aber das ist nur ein Beispiel, wo eben sogar die Eltern nicht schwimmen können. Warum das heutzutage so ist, ist mir unbegreiflich. Weil das war ja damals, also wie ich noch Kind war, war das immer eines der wichtigsten Dinge, dass man sagt, du musst schwimmen können, Skifahren, Eislaufen. Das waren so die Standardsachen. Fahrradfahren.
Simone Koren-Wallis:
Die Stadt Graz bietet natürlich auch Schwimmkurse an. Alle Infos dazu gibt es beim Sportamt der Stadt Graz. Einfach reinschauen auf www.graz.at.
Du, jetzt bist du ja jeden Tag da. Gehst du dann privat auch gerne da her? Ehrlich, komm ehrlich.
Christoph Tamm:
Ganz ehrlich, nein.
Simone Koren-Wallis:
Warum?
Christoph Tamm:
Ich gehe lieber wandern, wo nicht so viele Leute sind.
Simone Koren-Wallis:
Und wo dich wahrscheinlich keiner kennt, oder?
Christoph Tamm:
Ja, genau.
Simone Koren-Wallis:
So, ich werde jetzt den Test machen. Du, ist aber schon erfrischend, würde ich jetzt einmal sagen, oder?
Christoph Tamm:
Nein, das hat 25,5 Grad.
Simone Koren-Wallis:
Aber es ist ja dann eh die Abkühlung. Wenn es zu warm ist, ist ja keine Abkühlung mehr.
Christoph Tamm:
Eben, genau.
Simone Koren-Wallis:
Und was sind die Highlights in der Auster?
Christoph Tamm:
Na ja, das absolute Highlight ist einmal der Sprungturm. Weil wir haben einen Zehn-Meter-Sprungturm. Die zwei Rutschen mit einem Erlebnisbecken, Beachvolleyball, Sandplatz mit Planschbecken, ein Klettergerüst für Kinder, ein Sportbecken. Das sind so die Highlights. Also es ist für jeden was dabei. Und bei Schlechtwetter gibt es ja auch den Wellnessbereich. Da wird es einem auf alle Fälle heiß.
Simone Koren-Wallis:
Nicht nur von der Sonne quasi. Du, und Zehn-Meter-Turm, trauen sich da viele runterspringen?
Christoph Tamm:
Ja.
Simone Koren-Wallis:
Echt?
Christoph Tamm:
Kannst du dann auch springen.
Simone Koren-Wallis:
Na, danke.
Christoph Tamm:
Ich mache gerne auf.
Simone Koren-Wallis:
Na, danke. Du, und gibt es noch Tipps quasi vom Profi, der jeden Tag im Schwimmbad ist, für einen gelungenen Badetag?
Christoph Tamm:
Ja, sicher. Die Badeschlapfen, die Badehose nicht vergessen. Kommt auch hin und wieder vor. Sonnencreme nicht vergessen, Sonnenhut. Und viel Wasser trinken, das ist ganz wichtig. Und da immer wieder schattige Plätze aufsuchen und vor dem Abkühlen im Becken vielleicht abduschen. Wäre auch nicht so schlecht.
Simone Koren-Wallis:
Sonst haben wir wieder das Problem mit der Wasserqualität und du hast mehr zu tun wahrscheinlich, gell?
Christoph Tamm:
Genau.
Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge geht es um Graz inklusiv. Eine Stadt für alle. Wir hören uns, ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 51: Parkraumüberwachung in Graz
25.000 Parkplätze, 600 Strafmandate täglich. Das ist Parken in Graz.
Aber: Werde ich sofort abgestraft, wenn der Parkschein abgelaufen ist? Oder gibt es eine Toleranzgrenze? (kleiner Spoiler: ja - gibt es!)
Einsatzleiter Martin und seine Kollegin Sandra zeigen auf, was beim Parken geht und was nicht und wie ihr Berufsalltag abläuft.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Folgende Annahme, mein Parkschein ist gerade abgelaufen und ich komme eine Minute später zum Auto und zack, Strafmandat ist schon auf der Scheibe drauf. Ich sage es gleich, das kann so nicht sein, denn es gibt in Graz eine Toleranzgrenze.
Wie lange man da ein Auge zudrückt und vieles, vieles mehr, das gibt es in dieser Folge.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Mittwoch, kurz nach neun Uhr im Grazer Parkraum und Sicherheitsservice, kurz GPS. Ich bin jetzt in der Einsatzzentrale beim Einsatzleiter, bei Martin.
Die ersten Funksprüche hört man schon im Hintergrund, aber es ist so noch ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, weil gerade alle erst raus sind.
Martin:
Die Leute sind ausgeflogen ins Rayon, nehmen Position ein, starten in den Rayonen mit der Kontrolle, der Überwachung, der Kurzparkzone oder Parkzone, je nachdem, wo sie zugeteilt sind. Zusätzlich beginnt auch für uns dann die Hektik langsam, aber doch, wenn aber jeder dann dort ist, wo er sein sollte und dann die ersten Übertretungen dann so beanstanden sind, dann fängt das Ganze erst so richtig an.
Simone Koren-Wallis:
Was ist jetzt genau das Spannende an eurem Job?
Martin:
Wir wissen nie wirklich, was der Tag bringt, der kann sehr viel Hektik mitbringen, es kann auch ruhiger zugehen, jetzt vor allem im Sommer, Ferienzeit, ist halt nicht sozusagen dieselbe Action, wie wir es sonst haben. Dementsprechend ist auch dann der Funkverkehr bei uns, weil eben mehr Leute da sind, mehr Leute falsch packen eventuell und mehr dann zu tun ist.
Simone Koren-Wallis:
Es klingt so in der Einsatzzentrale auch total interessant, aber viel Spannendes, dürfte ich vielleicht mit irgendjemandem mitgehen nach draußen und wirklich live dabei sein?
Martin:
Gerne, du kannst die Kollegin Sandra dazu begleiten, man muss sich das einmal live anschauen, um zu sehen, was da wirklich passiert.
Simone Koren-Wallis:
Servus Sandra, wir gehen uns an, schauen wir mal, was wir sehen werden.
Sandra:
Wir beginnen heute gleich von der Haustüre, das ist kein Motto. Und jetzt schauen wir mal, was die Herrschaften drinnen haben oder vielleicht auch nicht im Kfz.
Simone Koren-Wallis:
Warum machst du den Job?
Sandra:
Warum mache ich den Job? Ich mag meinen Job, ich liebe es, draußen zu sein, die Natur zu genießen, auch unter anderem, wenn es nicht ganz so heiß ist. Ich bin ein freier Mensch, habe meine Ruhe mehr oder weniger und das lebe ich an meinem Job. So, wir sind schon mal beim ersten Auto, der hat ein gültiges Parkticket drinnen, also es ist gültig bis 10.23 Uhr, den können wir so stehen lassen. Ordnungsgemäß steht er auch hier, also an den Markierungen.
Simone Koren-Wallis:
Also das musst du alles schauen, du musst schauen, Markierungen.
Sandra:
Genau, das eine ist das Parkgebühren und das andere ist Straßenverkehrsordnung, StVO.
Simone Koren-Wallis:
Was erlebt man da alles eigentlich? Was erlebt man alles?
Sandra:
Also man erlebt unterschiedliche Dinge. Also es gibt Lenker, die sehr, sehr uneinsichtig sind, obwohl es definitiv ihr Fehler war. Dann gibt es ja die Lenker, die sagen, okay, ich weiß, tut mir leid, das nächste Mal mache ich es nicht mehr. Oder es gibt auch einfach Passanten, die mich einfach ansprechen auf der Straße und einfach mir ihre Lebensgeschichte erzählen, einfach so. Der hat eine Ausnahmegenehmigung, die muss mit dem Kfz-Kennzeichen übereinstimmen und die Gültigkeit und das Wohngebiet und das ist gültig, passt.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Falschparker findest du?
Sandra:
Das kommt immer darauf an, in welchem Rayon du bist. Also wenn du eher Richtung Stadt bist, hast du meistens mehr Mandate, aber es ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel jetzt, wo die Sommerferien sind, ist auch weniger zu tun. Das ist immer heute so, morgen so, das kann man nicht so genau sagen.
Die Dame ist offensichtlich Handyparkerin. Das werde ich jetzt gleich einmal überprüfen. So, das schauen wir mal.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, du kannst das alles mit euren Geräten nachschauen?
Sandra:
Datenabfassungsvorgerät, genau. Sie ist eingeloggt von 9.30 bis 12.30 Uhr.
Simone Koren-Wallis:
Passt.
Sandra:
Völlig in Ordnung.
Simone Koren-Wallis:
Du, es gibt ja da so oft Gerüchte von wegen, ihr müsst Strafzettel ausstellen und so weiter. Das stimmt alles nicht?
Sandra:
Das ist ein völliger Quatsch. Wir stellen die Strafmandate erst dann aus, wenn es wirklich notwendig ist. Wenn sie Falschparken bzw. kein Parkticket entrichtet haben, also sicher nicht zum Scherz.
Simone Koren-Wallis:
Und du brauchst da nicht irgendwelche bringen, dass du am Tag 20 bringen musst oder so?
Sandra:
Es kann auch passieren, dass du an einem Tag gar nichts hast. Das kann durchaus passieren, dann ist es einfach so.
Simone Koren-Wallis:
Ich bin ja eine, ich versuche dann sehr freundlich, von wegen, ich bin schon da und bitte keinen Strafzettel. Kann man da wirklich mit Freundlichkeit was schaffen?
Sandra:
Naja, also wenn das Mandat schon erstellt wurde, dann kann ich nichts mehr tun. Also da können sie dann bitten und bitten und betteln, ich darf es gar nicht zurücknehmen. Und das ist Fakt. Jetzt bin ich zum Beispiel, keine Ahnung, 10 Sekunden vorm Ausdrücken, und dann kommt er oder die Lenkerin und sagt, ich bin schon da, ich bin schon da. Naja gut, aber bitte fahren Sie jetzt schnell weg. Das stelle ich dann natürlich nicht aus. Ein bisschen Menschlichkeit muss auch dazu gehören.
Simone Koren-Wallis:
Aber was hast du dir schon alles anhören müssen? Und vielleicht jetzt jemand kommt, der nicht so ganz freundlich ist wie ich.
Sandra:
Gibt es natürlich auch. Es gibt ja natürlich unterschiedliche Menschen.
Simone Koren-Wallis:
Was war denn das Schlimmste zum Beispiel?
Sandra:
Das war nicht einmal ein Lenker, ein Passant. Und das war recht am Anfang, wo ich begann, diesen Job zu machen. Der kam auf mich zu mit einem Hund, schüttet mir einfach seine Bierdose über meine Uniform und hat mich einfach aufs Schlimmste beschimpft.
Simone Koren-Wallis:
Ich meine, wie gehst du mit dem um? Ich meine, jetzt kann es sein, dass du beschimpft wirst ohne Ende. Wie machst du das?
Sandra:
Am Anfang war es schon unangenehm, wenn du dann beschimpft wirst. Aber mittlerweile, das geht da rein und da wieder raus.
Simone Koren-Wallis:
Lernt man, dicke Haut zu bekommen.
Sandra:
Richtig, so ist es. Sonst schaffst du den Job fast nicht.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt haben wir Hochsommer, teilweise über 30 Grad. Wie viel gehst du am Tag?
Sandra:
Wenn ich den ganzen Tag auf der Straße bin, 20-22 Kilometer bekomme ich schon zusammen am ganzen Tag.
Simone Koren-Wallis:
Das ist ein halber Marathon.
Sandra:
Kann man so sagen, ja.
Simone Koren-Wallis:
Hand aufs Herz, freust du dich, wenn du dann einmal einen erwischst, der falsch geparkt hat?
Sandra:
Nein, die Freude ist sehr gering. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Aber ich denke, das ist einfach meine Tätigkeit, meine Arbeit. So wie jeder andere Mensch seine Arbeit verrichtet, ist das eben mein Job. Natürlich ist es ab und zu unangenehm. Und ich denke, abschleppen ist nicht so günstig, er hat es einfach übersehen. Ich warte einfach ein paar Minuten länger zu. Und nach einer gewissen Zeit muss ich ihn dann letztendlich doch abschleppen lassen, wenn er doch länger stehen sollte an verbotener Stelle.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt sind wir bei einem Auto, da steht mit einem Zettel Handy parken drinnen. Kann man das mit einem Zettel auch machen oder muss da eine Plakette?
Sandra:
Muss nicht sein, aber es muss ja ein Hinweis hinter der Ventilscheibe liegen, dass er eben Handyparker ist. Und er scheint es offensichtlich zu sein, nur ist die Frage, ob er jetzt eingeloggt ist oder nicht. Offensichtlich ist er nicht eingeloggt, das heißt, ich werde ihn jetzt vorerfassen.
Simone Koren-Wallis:
Was heißt vorerfassen?
Sandra:
Ich habe mein Arbeitsgerät und da gebe ich das Kennzeichen ein, die Örtlichkeit ein und dann habe ich einen Beobachtungszeitraum von 13 Minuten. Und wenn er sich bis dorthin in der Zwischenzeit eingeloggt hat, ist gut. Hat er es nicht, dann bekommt er ein Mandat.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, du wartest jetzt, du stellst jetzt nicht gleich ein Mandat aus?
Sandra:
Nein, ich könnte es gar nicht, da es mein Drucker gar nicht zulassen würde. Ja, also ich würde sagen, wir gehen ein Stück hier rauf bis zur Kirche und dann gehen wir runter und dann schauen wir, ob er sich vielleicht in der Zwischenzeit eingeloggt hat oder nicht. Und wenn nicht, dann muss ich so knapp eine Minute, bevor die Zeit um ist, in die Zentrale reinfunken und eben durchgeben, dass ich einen Handyparker vielleicht hätte. Und die kontrollieren es noch einmal, dann wissen wir hundertprozentig, dass er nicht eingeloggt ist.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, ihr sichert es euch wirklich doppelt ab?
Sandra:
Absolut, absolut. Ich könnte ihn jetzt gar nicht abstrafen, er lässt es jetzt gar nicht zu.
Simone Koren-Wallis:
Ich habe gerade den Beweis gesehen. Also es geht gar nicht von wegen, dass du hinkommst und das gleich.
Sandra:
So ist es, weil manche behaupten, ich bin nicht einmal nach zehn Minuten da gestanden. Also doch, sonst sind leider mehr als zehn Minuten gestanden. Und viele sind halt einfach nicht einsichtig.
Simone Koren-Wallis:
Naja, es geht halt immer um eine Strafe.
Sandra:
Freuen tut sich niemand darüber, das ist logisch. Ich freue mich auch nicht, wenn ich einen Strafzettel kriege, beim Schnellfahren oder dergleichen.
Simone Koren-Wallis:
Würdest du dir wünschen, dass die Leute freundlicher werden zu euch?
Sandra:
Die Lenker, selbstverständlich. Aber das wird sich spielen. Es gibt schon viele, viele Menschen, die einsichtig sind, auch freundlich sind, auch wenn sie ein Mandat bekommen. Und dann gibt es genau die Gegenseite, die einen dann wirklich beschimpft.
Das kann mitunter schon sehr unangenehm sein.
Simone Koren-Wallis:
Wird das immer mehr?
Sandra:
Es kommt darauf an, wo du bist. Wenn du einen Bahnhofdienst hast, dann sind die Menschen dort, habe ich das Gefühl, schon mehr aufbrausender.
Simone Koren-Wallis:
Ist irgendwer schon einmal handgreiflich geworden oder so?
Sandra:
Das ist auch schon passiert, ja. Nicht bei mir, sondern beim Kollegen. Das ist eigentlich ein gefährlicher Job, eigentlich.
Simone Koren-Wallis:
Habt ihr Gefahrenzulage?
Sandra:
Ja, haben wir. Die Zeit ist um, jetzt könnt ihr abstrafen, aber ich habe das Okay noch nicht bekommen. Und da muss ich jetzt abwarten. 49 an Zentrale. Handyparkabfrage, bitte. Kennzeichen [aus rechtlichen Gründen entfernt] Anbieter: Easypark. Jetzt muss ich warten, bis ich das Okay bekomme, dass ich ihn abstrafen darf. Nur beim Handyparken.
Zentrale:
Ist nicht eingeloggt, bitte abstrafen.
Sandra:
Danke, verstanden. Gut, er ist nicht eingeloggt. In dem Fall muss ich ihn wohl abstrafen. Das ist der Drucker, da kommt das Mandat raus. Dann mache ich ein Foto vom Kennzeichen, von der Windschutzscheibe. In diesem Fall auch, nachdem er Handyparker ist, der Anbieter. Dann gebe ich das Mandat auf die Windschutzscheibe. Mache erneut wieder ein Foto. Und zum Schluss noch von der Örtlichkeit. Und ganz zum Schluss muss ich das mitschreiben, zu meiner Sicherheit, falls irgendwelche Probleme auftauchen sollten mit dem Lenker. Dass ich sagen kann, okay, das stimmt nicht, bla bla bla...
Simone Koren-Wallis:
So, jetzt haben wir einen Strafzettel ausgestellt. Wie viel darf der jetzt zahlen, also muss er zahlen?
Sandra:
Er wird zahlen müssen, ja, das sind 24 Euro Parkgebühren.
Simone Koren-Wallis:
Kann das auch teurer werden?
Sandra:
Es kann teurer werden, natürlich. Auch wenn er zum Beispiel in einem Behinderten-HRV steht. Der hat keinen Behindertenausweis drinnen. Dann bekommt er mal eine Anzeige, die ist einmal sehr teuer. Und zusätzlich noch die Abschleppung. Die muss er sich dann auch wieder auslösen. Das wird dann sehr teuer. Also bitte doppelt und dreifach hinschauen, bevor man sich irgendwo hinparkt. Immer auf die Tafeln achten.
Simone Koren-Wallis:
Und übrigens, wenn irgendwer jetzt sagt, hey, den Job von der Sandra, den möchte ich auch machen, dann einfach reinschauen auf gps.graz.at. Es sind nämlich Stellen frei. Nächstes Mal bin ich wieder unterwegs. Und zwar in einem der Grazer Freibäder. Wir besuchen einen Bademeister. Wir hören uns, ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 50: Lokalaugenschein in der Küche Graz
2500 - 3000 Kilo Essen heben die Mitarbeiter:innen der Küche Graz täglich und das mit fußballgroßen Schöpflöffeln.
Wie dort 9.500 Portionen täglich zubereitet werden, auf was alles wert gelegt wird und wie die Pläne für die neue Küche Graz sind, erzählt Leiter Franz Gerngroß in dieser Podcast Folge.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Woher kommt eigentlich das Essen, das mein Kind im Kindergarten oder in der Schule bekommt? Auf was wird der Wert gelegt? Wie wird es zubereitet? Ich bin Simone Koren-Wallis und ich mache heute einen akustischen Lokal-Augenschein in der Küche Graz bei Leiter Franz Gerngroß und da sprechen wir auch über den Plan für die neue Küche Graz.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Man hört es vielleicht schon im Hintergrund, da wird ordentlich geschöpft.
Lieber Franz, wir sind in der Küche Graz. Was passiert da jetzt genau?
Franz Gerngroß:
Das Essen für morgen kocht. Das meiste, was ich jetzt in den Kesseln habe, das rückgekühlt wird, weil wir verwenden das Kochsystem Cook & Chill, das heißt kochen und kühlen. Einfach erklärt, Gulasch kochen, das Gulasch in den Kühlschrank stellen, am nächsten Tag ist es besser.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Essen kocht ihr da pro Tag?
Franz Gerngroß:
Derzeit zwischen 9.000 und 10.000 Essen pro Tag, das sind so wie heute. Wie viele Kilo Nudeln haben wir heute gekocht? Also 150 Kilo Nudeln haben wir gekocht, werden so 2.000, 2.500 Portionen sein. In den Kochkessel ist gerade die Soße für die Nudeln, die leere ich jetzt raus und komme vom Bottich dann in die Badewanne. Schaut nicht anders aus wie eine Badewanne, ist eine Badewanne auf Radl. Zur Vorstellung, wie viel 300 Liter sind, das ist ungefähr so, wie die Er- und Sie-Badewanne zu Hause hat.
Simone Koren-Wallis:
Es ist ein ordentlicher Bottich, hätte ich gesagt. Auf was legt ihr in der Küche Graz Wert?
Franz Gerngroß:
Also wichtig ist uns, dass die Waren regional sind. Wir versuchen das meiste aus der Region zu bekommen. Wir schaffen es beim Fleisch zu fast 95%, das ist sogar noch Bio. Mehl und Mahlprodukte sind Bio und aus der Region. Gemüse bauen wir gerade auf mit dem bäuerlichen Versorgungszentrum, dass das Gemüse Graz, Grazer Umland wächst. Der Salat ist aus Graz oder Grazer Umland. Obst und Gemüse, so viel das geht. Milchprodukte, derzeit sind rund über 80 bis 85% regional und 30% Bio.
Das Zweite, was uns wichtig ist, ist die Umwelt. Wir versuchen Großpackungen zu bekommen. Als Kernöl kommt den Nero-Tanks mit 50 Liter oder zwischen 5 und 50 Liter. Aber so ist es auch mit Essig. Wir verwenden nur Apfelessig, das auch ein Bauer macht. Rapsöl ist das Öl, das wir zu 95% verwenden. Kommt alles von hier.
Simone Koren-Wallis:
Wen beliefert ihr jetzt alles genau?
Franz Gerngroß:
Wir haben Kindergärten, Horde und Schulen und Sozialschwächere. In Wirklichkeit, was ich immer sage, die Ernährung ist so schwierig. Essen sollen die Kleinen gleich gesund wie die Großen und die Alten. Essen muss schmecken und sollte gesund sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Simone Koren-Wallis:
Du bist selbst Papa von zwei Kindern und ich habe eine Tochter zu Hause. Ich weiß nicht, wie deine Kinder so drauf sind, aber meine kann ganz schön hagelig sein, wenn sie möchte. Und jetzt belieferst du hauptsächlich Kindergärten und Schulen. Essen die alles, was du denen lieferst?
Franz Gerngroß:
Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ich wage zu behaupten, dass ich weiß, was 90% der Kinder gerne hätten. Und wo ich wenig Probleme habe, dass sie es nicht essen. Es kann sein, dass ich mit Eltern Probleme bekomme, weil es nicht allen ernährungsphysiologischen Grundsätzen entspricht. Und das ist eigentlich die Hauptherausforderung.
Schau, da sind Dinkelnudeln drinnen. Da ist regionales, geschnittenes Gemüse, Tiefkühlerbsen drinnen. Selbst das versuchen wir in naher Zukunft, das wird noch ein, zwei Jahre dauern, dass die in der Steiermark wachsen, eingefroren werden und dann für die Küche Graz zurückgehalten werden. Ja, aber sie essen lieber ein Erdäpfelpüree mit einem Leberkäs. Das ist halt die Herausforderung. Und das schön langsam rüberzubringen, also weniger Fleisch. Die Fleischportionen werden permanent kleiner, der Gemüseanteil höher. So versucht man eigentlich, das gut rüberzubringen. Weil mit Verbot erreichst du gar nichts. Du musst die Kunden überzeugen, die Kinder. Ich glaube, bei der gesunden Ernährung haben wir genau das Problem. Ich erinnere mich an meine Jugend. Das Mülltrennen haben wir den Eltern gelernt. Und ich glaube, bei der gesunden Ernährung muss es gleich funktionieren. Die Kinder müssen so lange lästig sein, dass die Eltern was Gesundes kochen, dass die Fertiggerichte wegkommen, dass sie gemeinsam kochen, dass ich nicht vorm Fernseher esse, dass ich bewusst esse, bewusst einkaufe. Ich muss einfach mehr Energie dran setzen, dass ich weiß, was ich zu mir nehme.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Leute hast du dann insgesamt da?
Franz Gerngroß:
Gesamt sind wir 42 Personen, zwölf davon sind allein schon im Fuhrpark. Weil wir stellen ja das Essen selbst zu. Sechs Fahrzeuge mit je zwei Personen. Drei sind in der Verwaltung.
Rein im Kochprozess habe ich zwischen fünf und acht Leute. Von der Küche kommt das warme Essen hier rein. Das sind Schnellkühler, die das Essen mit minus 20 Grad und Kerntemperaturkühler kühlen, aber nicht frieren. Wir haben keine Tiefkühlkost, wir kühlen es nur runter, die minus 20 Grad, deswegen, weil ja Speisen reinkommen, die 70 Grad haben. Jetzt brauchst du mehr Energie, um das runter zu kühlen.
Simone Koren-Wallis:
Wo wird das Ganze jetzt abgefüllt?
Franz Gerngroß:
Da sind wir jetzt in einem typischen Abfüllraum. So viel Kilo wie rein können, sind so viele Portionen. Was ist es? Für welchen Tag? Man kann sich das so ungefähr vorstellen, der Schöpfer, mit dem sie gerade arbeitet, hat so vier bis sechs Kilo.
Simone Koren-Wallis:
Das ist ein ordentliches Gewicht, gell?
Franz Gerngroß:
Ja. Wir sind Arbeitsplatz und Fitnesscenter im Einem. Wir gehen jetzt in die Kommissionierung. Wiederum ein gekühlter Raum, weil ab jetzt ist ja alles kalt nach der Küche. In der Großküche sprichst du von Komponenten. Dann werden alle Komponenten hergestellt.
Also die Suppe, die Hauptspeise, die Beilage, was auch immer. Und der hier arbeitet, muss jetzt die Einrichtung in einen Thermoport geben. Also die Suppe, die Hauptspeise, die Beilage.
Simone Koren-Wallis:
Der Thermoport ist dort, wo es kühl bleibt? Genau.
Franz Gerngroß:
Die Thermoports ist so ähnlich, wie hoffentlich jeder tut. Wenn er im Sommer einkaufen geht, die Milch gehört in die Kühltasche oder in die Kühlbox. Das ist die Kühlbox. In der Früh kommt dann ein Kühlakku rein und so kommt er dann auf den LKW und wird zugestellt.
Simone Koren-Wallis:
Wäre das möglich, heute zu kochen und heute auszuliefern?
Franz Gerngroß:
Ganz sicher, ja. Würde ich Cook & Serve machen, also das ist das, was jeder macht, kochen und servieren und essen, dann dürfte ich nur drei Stunden warm halten. Das heißt, ich muss, jetzt haben wir es gerade neun, ich müsste jetzt zustellen für den, der um halb zwölf essen will. Hätte das Essen drei Stunden bei 75 Grad.
Und ob man jetzt Spinat ist für mich oder das Gemüse, wirklich ein klasses Beispiel. Wenn es in drei Stunden warm hält, dann schaut er sehr grau aus. Wenn du ihn aber kühlst und dann, wenn du ihn brauchst, regenerierst, hat er noch eine Farbe. Das Gemüse schaut noch angenehm aus und nicht grau. Es ist in der Gemeinschaftsverpflegung, glaube ich, die einzig mögliche Form. Außer du sagst, du hast, wir haben es ausgerechnet, ich würde um die zwölf Fahrzeuge brauchen.
Und die Fahrzeuge hätten eine Kilometerleistung von unter 30 Kilometern und würden nie länger als drei, pro Tag drei Stunden im Einsatz sein.
Simone Koren-Wallis:
Wer denkt sich die Gerichte aus?
Franz Gerngroß:
Grundsätzlich machen das die Köche gemeinsam, der Küchenchef auf alle Fälle. Wir haben im Speiseplan noch eine Abstimmung mit Styria Vitalis oder mit einem anderen Ernährungsberater, dass die ernährungsphysiologischen Grundsätze noch mit bedacht werden oder überprüft werden. Wir haben einen Acht-Wochen-Speiseplan, also alle acht Wochen wiederholen sich die Gerichte. Ein paar Diäten, also Zöliakie und Laktose und von dort die Ableitungen mit und ohne Fleisch, die halt ethnisch auch gefordert sind.
Simone Koren-Wallis:
Küche Neu-Graz, das Stichwort.
Franz Gerngroß:
Ja, wird ein super Projekt, alles neu. Wir werden besser kochen, das ist das, was man immer wieder sagt, dass wir besser kochen können. In Wirklichkeit, es kann nicht viel besser werden. Wir haben mehr Möglichkeiten mit neuen Geräten, kürzere Kochzeiten, schnellere Rückkühlzeiten, dass wir mehr Vitamine, mehr Mineralstoffe, vielleicht können wir auch die Vielfalt erhöhen. Statt vegan würde mich mehr interessieren, für die Grabbler ein eigenes Menü zu machen, weil du hast Kinder, ich habe Kinder. Das einzige Problem, was wir hatten, war, dass sie ganz klein waren. Da haben sie eine Breikost gebraucht oder eine zerdrückte Kost, weicher, kleiner geschnitten. Das passt nicht so ganz zur Gemeinschaftsverpflegung. Also da glaube ich schon, dass man was machen sollte.
Jetzt haben wir das Problem, die Suppennudeln sind so klein, weil wir es für die Kleinsten abstimmen müssen. Dann könnten die Suppennudeln wieder größer sein, was für die Großen wieder lustiger ist. Vor allen Dingen brauchen sie ja die Skills dazu, dass nichts vom Löffel runterfällt. Also das sollten wir auch ein bisschen lernen. Und mit dem Essen lernen sie das, weil sie wollen was essen.
Simone Koren-Wallis:
Ist ja klar. Wo kommt die neue Küche gerade hin? Wann ist sie fertig?
Franz Gerngroß:
Also hin kommt sie in die Herbert-Wies-Gasse, wo der ehemalige Club Hybrid war. Fertigstellung sollte 2026 sein. Das ist ein ambitioniertes Tempo, was wir da derzeit haben für die neue Küche. Was ganz spannend wird, ist, dass wir versuchen werden, noch mehr auf die Umwelt zu schauen. Die Kühlhäuser sind größer, dass die Anlieferungsstops weniger werden, dass ein Lieferant nur einmal oder zweimal kommt. Jetzt sind wir so klein, dass er fast drei bis viermal in der Woche kommen muss. Ich habe keinen Platz, dass ich die Sachen irgendwo lagere, weder im Tiefkühlhaus. Ich zeige dir dann alles. Sie sind romantisch klein, aber nicht für die Großküche. Und wenn es das dann noch einmal kommen lassen muss, statt dreimal, wäre das schon recht anständig. Wir können dann vielleicht bei CookChill 72 Stunden produzieren, etwas vorkochen, weil wir einfach den Platz haben zum Lagern. Somit haben wir mehr Zeit für einen weiteren Speiseplan. Das ist das, was mir da eigentlich vorschwebt.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt wird gerade die neue Küche Graz geplant, aber es ist meine Standardfrage. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Franz Gerngroß:
Ich wünsche mir eigentlich gar nicht so viel für die Küche Graz, aber für die Zukunft das Ernährungsbewusstsein, was ich vorher schon gesagt habe. Das ist wirklich etwas, was ich mir sehr, sehr wünsche. Weil auch die Küche Graz, jeder Koch, jeder, der produziert, wird permanent nur geschimpft. Uns kann jeder sagen, was wir kochen sollen, wir würden es machen. Wichtig ist mehr bei den Kunden, bei den Kindern. Und da gehören die Erziehungsberechtigten dazu, da gehören die Pädagoginnen dazu, die Betreuerinnen. Die Überzeugung, gesundes Essen wäre wichtig.
Ich will es nicht immer nur aufs Klima runterbrechen. Es ist schlicht und einfach für den Körper erforderlich, gesund zu essen.
Simone Koren-Wallis:
Von einem Lokal-Augenschein zum nächsten. In der nächsten Folge bin ich mit der Verkehrsüberwachung der GPS unterwegs. Wir hören uns, ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 49: Unser Klima-Pakt für ein klimaneutrales Graz 2040
Klimaschutz sind wir alle. Deshalb trägt jede:r mit seinem Verhalten dazu bei. Die Stadt Graz hat das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein. Dafür braucht es das Mitwirken von allen. Jetzt setzen viele Grazer Betriebe und Organisationen bzw. Arbeitgeber:innen mit ihrer Unterschrift zum Klima-Pakt #bindabei ein deutliches Zeichen.
Thomas Drage, Klimaschutzkoordinator der Stadt Graz, erklärt den Pakt und zeigt auf, wie wichtig das Mitmachen ist. Das beste Beispiel: Die Marienhütte in Graz rund um GF Markus Ritter.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Dieses Mal geht es um einen Pakt, den Klimapakt der Stadt Graz für ein klimaneutrales Graz 2040. Wie das funktionieren soll, wie jeder von uns dabei sein kann und vieles mehr, das hören wir in dieser Folge. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation, meine Gäste Thomas drage und Markus Ritter.
Thomas Drage:
Hallo, mein Name ist Thomas Drage. Ich darf das Referat für Klimaschutzkoordination und Förderprojekte in der Stadtbaudirektion leiten. Und wie der Name schon vermuten lässt, gemeinsam mit dem Umweltamt koordinieren wir den städtischen Klimaschutzplanprozess.
Markus Ritter:
Hallo, mein Name ist Markus Ritter. Ich betreibe in Graz ein Elektro-Steuerwerk. Wir machen Betonstellen mitten in Graz und versorgen Graz mit Fernwärme.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Wir sind im Grazer Stahlwerk Marienhütte. Wie das mit dem Grazer Klimapakt zusammenhängt, darüber reden wir später noch. Aber wir fangen jetzt einmal ganz von vorne an. Lieber Thomas, Klimaschutz in Graz, wo stehen wir?
Thomas Drage:
Ich glaube, dass wir eine gute Dynamik momentan erleben, was das Thema betrifft. Klimaschutz auch Anpassung, die mindestens gleich wichtig ist. Wir haben vor drei Jahren in etwa einen sehr umfassenden Klimaschutzplanprozess gestartet. Das heißt, wir haben uns einmal angeschaut, welche Emissionen fallen im Stadtgebiet eigentlich an. Wir wissen jetzt, es sind im Jahr etwa eineinhalb Millionen Tonnen. Wir haben uns auch angeschaut, was verursacht das Haus Graz, also die Verwaltung mit seinen Beteiligungen. Das sind in etwa drei Prozent. Und der Gemeinderat hat beschlossen, einstimmig bis 2040 soll das Stadtgebiet dekarbonisiert werden. Das heißt, diese Emissionen um etwa 90 Prozent reduzieren. Und auch entscheidend ist, jährlich sollen etwa 10 Prozent reduziert werden, damit auch der Pfad dorthin passt, damit wir jährlich genug einsparen, um das Paris-Ziel, also alles zu unternehmen, um die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten, damit wir dem entsprechen können. Jetzt haben wir diese Situation gehabt. Der Gemeinderat hat beschlossen, Zielsetzung Graz 2040 klimaneutral. Dann war die Frage, welche Maßnahmen setzen wir jetzt und wer setzt Maßnahmen? Und da haben wir uns dann so eine Dreiteilung überlegt. Wir haben gesagt, einmal haben wir wirklich diese drei Prozent Emissionen, das heißt städtische Gebäude, unsere Fuhrparks, Busse, Straßenbahnen, die Services, die wir anbieten, die Emissionen verursachen. Und da können wir selbst Maßnahmen erarbeiten, um die zu dekarbonisieren. Und da sind 400 Maßnahmen erarbeitet worden von über 100 Kolleginnen, also echt eine tolle Gemeinschaftsleistung im Haus Graz, mit der wir in etwa 70 Prozent der Emissionen bis 2030 reduzieren können. Da wissen wir, in welchem Jahr, welche Maßnahme, welche Mehrkosten entstehen da. Ja und jetzt bleiben 97 Prozent der Emissionen über. Wie tun wir mit denen? Und da haben wir gesagt, da sehen wir zwei Perspektiven. Eine Rolle von Haus Graz ist noch einmal eine ganz starke, nämlich da, wo wir Stadtgebiet gestalten können im Sinne von wir setzen Rahmenbedingungen, wir steuern. Das beginnt bei der Raumordnung, Stadtentwicklungskonzept, wo wir sagen, welche Flächen sind wofür möglich. Das ist alles das Thema ÖV-Ausbau, Radausbau, Radwegeausbau, Infrastruktur für sanfte Mobilität. Förderungen, die wir ausleben, womit wir sagen, wir möchten nicht fördern, was wir eben haben wollen im Sinne des Klimaschutzes. Und dann bleiben aber immer noch Emissionen über, die wir damit weniger beeinflussen können. Und da haben wir gesagt, das ist dieser dritte Teil dann, der verlangt, dass jetzt Personen und Organisationen selbst aktiv werden und sagen, von mir aus als Unternehmen oder als Einzelperson, ich schaue mir an, wo ich stehe, was habe ich für eine Zielsetzung und welche Maßnahmen kann ich selber für mich umsetzen als Organisation oder als Person. Und so sind wir zu dem Klimapakt gekommen, nämlich den Gedanken, dass dieses Bekenntnis zur Notwendigkeit was zu tun, gemeinsam was zu tun, weil nur so gemeinsam können wir dieses 2040-Ziel erreichen. Ein Paktschlag sozusagen der Stadtgesellschaft, gemeinsam Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, um das Klimaschutzziel 2040 zu erreichen.
Simone Koren-Wallis:
Was steht da jetzt aber in diesem Pakt genau drinnen? Also um was geht es da genau?
Thomas Drage:
Der Pakt ist eben genau ein Bekenntnis, der sagt, ja, es gibt diese Notwendigkeit. Wir sehen das täglich, wenn wir in den Medien schauen, wenn wir aus dem Fenster schauen. Wir müssen was tun. Es ist entweder viel zu heiß, es regnet viel zu, wir haben einen Wirbelsturm gerade gehabt. Also Klimawandel zeigt sich, Extremwetterereignisse nehmen zu in Graz.
Das sieht man, das nehmen wir alle wahr. Der Pakt sagt jetzt, ich bekenne mich dazu, dass ich mir anschaue, was ist mein Fußabdruck, mein CO2-Fußabdruck, den ich habe, dass ich mir ein Ziel setze, eben diesem 2040-Ziel entsprechend. Beispielsweise haben einige Unternehmen auch schon das Ziel, 2035 klimaneutral zu sein. Die sind teilweise auch ambitionierter noch als die übergeordneten Ziele. Und dann eben Maßnahmen zu setzen und zu schauen, wie geht es mir bei der Umsetzung. Das alles ist der sogenannte Fußabdruck. Also das, wo ich Teil des Problems bin, haben wir mal gehört, das gefällt mir gut. Und dann gibt es aber das, wo ich Teil der Lösung bin. Das ist da, wo ich als Unternehmen, auch als Person, anderen dabei helfe, klimafreundlicher leben, arbeiten, wirtschaften zu können.
Als Beispiel, wenn ich kommuniziere, was andere machen können, wenn ich als Unternehmen anbiete, vegetarische Alternativen in der Kantine, wenn ich klimafreundliche Mobilität als Betrieb fördere, wenn ich generell Produkte herstelle, die anderen helfen, von Emissionen runterzukommen. Wenn wir Fernwärme zur Verfügung gestellt bekommen aus Abwärme, die hilft, klimaneutralere Wärme zu beziehen. Das alles wäre irgendwo Handabdruck vergrößern. Also es geht beim Pakt darum, dass wir sagen, Bekenntnis dazu, wir wollen unseren Fußabdruck reduzieren und unseren Handabdruck, Gutes tun, drüber sprechen, maximieren.
Simone Koren-Wallis:
Du hast schon in Richtung Herrn Ritter geschaut. Lieber Herr Ritter, bevor wir über den Pakt sprechen, vielleicht kennt nicht jeder die Marienhütte. Können Sie kurz einmal erklären, was macht ihr da? Man sieht die Marienhütte ja eigentlich schon von Weitem.
Markus Ritter:
Wenn man genau hinschaut, sieht man sie. Ja, was machen wir? Wir betreiben ein Elektrostahlwerk. Das heißt, wir machen Betonstahl in diesem Elektrostahlwerk. Und jetzt kann man das auf zweierlei Arten betrachten. Entweder betrachtet man es als Hersteller eines für eine moderne Bauwirtschaft unverzichtbaren Bauproduktes, wo wir eben Abfall einsetzen dazu. Man kann es umgekehrt sehen, wir sind eigentlich ein Abfallverwerter, wo zufälligerweise ein brauchbares Produkt hinten rauskommt, je nachdem, wo man den Fokus hinsetzt. Wir sagen zu dem Ganzen, wir sind Upcycler. Wir sind es weder unbedingt Recycler, wir sind es auch nicht mehr nur Produzent, wir sind eigentlich Upcycler und stellen uns möglichst in den Dienst der großen Stoffkreisläufe.
Was zeichnet uns aus, was ist an uns besonders? Ich glaube, was schon besonders ist, ist der Anspruch, denn wir haben das Sämtliche, alles was in der Marienhütte, was da hineinkommt, an Produkten, an Vorlieferungen, dass das auch auf eine sinnvolle Weise so verwertet wird, dass es dann nicht mehr verbrannt oder deponiert oder sonst was werden muss. Das heißt, was kommt bei uns rein? Schrott, ein Abfallprodukt, wir machen daraus Stahl. Kalk kommt bei uns rein, daraus machen wir Kunstgestein, wo man Naturschrott ersparen kann.
Es entsteht bei uns eine große Staubfracht, da ist sehr viel Zink drinnen, mehr Zink als im Zinkerz, geht ins Zinkrecycling, ist also auch kein Abfallprodukt. Es entsteht viel Wärme bei uns, das ist das Stichwort, das vorher gefallen ist und auch diese Wärme wird soweit irgend möglich entfernt. Wenn man jetzt abgegeben sollte, muss man sagen, alles was bei uns irgendwie reinkommt, wird im Kreislauf geführt und da wird nix deponiert, nix verbrannt, nix irgendwo vergraben und am Ende des Tages verschwindet eine Abfallfraktion und entstehen Produkte daraus. Und das ist, glaube ich, so sollte es auch sein und das ist der Anspruch, den wir haben.
Simone Koren-Wallis:
Und warum habt ihr jetzt gesagt, bei diesem Pakt, da machen wir mit?
Markus Ritter:
Wenn man ein Stahlwerk mitten in der Stadt betreibt, immerhin mitten in der zweitgrößten Stadt Österreich, also im Ballungsraum betreibt, ist man von Haus aus, seit jeher getrieben, möglichst so zu betreiben, dass keine Emissionen, keine Belästigung, keine Belastungen entstehen. Das Thema Nachhaltigkeit, Emissionsreduktion, Effizienz haben wir schon sehr früh sehr intensiv betreiben müssen. Andernfalls wären wir den Anrainer zu stark auf die Nerven gefallen. Wir haben immer den Anspruch an uns gestellt, wir müssen eigentlich den größten Stahl der Welt machen und im Moment, glaube ich, können wir das sogar behaupten und das wollen wir weiter so handhaben. Und deshalb natürlich, wenn es dann so ein Ding gibt, wenn ein Klimapakt in der Stadt, in der wir produzieren, wo wir mittendrin, sondern Teil der Stadt sind, können wir nicht vorbeigehen dran, muss das für uns auch eine Herzensangelegenheit sein.
Simone Koren-Wallis:
Aber was macht ihr jetzt genau?
Markus Ritter:
Unser Problem ist eigentlich, dass wir die meisten der Hausaufgaben, die man machen kann, die meisten Emissionen, die man üblicherweise reduzieren kann, gibt es bei uns schon auch nicht mehr. Daher tut es uns ein bisschen schwer jetzt zu sagen, was machen wir noch. Also das Ziel ist bis 2030 das Waldwerk komplett zu dekarbonisieren, bis 2040 das Stahlwerk. Das ist relativ ambitioniert, aber wir glauben, dass wir das schaffen.
Thomas Drage:
Was bei dem Pakt auch ein Grundgedanke war, es passiert so viel Tolles in Graz schon und Klimaschutz soll nicht immer was sein, wo man denkt Einschränkung und Reduktion, sondern auch Chance. Und das finde ich auch, wir haben mit den Wirtschaftstreibenden, mit den großen Arbeitgebern diesen Paktprozess auch gestartet, weil ich glaube, dass das für den Standort eine große Chance ist. Also ich glaube, ohne dass wir blauäugig sind, natürlich ist die Situation für Unternehmen herausfordernd. Lohnerhöhungen und so, es gibt viele Sorgen, die Unternehmen, glaube ich, auch haben momentan. Aber ich glaube, das ist was vom Pakt, was uns wichtig ist, dass wir diese Dynamik, die schon da ist, die wollen wir zeigen, die wollen wir noch sichtbar machen, irgendwo eine Plattform dafür sein, Austauschmöglichkeit bieten für Unternehmen, die da eben schon auf einem sehr guten Weg sind. Das ist also dieses positive Verstärken, ein Grundgedanke von diesem Pakt.
Simone Koren-Wallis:
Herr Ritter, wie haben Sie das vorher gesagt, Sie finden den Namen Pakt auch so gut, oder?
Markus Ritter:
Ja, ja, ich finde den Namen Pakt eben deshalb gut, weil dem Pakt einerseits, dem Wort Pakt und dem Begriff des Paktes in ihr wohnt, dass es etwas ist, was man freiwillig eingeht. Das ist nichts, was hoheitlich erzwungen wird von irgendeinem bösen Gesetzgeber oder einem bösen Bürokraten in Brüssel, sondern es ist etwas, was man freiwillig aufgrund eigener Überzeugungen eingeht. Aber es ist trotzdem nicht nur Larifarie und Gewäsch, sondern es ist was Verbindliches, ein Pakt. Und darum befindet den Begriff gut, er verbindet diese beiden Komponenten des freiwilligen, verbindlichen Vorgehens auf optimale Weise. Und weil die Frage war, warum sind wir dabei, eben genau das. Weil das ist die Art und Weise, wie man Klimaschutz meiner Meinung nach richtig machen sollte. Man soll es nicht hoheitlich machen, man soll es nicht nur mit Greenwashing machen, sondern mit einem Pakt.
Simone Koren-Wallis:
Und wie kann man mitmachen?
Thomas Drage:
Es genügt ein einfaches E-Mail an klimaschutz.stadt.graz.at. Man kann jederzeit in den Pakt einsteigen und einmal im Jahr möchten wir eine große feierliche Auszeichnungsveranstaltung machen, wo wir dann eben auch die, die neu dazugekommen sind, vor den Vorhang holen möchten.
Simone Koren-Wallis:
Und wie geht es dann mit dem Klimapakt weiter?
Thomas Drage:
Den Pakt wirklich öffnen und irgendwann wäre so die Wunschvorstellung, ein wirklich zivilgesellschaftlicher, stadtgesellschaftlicher Pakt, wo alle sagen, bin ich dabei.
Simone Koren-Wallis:
Und 2040 wird dann ganz groß gefeiert.
Markus Ritter:
2040 wird klimafreundliches Verhalten, so wie wir es im Pakt fördern wollen, für jeden so selbstverständlich sein, dass er gar nicht auf die Idee kommt, das zu feiern. Es wird den Leuten in Fleisch und Blut übergegangen sein.
Simone Koren-Wallis:
Und es wird zur Normalität.
Markus Ritter:
Es wird zur Normalität sein.
Simone Koren-Wallis:
Nächstes Mal mache ich einen Lokal-Augenschein zum Anhören. Und zwar in der Küche Graz, wo jeden Tag bitte schön 9500 Portionen Essen gekocht werden. Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 48: Projekt "Klimalicht": Ein Monat fleisch- und autofrei leben
Es ist ein österreichisches Vorzeigeprojekt im Rahmen der Klimapionierstadt Graz: "Klimalicht"
14 Kolleg:innen aus dem Haus Graz haben gemeinsam mit ihren Haushaltsmitgliedern einen Monat fleischfrei und autofrei gelebt. Wir ziehen in dieser Folge mit Projektleiterin Gudrun Rönfeld und Teilnehmer Hans Schweyer eine Bilanz und haben auch Tipps, was jede:r von uns für das Klima selbst tun kann.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Wie ist es eigentlich, wenn man ein Monat lang auf Fleisch und auf das Auto verzichtet? Einige Kollegen und Kollegen haben genau das ausprobiert. Und zwar beim Projekt Klimalicht. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste Gudrun Rönfeld und Hans Schweyer.
Gudrun Rönfeld:
Mein Name ist Gudrun Rönfeld. Ich arbeite in der Magistratsdirektion in der strategischen Personalentwicklung. Und dort beschäftige ich mich mit dem Thema Klimaschutz. Gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Wohlfahrt.
Hans Schweyer:
Mein Name ist Hans Schweyer. Ich bin in der ITG als Projektleiter.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Gudrun, magst du mal bitte erklären, was ist das Projekt Klimalicht?
Gudrun Rönfeld:
Ja, das Projekt Klimalicht ist entstanden in der Klimapionierstadt. Das ist ein Projekt, das die nächsten fünf Jahre in der Stadt Graz läuft. Und innerhalb dieses Projekts haben wir in der strategischen Personalentwicklung das Klimalicht erfunden. Wir haben aus unterschiedlichen Abteilungen Kolleginnen und Kollegen gefragt, ob sie einen Monat lang bereit sind, fleischfrei und autofrei zu leben.
Simone Koren-Wallis:
Wieso fleischfrei und autofrei?
Gudrun Rönfeld:
Ja, diese beiden Themen sind die großen CO2-Treiber. Das heißt, in diesen beiden Bereichen im Verkehr und auch bei der Ernährung, also bei unserem aller Essen, liegen große Einsparungspotenziale, wenn es ums Thema Klimaschutz geht.
Simone Koren-Wallis:
So, jetzt warst du natürlich da federführend, hast aber auch mitgemacht, glaube ich, gell?
Gudrun Rönfeld:
Ja.
Simone Koren-Wallis:
Und dann habt ihr noch viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus Graz gefunden. Und einer sitzt eben jetzt auch am Tisch. Wieso hast du gesagt, hey, da mache ich mit?
Hans Schweyer:
Ja, ich habe das spannend gefunden. Vor allem, weil ich bin so ein klassischer Fleischesser. Ja. Da habe ich mir gedacht, das probiere ich mal aus. War irgendwie eine spannende Herausforderung. Also wir haben wirklich vom ersten Tag weg auf Fleisch verzichtet. Nicht nur wir als Kollegen und Teilnehmer, sondern auch unsere Familien. Das war die große Herausforderung auch. Also wir haben eine fünfjährige Tochter und haben sie auch mit dem Fahrrad in den Kindergarten gebracht und haben auch versucht, dass auch sie möglichst auf Fleisch verzichtet. So weit es gegangen ist beim Kindergartenessen war das nicht so ganz, aber im täglichen Leben und zu Hause an dem Wochenende haben wir völlig auf Fleisch verzichtet. Hat super funktioniert.
Simone Koren-Wallis:
Also war ein Monat Klimalicht. Ihr seid die Klimalichter. Das heißt, wir ziehen eine Bilanz. Wir ziehen ein Resümee. Du hast jetzt sicher mit allen auch gesprochen. Wie ist so das Resümee allgemein?
Gudrun Rönfeld:
Die erste Bilanz sieht so aus, dass eine Kollegin ihr Auto verkaufen wird. Ja, sie ist auf den Geschmack gekommen. Wir haben ja nicht nur verzichtet, sondern auch Angebote gestellt. Wir haben ja E-Lastenräder zur Verfügung gestellt. Die Holding Graz, die eine Partnerin in diesem Projekt ist, hat uns TIM-Mitgliedschaften einen Monat lang zur Verfügung gestellt. Klimatickets für jene, die noch keines hatten. Und so haben eben unsere Kolleginnen und Kollegen mit ihren Familien tatsächlich eben klimafreundlicher leben können. Die Bilanz ist ein Auto weniger auf jeden Fall auf diesen Straßen. Zwei Kolleginnen, glaube ich, Hans, haben vor, ein E-Fahrrad sich zuzulegen nach diesem Probemonat.
Hans Schweyer:
Genau, und ein Kollege hat auch gesagt, er wird sein altes Fahrrad, das inzwischen kaputt im Keller steht, wieder reparieren und in Dienst nehmen. Was ja auch sehr nachhaltig ist. Nicht alles zu kaufen, sondern wirklich das, was man hat, wieder weiterzuverwenden. Und es hat sich bei allen, oder auch bei mir kann ich das so sagen, eingeprügelt, dass wir viel bewusster unser Auto verwenden. Also wir haben ja ein Auto, haben das auch in der Vergangenheit schon nicht täglich verwendet. Aber wir verwenden es jetzt wirklich nur, wenn jetzt das Wetter wirklich sehr schlecht ist.
Simone Koren-Wallis:
Haben wir ja nie heuer.
Hans Schweyer:
Ja, wir haben ja den besten Monat für das Autofreie gehabt. Also wir haben alle Erfahrungen gesammelt, wie man sich gut vor Regen schützt beim Radfahren. Eben, wenn größere Transporte anstehen, dass wir da das Auto verwenden, aber es eigentlich sonst stehen lassen. Und das hat für uns eigentlich eine neue Definition von Genuss gehabt. Also nicht das Thema Verzicht, sondern eher zu schauen, wie kann ich das Leben ohne Auto oder auch ohne Fleisch gut genießen. Vegetarisch essen war immer so ein Verzicht. Und ich war vor unserer Aktion bei einer Veranstaltung über klimagerecht kochen. Und da habe ich mir gedacht, das ist alles kein Essen.
Das war alles sehr gesund, nichts üppiges oder war nichts dabei. Und ich habe festgestellt, auch in dem Monat, es gibt cooles Essen. Es gibt auch cooles vegetarisches Junkfood. Es muss nicht immer alles super gesund sein und kann trotzdem vegetarisch ohne Fleisch sein und kann super lecker schmecken.
Gudrun Rönfeld:
Wir haben deswegen einen Monat gewählt für dieses Projekt Klimalicht, weil man tatsächlich nach einem Monat auch eingefahrene Verhaltensweisen und Verhaltensmuster, die man immer schon gewöhnt ist, umlernt. Also nach einem Monat ist es wirklich möglich, dass man sagt, okay und jetzt mache ich aus diesem Aktionsverhalten, also sprich ich fahre mit dem Fahrrad einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal einen Monat lang. Ich kann mir vorstellen, das länger zu tun. Das weiß man einfach aus der Verhaltensforschung.
Simone Koren-Wallis:
Und jetzt seid ihr nicht nur Klimalichter, sondern auch ein bisschen Vorbilder geworden, vermutlich in diesem Monat. Was erhofft ihr euch jetzt aus dem Projekt Klimalicht?
Hans Schweyer:
Das, was ich gemerkt habe jetzt auch in den letzten Tagen, jeder kann in seinem Umfeld etwas tun, um klimawirksam zu sein. Es wird sehr oft sehr verallgemeinert und man ist sehr schnell da mit Argumenten, was alle nicht können.
Simone Koren-Wallis:
Das ist typisch österreichisch.
Hans Schweyer:
Und wir haben jetzt in den Diskussionen, in den letzten, die ich geführt habe, auch immer diese Argumente gekommen sind, aber dafür haben doch die meisten kein Geld oder dafür, das kann man doch nicht, da wohnt man so weit draußen, was auch immer. Diese man-Argumente haben wir dann reduziert auf, was kann ich, was kannst du? Da gibt es immer etwas, was man tun kann.
Simone Koren-Wallis:
Jeder einzelne?
Hans Schweyer:
Jeder einzelne.
Gudrun Rönfeld:
Die Frage, wie das jetzt weitergeht, wir haben jetzt eben diese 14 Klimalichter mit ihren Familien, das heißt, es hat schon ausgestrahlt. Und wir werden natürlich im Herbst weitermachen. Wir evaluieren das ganze Projekt, das heißt schauen, wie hat sich jetzt die Einstellung und das Verhalten über einen längeren Zeitraum hin verändert.
Und wir werden schon schauen, dass wir eine sogenannte Lernumgebung aufbauen. Wir arbeiten ja in der strategischen Personalentwicklung, das heißt schauen, dass wir viel mehr Klimalichter noch in dieser Stadt unter Kollegen und Kolleginnen dazu motivieren, entweder mitzutun oder auch, dass diejenigen, die in den unterschiedlichsten Abteilungen jetzt arbeiten, auch ihr Wissen weitergeben.
Simone Koren-Wallis:
Und ich glaube, das ist es ja, was du gesagt hast. Meine Familie hat mitgemacht und du hast ja sicher auch Freunden und Bekannten in der Familie habt ihr ja richtig berichtet. Und da wird vielleicht, wenn da nur einer, oder, auch sich sagt, ah, dann nehme ich mal ein bisschen an der Nase und verzichte vielleicht auch einmal auf Fleisch oder auf mein Auto, gewonnen, oder?
Hans Schweyer:
Wir waren am ersten Wochenende zum Grillen eingeladen und haben denen dann erzählt, dass wir jetzt da mitmachen und jetzt auf Fleisch verzichten. Und die haben gesagt, gar kein Problem, dann grillen wir halt Gemüse. Und sie haben zwar für die Kinder dann so ein paar Würstchen gehabt, das war auch okay, aber es waren 90 Prozent Gemüse, die wir gegessen haben mit allen möglichen Soßen. Wir haben es genossen und es war kein Verzicht.
Simone Koren-Wallis:
Wenn jeder ganz klein anfängt, ist das schon der Startschuss für eine Veränderung, oder?
Gudrun Rönfeld:
Ja, klein anfangen, man kann auch größer anfangen. Ein großes Anfangen wäre zum Beispiel bei der eigenen Mobilität. Der Verkehr ist ein riesengroßes Thema. Und da zu sagen, ich weiß nicht, ob es notwendig ist, tatsächlich die nächste Reise mit dem Flugzeug zu machen. Ich weiß, das ist auch eine Frage des Geldes. Das Fliegen ist noch immer so günstig im Vergleich zum Bahnfahren. Obwohl da einiges getan wird, keine Frage. Aber zu sagen, ein Langstreckenflug ist etwas, was deine Bilanz, die CO2-Bilanz wirklich zusammenhaut. Das ist schon auch eine Botschaft, sich das wirklich bewusst zu machen, ob das notwendig wird und ob es für alle in Zukunft immer möglich sein wird.
Hans Schweyer:
Ich bin ja so ein reisender Negativbeispiel. Vor Klimalichten bin ich nach Bangkok geflogen. Und ganz bewusst auch gesehen, dass wenn man einen Langstreckenflug einspart, ich habe diesen Fußabdruckrechner gemacht.
Simone Koren-Wallis:
Wo findet man den Fußabdruckrechner?
Gudrun Rönfeld:
Fußabdruck.at.
Hans Schweyer:
Ich habe das einmal mit und einmal ohne gemacht und habe den halben CO2-Fußabdruck gehabt. Nur mit dem einen Flug. Es gibt sehr oft kleine Dinge, die man tun kann, die große Wirkung haben.
Gudrun Rönfeld:
Ein paar Tipps gibt es schon. Das mit dem Fliegen haben wir schon gesagt. Oder auch tatsächlich auf Rindfleisch zu verzichten oder in Maßen zu essen. Rindfleisch hat einen riesengroßen CO2-Fußabdruck. Elektronische Geräte nicht alle zwei, drei Jahre auszutauschen, sondern die Nutzungsdauer zu verlängern auf mindestens sieben Jahre. Was waren da noch für Tipps?
Hans Schweyer:
Es war beim Fleisch zum Beispiel. Wenn Fleisch diskutiert ist, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob man absteigend Rindfleisch, Lammfleisch, Schweinefleisch oder Hühnerfleisch isst. Weil Geflügel einen wesentlich geringeren Fußabdruck hat als Rindfleisch. Es reicht schon zu sagen, wenn ich schon auf Fleisch nicht verzichten kann, ich esse dann ein Hühnersteak. Nicht ein Rind.
Gudrun Rönfeld:
Oder, weil wir noch einmal vom Konsum gesprochen haben, maximal drei Kleidungsstücke pro Jahr sich zu kaufen. Nachhaltig oder vielleicht auch gebraucht. Da gibt es einen ganz großen Markt und nicht alles neu, sondern recyceln, wiederverwerten, wiederbrauchen, reparieren lassen. Also all diese kleinen Dinge helfen natürlich, das Klima zu schützen.
Simone Koren-Wallis:
Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Hans Schweyer:
Schön wäre es, wenn es kein ausgefallenes Thema mehr ist. Sondern wenn es so ist, wenn sich das von selbst ergibt, dass man darüber diskutiert und auch stolz darauf ist, was man geschafft hat.
Gudrun Rönfeld:
Und ich wünsche mir, vom Reden ins Handeln zu kommen. Also wirklich eben auch etwas zu tun und bei sich selber anzufangen. Also das ist wirklich etwas, was wir jetzt gesehen haben. Auch in dieser Gruppe natürlich dieser Effekt, dass das eben ausstrahlt und nicht nur bei einem der, wie viele in den letzten Wochen mit ihren Freunden, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen darüber gesprochen haben, über das Thema Klimaschutz und was kann ich persönlich machen. Also das hat nicht positiv gestimmt. Also das ist etwas, was ich mir wünsche.
Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge geht es wieder ums Klima und zwar ganz genau um den Klimapakt, der Ende Juni unterzeichnet wird. Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 47: Jugendzentren in Graz: Dein Treffpunkt, Dein Rückzugsort!
Jugendzentren sind Orte, an denen Jugendliche Ihre Freizeit verbringen können! JUZ sind aber noch viel mehr als das, sie sind Orte, an denen man neue Leute kennenlernt, neue Talente ausprobieren kann, wo man sich zurückziehen kann und immer ein offenes Ohr findet. Denn in den 13 Grazer Jugendzentren sind auch immer ausgebildete Jugendarbeiter:innen da. Wir waren im YAP bei Regine Gamauf und Flo Hasiba.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Jugendzentren sind Orte, an denen Jugendliche ihre Freizeit verbringen können. Die sogenannten JUZ sind aber noch viel mehr als das und darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation und ich bin zu Gast im YAP bei Regine Gamauf und Florian Hasiba.
Florian Hasiba:
Mein Name ist Flo Hasiba, ich bin Sozialpädagoge und habe die Teamleitung im Jugendzentrum YAP.
Regine Gamauf:
Hallo, mein Name ist Regine Gamauf, ich bin von der Profession her Sozialarbeiterin und bin Mitarbeiterin im YAP.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Wir sind heute im YAP, jetzt ist natürlich die Frage, was ist das genau und vielleicht könntest du es ein bisschen beschreiben.
Florian Hasiba:
Also das YAP ist ein Jugendzentrum, eines von 13 Jugendzentren der Stadt Graz. Die Besonderheit am YAP ist, dass wir zum Amt für Jugend und Familie direkt dazugehören und einen sozialarbeiterischen Schwerpunkt auch haben.
Das heißt, wir unterstützen junge Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen, in Krisensituationen. Wir haben auch externe KooperationspartnerInnen wie Alphanova mit dem Jugendcoaching und sind, was die Jugendzentren zum Großteil ausmacht, eine Einrichtung, wo junge Menschen ihre Freizeit verbringen können im Alter zwischen 12 und 20.
Regine Gamauf:
Was für uns ganz wichtig ist, dass wir einen Raum schaffen, der für alle Jugendlichen offen sein soll, der wertfrei ist. Und wir natürlich da sind, wenn sie etwas brauchen. Also es ist ein Angebot in einer gesunden Beziehung möglich und dass wir auch die Rahmenbedingungen festlegen. Rahmenbedingungen müssen sein, damit das Miteinander natürlich auf eine respektvolle Art und Weise möglich ist hier drinnen. Ja, die Jugendlichen können eigentlich hier drinnen machen, in den Rahmenbedingungen natürlich, was sie gerne möchten. Und wenn Hilfe benötigt wird, sind wir da.
Simone Koren-Wallis:
Aber beschreibt es uns einmal, wenn das jetzt zum Beispiel ein Erwachsener hört, der denkt sich, hey, wie schaut so ein Jugendzentrum eigentlich aus?
Florian Hasiba:
Ja, wir haben, was jetzt die Räumlichkeiten betrifft, ungefähr 300, ein bisschen über 300 Quadratmeter Nutzungsfläche. Das ist vor allem für die Lage richtig groß und auf das sind wir auch sehr stolz.
Simone Koren-Wallis:
Wegen der Lage?
Florian Hasiba:
Direkt neben dem Orpheum? Direkt neben dem Orpheum, genau. Also wir sind relativ zentral gelegen. Man ist von uns aus in ein paar Minuten in der Innenstadt. Wir haben unterschiedliche Angebote, die wir den Jugendlichen zur Verfügung stellen. Von Playstation über Billard und Tischtennis. Wir machen zum Teil unterschiedliche Aktionen. Jetzt vergangenen Samstag haben wir gegrillt. Das war ziemlich cool, wo wir Budget haben, um das zur Verfügung zu stellen. Und was immer ein besonderer Anlass ist, um mit den Jugendlichen gemeinsam einfach zu feiern und einen coolen Nachmittag zu verbringen.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele, darf man eigentlich Kids sagen? Sind es Jugendliche? Wie viele Jugendliche kommen zu euch?
Regine Gamauf:
Es ist sehr unterschiedlich. Es ist auch je nach Zeit natürlich unterschiedlich. Wenn die in der Schule mehr zu tun ist, ist es ein bisschen weniger. Aber ich sage jetzt mal, so zwischen 20 und 50 Leute haben wir täglich. Das ist unterschiedlich, je nach Tag.
Simone Koren-Wallis:
Ihr habt die Grillerei schon angesprochen, aber ich glaube, da gibt es ja noch viel mehr, oder? Ihr seid ja mit Ausflügen, mit Workshops, oder? Also es geht wirklich über das Jugendzentrum hinaus.
Florian Hasiba:
Unser Kernangebot ist das, was wir in den Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Aber natürlich gibt es auch Dinge darüber hinaus. Wir fahren im Winter manchmal in die Therme. Da waren die Regine und ich erst vor kurzem vor ungefähr zwei Monaten mit einer Gruppe Mädchen in der H2O-Therme. Wir fahren manchmal Rodeln. Im Sommer gehen wir schwimmen. Meistens von uns aus gesehen in die Auster, weil es von der Lage her am besten erreichbar ist. Das in Kombination eben mit den Angeboten, die wir örtlich zur Verfügung stellen, das macht uns einfach aus. Und die Jugendlichen haben natürlich einen partizipativen Anteil auch daran. Das heißt, sie können sich Dinge wünschen, die sie gerne hätten. Und wir schauen dann einfach, was ist innerhalb unserer Rahmenbedingungen möglich, was können wir umsetzen, was können wir ihnen zur Verfügung stellen. Uns ist wichtig, dass wir einen sicheren Rahmen für die Jugendlichen zur Verfügung stellen. Und dass wir im Speziellen auch vulnerablere Gruppen, und dazu gehören auch die Mädchen, schützen und auch spezielle Angebote für Mädchen schaffen.
Simone Koren-Wallis:
Warum ist es für uns Mädels oder überhaupt für Mädels so wichtig?
Regine Gamauf:
Ganz salopp gesagt ist es so, dass sich die Burschen oft den Raum selber nehmen und Mädels das oft nicht tun.
Simone Koren-Wallis:
Es gibt aber auch ein eigenes Mädchenzentrum in Graz.
Florian Hasiba:
Das ist das Mädchenzentrum J.AM von Mafalda, wo wirklich nur Mädchen rein dürfen, keine Jungs. Finde ich super wichtig, weil es immer noch in Graz meiner Meinung nach zu wenig Räume für Mädchen gibt. Im Speziellen bei uns ist es so, dass wir gerade dabei sind, einen eigenen Raum für die Mädchen zu konzipieren. Das wollen wir jetzt im Laufe des Sommers dann auch in die Umsetzung dafür gehen. Und das J.AM ist halt wirklich ein ganz spezieller Bereich, wo sehr gut ausgebildete Fachkräfte auf die Bedürfnisse der Mädchen eingehen.
Auch die Mädels in Krisensituationen unterstützen, wo wir auch wirklich die Zusammenarbeit mit dem GEM sehr schätzen.
Simone Koren-Wallis:
Warum ist eure Arbeit so dermaßen wichtig?
Florian Hasiba:
Ich finde grundsätzlich ist es wichtig, Jugendlichen Räume zur Verfügung zu stellen, wo sie ihre Freizeit verbringen können. Ich finde es ist wichtig, dass man Angebote setzt, die den Interessen entsprechen. Aber auch, dass man zum Beispiel, so wie bei uns, ein Ambiente schafft, im Sinne von einem Café, wo die Jugendlichen was kaufen können und was leisten können. Das heißt, wir verkaufen Pizza, Toast, Snacks zum Umkostenbeitrag. Pizza kostet einen Euro, Toast kostet einen Euro. Dieses Gefühl, ich kann wohin gehen in einer Bar und kann mir dort auch was leisten. Was natürlich in anderen Kaffeehäusern oder Lokalen schwieriger wird, aufgrund der finanziellen Lage von vielen Jugendlichen.
Regine Gamauf:
Da gehört auch das soziale Lernen dazu. Das sind ganz, ganz simple Sachen, wie bitte, danke. Und ich finde schon, dass wir da eine sehr wichtige Arbeit machen, weil Jugendliche da einfach ein bisschen üben können, wie es dann ist. Wenn ich dann in ein normales Lokal gehe, wie sind dort die Regeln und so weiter. Also sie können einfach ein bisschen das soziale Lernen bei uns, um dann einfach sich vielleicht ein bisschen leichter zu tun.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt könnte einer oder andere denken, naja, aber für was gibt es daheim? Für was gibt es Eltern, die den Kindern das eigentlich beibringen sollten?
Regine Gamauf:
Ja, ich glaube, da hat einfach, ich sage jetzt mal, jede Familie wahrscheinlich seine Ressourcen und seine Defizite genauso. Und vielleicht werden da gewisse Sachen nicht abgedeckt, aber deswegen gibt es auch so etwas wie vielleicht ein Jugendzentrum. Wenn man sagt, da können sie sich dann ein bisschen ausprobieren.
Florian Hasiba:
Ich finde, dass wir grundsätzlich für alle Jugendlichen der Stadt Graz da sind. Aber natürlich sehe ich das auch im Speziellen bei uns mit unserem Auftrag, was das soziale Lernen betrifft. Wir haben ja einen Bildungsauftrag, einen informellen Bildungsauftrag. Und ich sehe uns schon auch so ein bisschen als Übungswiese. Wie kann ich mich gut in einer Gesellschaft bewegen? Welche Verhaltensregeln gibt es da? Und da finde ich das einfach cool, dass man das bei uns üben kann. Und wir stellen uns da gerne als Übungsfläche zur Verfügung.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt waren wir selber auch, wenn man mal hernimmt, wir waren selbst mal Pubertiere, sage ich mal gerne. Wir waren selber gerne in der Pubertät. Und ich weiß noch, ich war kein einfaches Pubertier. Müsst ihr starke Nerven haben manchmal?
Regine Gamauf:
Ja, also starke Nerven. Ich sage, es ist immer so, wie die Haltung auch ist. Und was für Erwartungen, dass ich habe und was für nicht. Also wie gesagt, es sind so gewisse Erwartungen wie ein Bitte, Danke. Das sind so ganz stinknormale Dinge, die sind da. Und sonst können sich aber die Jugendlichen, das würde ich vor allem sagen, in diesem wertfreien Raum aber so bewegen, wie sie das gern hätten. Sie haben ihre Sprache, ihre Lebenswelt. Und das muss man ein Stück weit auch lassen.
Und deswegen, ob ich starke Nerven brauche? Das könnte ich jetzt gar nicht sagen, weil mir die Arbeit unglaublich Spaß macht und eigentlich immer alles auf eine respektvolle Art und Weise handelbar ist und man auch super reden kann mit ihnen, wenn irgendwas ist. Ja, ich glaube, wie in jedem Job. Ganz normal. Also Nerven wie in jedem Job wahrscheinlich.
Florian Hasiba:
Ich finde, es gibt Tage, die sind herausfordernder als andere. Manchmal natürlich ist es so, dass wir uns schon auch so ein bisschen wie in einem, ich würde jetzt nicht sagen Konflikt-Minenfeld bewegen, aber natürlich bringen die Leute ihre Themen mit. Und es ist auch wichtig, dass man Konflikte löst und sie dabei unterstützt, Konflikte auf eine konstruktive Art und Weise zu lösen. Und das kann natürlich schon herausfordernd sein. Aber es macht auch Spaß. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass ich Einblicke in Lebenswelten bekomme durch meine Arbeit, die ich sonst nicht hätte. Weil wir ja da doch mit unterschiedlichen Communities zu tun haben, mit unterschiedlichen Nationalitäten zu tun haben. Und wenn ich nicht im YAP arbeiten würde, dann wären die Berührungspunkte mit diesen Menschen viel weniger.
Das würde ich jetzt, wenn ich das so betrachte, schade finden, weil da würde mir eigentlich einiges entgehen. Weil das da auch eine Chance ist, dass man halt andere Kulturen auch kennenlernt. Und wir ja doch in einer multikulturellen Gesellschaft leben. Und ich das sehr wertvoll finde, dass ich das so kennenlernen darf.
Simone Koren-Wallis:
Hast du ein Beispiel, um das ein bisschen greifbarer zu machen?
Florian Hasiba:
Ja, ich meine, es gibt in Grazia eine sehr große türkische und kurdische Community, auch Jugendliche aus Afghanistan oder Syrien, was ein bisschen aktueller ist, auch mit internationalen Konflikten behaftet oft auch. Ich finde, was so schön ist, dass man unterm Strich einfach merkt, egal wo jemand herkommt, es möchte einfach jeder in Frieden leben und sein Leben so gestalten, wie er oder sie das für sich möchte. Dass es schon Konflikte gibt, die aber kaum was mit Nationalitäten zu tun haben, sondern einfach, weil die Jugendlichen einfach Jugendliche sind. Das ist schön und das finde ich toll.
Simone Koren-Wallis:
Flo grinst gerade über das ganze Gesicht, wenn er darüber erzählt. Ich finde das gerade voll schön. Geht es dir da gleich?
Regine Gamauf:
Ja, es ist ein wunderschönes Arbeiten. Und wenn man im Sozialbereich ist, ist es so, dass man ja gegenseitig voneinander lernt. Sie lernen vielleicht von uns und wir lernen natürlich auch von Ihnen. Also man hat das Gefühl, ja, es ergibt einen Sinn, was man macht.
Florian Hasiba:
Ich finde, wir leisten einen sehr wertvollen Beitrag auch zur Gesellschaft. Das ist das, was die Aufgabe da für mich immer so wertvoll macht, dass wir den Leuten da was mitgeben. Ich finde, dass in allen 13 Jugendzentren in Graz so tolle Arbeit geleistet wird. Ich finde, dass die offene Jugendarbeit ein ganz wichtiger Bestandteil ist.
Simone Koren-Wallis:
Für alle, die vielleicht jetzt Kinder daheim haben, also Jugendliche, und sagen, hey, wann haben die Jugendzentren überhaupt offen, wann kann ich mein Kind dort hingeben, ab was für einem Alter?
Florian Hasiba:
Grundsätzlich gibt es eine Kerngruppe, für die wir uns hauptsächlich zuständig fühlen. Das ist im Alter zwischen 14 und 18. Und dann gibt es einen Spielraum drunter und drüber.
Simone Koren-Wallis:
Und Öffnungszeiten?
Florian Hasiba:
Das YAP hat geöffnet von Dienstag bis Samstag, von Dienstag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 13 bis 18 Uhr. Und auch das variiert von Jugendzentrum zu Jugendzentrum. Grundsätzlich haben wir Kernöffnungszeiten, das heißt zwischen 14 und 19 Uhr ist zwischen Dienstag und Samstag ein Jugendzentrum offen.
Simone Koren-Wallis:
Und kommen kann eigentlich wirklich jeder?
Regine Gamauf:
Also im YAP-Jugendzentrum und auch in den anderen weiteren zwölf Jugendzentren ist wirklich jeder willkommen. Wir haben alle eigentlich auf Instagram eine Präsenz. Man kann uns anschreiben, wenn man vorbeikommen will und sich das mal anschauen will. Das machen auch ab und zu Eltern, die sich einfach mal ein Bild machen wollen, ist überhaupt kein Problem. Das findet man auch auf der Magistrats Graz Homepage.
Florian Hasiba:
Auf graz.at/juz. Man kann sich dort Informationen holen, man kann dort schauen, wo kann ich wen erreichen. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, auch wieder neue Leute bei uns zu sehen, die vielleicht noch nicht da waren, die uns jetzt vielleicht aufgrund dieser Kampagne erreichen.
Simone Koren-Wallis:
Man hört es vielleicht im Hintergrund schon. Ihr habt es ja schon offen. Das heißt, wahrscheinlich müsst ihr schon wieder an die Arbeit gehen.
Regine Gamauf:
Genau, wir werden jetzt losstarten und schauen, was der Tag so bringt.
Simone Koren-Wallis:
Nächstes Mal geht es um ein sehr interessantes Projekt. Klimalicht. 14 Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus Graz leben nämlich gerade einen Monat lang autofrei und vegetarisch. Und wir schauen uns an, wie es ihnen ergangen ist.
Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 46: Mittendrin in der Grazer Waldschule
25% der Grazer Stadtfläche sind Wald! Mit ein Grund, warum es im Leechwald die Waldschule gibt.
Da lernen Klein (aber auch Groß) Dinge wie: Wie schaut ein Dachsbau aus? Wie kann man Brennnessel angreifen? Und: wie schmecken die?
Ein Besuch mit einer 3. Klasse der Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule Steiermark bei den beiden Wald- und Kräuterpädagoginnen Andrea Joham und Michaela Friebes.
Intro/Simone Koren-Wallis:
25 Prozent der Grazer Stadtfläche sind Wald. Auch ein Grund, warum es im Lechwald die Waldschule gibt. Da lernen Klein aber auch Groß Dinge wie, wie schaut man eigentlich ein Dachsbau aus, wie kann man Brennnessel angreifen und vor allem, wie schmecken die eigentlich. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation und ich bin zu Gast bei Andrea Jocham und Michaela Fribes.
Andrea Jocham:
Hallo, mein Name ist Andrea Jocham, ich bin Waldpädagogin und diplomierte Kräuterpädagogin und arbeite in der Waldschule Graz am Leechwald.
Michaela Friebes:
Ja hallo, ich bin die Michaela Fribes, ich bin auch Wald- und Kräuterpädagogin und mein Arbeitsplatz ist auch die Waldschule am Hilmteich.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Versteckt, wirklich ganz versteckt im Grazer Leechwald, in der Nähe vom Helmteich steht die Waldschule. Zwei kleine Häuschen aus dem 19. Jahrhundert und das ist eben die Grazer Waldschule. Andrea und Michaela, was passiert da eigentlich genau?
Andrea Jocham:
Ja, also zu uns dürfen Kindergärten und Schulen, sowohl Volksschule als auch Mittelschule oder Gymnasien kommen und wir bieten da verschiedene Führungen an, um den Kindern einfach das Thema Wald näher zu bringen und gehen da durch und entdecken vielerlei Dinge und freuen uns immer, wenn es wuselt bei uns in der Waldschule und wenn schlechtes Wetter ist, haben wir eben auch eine Alternative. Wir haben eben diese zwei versteckten kleinen Häuschen, wo wir in einem Haus zum Beispiel die Möglichkeit haben, uns da kurz aufzuhalten und Tierpräparate herzeigen können, weil das ist auch nicht selbstverständlich und die Kinder, die haben ja fast nie den Zugang, eben verschiedene Präparate zu sehen. Manche fürchten sich sogar davon, die trauen sich dann oft gar nicht in die Häuser hinein, aber andere sind eben sehr entdeckungsfreudig und mutig und die freuen sich dann oft schon drauf, weil wir haben auch viele Gruppen, die viermal im Jahr zu uns kommen und uns besuchen. Da gibt es eben Kinder, die schon immer sagen, dürfen wir heute wieder rein, weil wir wollen wieder die Präparate sehen und das ist für uns halt auch immer schön, wenn die Kinder da mit so einer Begeisterung dabei sind.
Simone Koren-Wallis:
Das darf man sich jetzt nicht vorstellen wie im Zoo, da wird keine Giraffe, aber welche Tiere sieht man dort?
Michaela Friebes:
Wir haben nur heimische Tiere, also das heißt Tiere, die es bei uns teilweise im Leechwald oder in unseren Wäldern gibt, also mit Sicherheit keine Giraffe, obwohl wir das von den Kindern immer hören.
Andrea Jocham:
Denk an des Murmeltier, gell Michela?
Michaela Friebes:
Wir haben Riesenschlangen und so weiter...
Michaela Friebes:
Ich finde es total wichtig, im Museum kann man sich das anschauen, aber bei uns darf man es auch angreifen. Da kann man die Krallen angreifen oder mal schauen, wie spitz der Schnabel ist.
Simone Koren-Wallis:
Was habt ihr alles für Tierleins?
Michaela Friebes:
Was haben wir denn, fangen wir an beim Rehkitz, dann haben wir Marder, was haben wir noch? Verschiedene Vögel, Spechte, Eichelheer, Greifvögel...
Andrea Jocham:
...Geweih vom Hirsch haben wir zum Beispiel oder auch den Kopf und die Hörner vom Steinbock.
Michaela Friebes:
Oder wir haben eine Dachsfamilie, eine kleine, weil wir haben ja auch einen Dachsbau im Leechwald.
Andrea Jocham:
Den gehen wir regelmäßig anschauen, weil das ist auch immer ein Highlight, weil manchmal haben wir sogar ein Riesenglück und der hat gerade frisch gegraben und da sieht man manchmal auch, wenn man ganz viel Glück hat, sogar die Abdrücke.
Michaela Friebes:
Und das ist natürlich schon ein tolles Erlebnis, weil da ist der ganze Hügel mit Löchern übersät und da dürfen die Kinder Löcher suchen und mal schauen, wo lebt der Dachs.
Simone Koren-Wallis:
Es ist aber nicht nur die Tierwelt, die ihr den Kindern und Jugendlichen vermitteln wollt, es ist auch eben alles, was blüht und wächst oder die ganzen Pflanzen.
Michaela Friebes:
Genau, wir verkosten dann im Frühjahr zum Beispiel, wir können ja die Bäume vor allem verwenden, die jungen Blätter. Das ist schon für die Kinder ein besonderes Highlight, wenn sie einmal Lindenblatt kosten dürfen oder von der Rotbuche. Schmeckt ein bisschen unterschiedlich.
Simone Koren-Wallis:
Habe ich selber noch nie probiert. Kannst du das ungefähr beschreiben, wie schmeckt es?
Michaela Friebes:
Ja, wir haben von Erbse über Kiwi, habe ich schon gehört, vom Geschmack her. Manche sind halt ein bisschen handiger, das andere säuerlicher oder die Nadeln der Tanne zum Beispiel, die sind total säuerlich. Oder von der Fichte, die schmeckt wieder wie Medizin.
Simone Koren-Wallis:
Was ist euch wichtig, was die Kinder dann mitnehmen?
Andrea Jocham:
Ja, uns ist natürlich in erster Linie wichtig, dass die Kinder diesen natürlichen Respekt vor der Natur nicht verlieren bzw. überhaupt einmal kennenlernen. Was das eigentlich bedeutet, dass wir da ein großes Glück haben, erstens mitten in der Stadt einen Wald zur Verfügung zu haben bzw. auch generell der Wald und die ganze Flora und Fauna und die Tierwelt, dass dieser Respekt einfach wieder vorherrscht und die Kinder eben umgehen lernen, wie hebe ich einen Regenwurm auf, wenn ich ihn genauer betrachten möchte oder dass man nicht einfach durch den Wald geht, dort was abzwickt und dort was abreißt, sondern wirklich eben, wir versuchen den Kindern das nahezubringen, dass das wichtig ist, dass man da einen guten Umgang hat, man kann sich alles anschauen, man muss aber nicht immer, wenn man was sich genauer anschauen will, abreißen. Wir handhaben das schon so, dass wir sagen, eine Pflanze, ja, dann kann sich jeder das einmal anschauen oder eben das Kosten, das ist ja alles in Ordnung, aber alles mit Maß und Ziel und das merken die Michaela und ich halt bei den Führungen schon immer wieder, dass das total abhanden gekommen ist, also das verschwindet irgendwie, dass die Kinder da respektvoll damit umgehen.
Simone Koren-Wallis:
Passiert es euch dann manchmal, dass ihr dann schon merkt, wenn eine Schulklasse vielleicht öfter kommt, dass die schon richtig wissen, wie sie tun und vielleicht daheim dann auch sogar weitergeben oder so?
Michaela Friebes:
Ja und vor allem bei den älteren Kindern, also wenn wir so vier Jahreszeitenprojekte haben, also da habe ich die Erfahrung gemacht, die sind ja schon cool, die kommen mit Bauch frei und weißen Sneakers und dann merken sie aber schon, im November, es ist im Wald ein bisschen kühler und beim zweiten Mal haben sie dann schon Handschuhe an und Haube und sie sind ein bisschen anders ausgerüstet und sie merken, es ist anders, also wenn man nur von daheim in die Schule geht oder wenn man drei Stunden im Wald herum geht, es ist ein Unterschied und das lernen sie dann einmal, weil man muss einmal denken, der Grünraum verschwindet bei den Kindern immer mehr.
Andrea Jocham:
Und da ist es uns halt schon wichtig, dass wir das eben ein bisschen vermitteln können. Wir versuchen das natürlich auch spielerisch weiterzugeben, das Wissen und bei uns gibt es eben sehr viele lustige Dinge auch, auch anhand von Spielen, weil unser tolles Spiel, das darf man ja eigentlich fast nicht sagen, aber das heißt Zapfenkacken und auf das stehen die Kinder total.
Simone Koren-Wallis:
Und wollt ihr das jetzt gar nicht erklären?
Andrea Jocham:
Das ist ganz einfach.
Michaela Friebes:
Nimmt man Fichtenzapfen zwischen die Knie und dann müssen sie sich bis zu einer Begrenzung sich dorthin bewegen und dann den Zapfen fallen lassen.
Andrea Jocham:
Also Wald kann auch lustig sein.
Simone Koren-Wallis:
Aber ihr macht es jetzt nicht nur für Kindergarten, ihr macht es ja noch viel mehr in der Waldschule.
Michaela Friebes:
Im Herbst, saisongemäß, machen wir dann für die Erwachsenen auch Pilzwanderungen, das ist mir ein besonderes Anliegen. Also jetzt Pilze, nicht unterirdische, sind ja auch Pilze, da gibt es dann extra noch die Trüffelwanderungen. Aber ich bin für die Pilzwanderungen zuständig und das ist für mich etwas ganz besonders Tolles.
Simone Koren-Wallis:
Darf ich da dann mitgehen wieder im Herbst?
Michaela Friebes:
Ja, auf jeden Fall.
Simone Koren-Wallis:
Dann würde ich jetzt einmal sagen, wir hören einmal rein, wie das klingt, wenn ihr Kinder bei euch habt. Und so ist es in dem Fall die dritte Klasse der Praxisvolksschule von der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
Wald- und Kräuterpädagogin:
Jetzt konzentrieren wir uns einmal kurz auf den Boden. Schaut mal, was wir da haben. Da haben wir das Schabockskraut. Könnt ihr euch noch erinnern mit dem Schabockskraut? Das haben wir schon einmal gesucht. Das haben wir sogar gekostet damals, könnt ihr euch nicht mehr erinnern. Aber wann darf man das nur essen?
Kind 1:
Wenn die Blüten noch nicht da sind.
Wald- und Kräuterpädagogin:
Sehr gut, genau, wenn die gelben Blüten noch nicht da sind, weil wenn die gelben Blüten dann vorhanden sind, dann fängt es an, sich ein Stoff zu entwickeln, der dann nicht mehr so gut ist für uns. Das ist dann leicht giftig. Das kennt ihr alle, was haben wir da?
Kind 2:
Gänseblümchen.
Kind 3:
Die kann man lecker essen.
Wald- und Kräuterpädagogin:
Die kann man super essen. Schaut euch einmal die Blüte ganz genau an. Seht ihr das?
Kind 4:
Die Spitzen sind rosa.
Wald- und Kräuterpädagogin:
Was glaubt ihr, warum die Spitzen rosa sind? Das ist deswegen, weil das Gänseblümchen einen Selbstschutz hat. Das heißt, die Gänseblümchen haben diesen Färbestoff da in sich drinnen, das ist ein Kälteschutz.
Was passiert im Frühling oft mit dem Wetter? Es kann sein, dass momentan ein Kälteeinbruch kommt und dass sogar noch einmal Schnee fällt im Frühling, wenn die Gänseblümchen schon aus der Erde heraus sind. Und deswegen haben sie den Kälteschutz, damit ihnen nicht wirklich was passiert.
Jetzt haben wir da eine meiner Lieblingspflanzen. Die kennt ihr alle.
Kind 5:
Brennnessel
Wald- und Kräuterpädagogin:
Genau, die Brennnessel. Und wieso heißt die Brennnessel Brennnessel? Weil sie brennt. Aber was brennt an der Brennnessel?
Kind 6:
Die Brennnessel haben sogenannte Brennhaare die brennen.
Wald- und Kräuterpädagogin:
Ja, sehr gut. Wir haben da richtige Naturdetektive. Ja, genau.
Kind 5:
Man kann Brennnessel auch essen, man muss nur die Blätter fehlten und essen.
Wald- und Kräuterpädagogin:
Und jetzt zeige ich euch noch einen Trick. Schaut mal, was man noch machen kann. Man kann die Brennnessel, wenn man sie von unten nach oben rauf streift, passiert überhaupt nichts. Du kannst die Brennnessel so einfach pflücken, nur sobald du irgendwie reibst oder vorbei streichst, dann kann sie brennen. Weil die Brennhaare eben da unten oben sind und auf dem Stängel auch.
Kind 7:
Aber wenn man so macht, ist nichts.
Wald- und Kräuterpädagogin:
Wer mag denn Brennnessel kosten?
Kind 7:
Ich weiß, ich hab die schon ganz oft gegessen.
Wald- und Kräuterpädagogin:
Aber man darf nicht einfach so essen, sondern man muss sie ein bisschen in den Fingern zermatschen, damit man die Brennhaare zerstört. Wer mag noch kosten?
Kinder:
Ich!
Simone Koren-Wallis:
Was ist die Waldschule? Was macht man da?
Kind 8:
Da gehen wir immer zuerst zu einem Haus, dann teilen wir uns auf Gruppen auf und machen verschiedene Sachen im Wald. Dort lernen wir immer neue Sachen, wie die Blätterarten und die Baumarten und so.
Kind 9:
Es ist ein sehr schöner Wald, wo wir Blumen sehen und Bäumearten entdecken. Ich finde es sehr lustig.
Kind 10:
Also die Waldschule, die ist einfach im Wald. Wir forschen da und gucken uns manche Sachen an.
Kind 11:
Ich habe gelernt, viele Pflanzen und Tiere zu unterscheiden. Und ja, es macht riesigen Spaß.
Kind 12:
Also man kann dort sehr viel sehen. Es ist dort wirklich cool, weil man kann auch wirklich sehr viele Tiere gut beobachten, weil die Waldpädagoginnen erklären einem auch sehr viel und geben auch sehr viel Wissen über den Wald mit. Also richtig spannend.
Simone Koren-Wallis:
Beim nächsten Mal darf ich wieder wo zu Gast sein und zwar in einem der 13 Jugendzentren der Stadt Graz. Wir hören uns. Ich freu mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 45: Heiraten in Graz
Alle Infos über den (hoffentlich) schönsten Tag im Leben eines Paares:
Wie oft sagen in Graz Menschen JA zu einander? Was kostet das und geht das eigentlich überall? Wie viel Vorlaufzeit braucht man und welche Hochzeitsschmankerl kann die Referatsleiterin vom Grazer Standesamt Anke Christina Neukam erzählen? Reinhören und JA sagen :)
Intro/Simone Koren-Wallis:
Ja, ein Wort, das wirklich alles verändern kann. Heute reden wir über den hoffentlich schönsten Tag im Leben eines Paares. Wie oft sagen die Grazerinnen und Grazer Ja zueinander? Was kostet Heiraten überhaupt? Und wo geht das überall? Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast Anke Christina Neukamm.
Anke Christina Neukam:
Mein Name ist Anke Christina Neukamm. Ich bin die Referatsleitung vom Standesamt in Graz und der Staatsbürgerschaft. Ich darf ein Referat leiten mit 50 Personen und drei Teilbereichen und mache das Ganze jetzt seit ungefähr acht Jahren.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Die Tage werden länger, es wird wärmer, die Blumen blühen, die Vögel zwitschern und die Leute sagen viel lieber Ja zueinander. Mit dem Frühling steigt ein bisschen das Hochzeitsfieber.
Anke Christina Neukam:
Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist ein Phänomen. Vielleicht den Frühlingsgefühlen geschuldet oder der warmen Jahreszeit. Aber die Hochzeitssaison startet tatsächlich mit Mai und geht mittlerweile bis Ende Oktober.
Simone Koren-Wallis:
Was ist, wenn ich jetzt heute meinen Traumpartner kennenlerne? Also fürs Protokoll, ich habe ihn schon. Aber im Falle des Falles kann ich dann von heute auf morgen heiraten. Geht das?
Anke Christina Neukam:
Von heute auf morgen geht es vielleicht nicht, weil wir müssen vorher noch das Ermittlungsverfahren zur Ehefähigkeit erledigen.
Simone Koren-Wallis:
Das klingt sehr romantisch. Was ist das?
Anke Christina Neukam:
Das ist die sogenannte rechtliche Vorprüfung, wo wir aufgrund von verschiedenen Dokumenten, Vorlagen prüfen müssen, ob eben eine Ehe rechtlich eingegangen werden kann oder nicht. Wir haben die Vorlaufzeit von drei Monaten im Regelfall, weil wir auch Österreichs größtes Standesamt sind. Deshalb kriegen wir auch relativ viele Anträge, was das Heiraten auch anbelangt. Und da wir neben den Eheschließungen auch Geburten haben, die wir beurkunden müssen, Sterbefälle, Namensänderungen und sonstige Geschäftsfälle, ist die Summe ungefähr so 15.000 pro Jahr plus. Und die Eheschließungen, damit man sich das vorstellen kann, haben wir ungefähr 1.000 Anträge pro Jahr. Ja, da muss man halt dann schauen, was gerade wo Hochsaison hat und was man eben dann relativ rasch bearbeiten kann, damit man auch den gesetzlichen Rahmen erfüllt.
Simone Koren-Wallis:
1.000 im Jahr! Jetzt könnte man ja das runterbrechen und sagen so drei am Tag, aber es ist halt im Winter wahrscheinlich jetzt weniger. Das heißt, wie viele Hochzeiten haben wir da in Graz pro Standort maximal?
Anke Christina Neukam:
Den Trauungssaal im Rathaus haben wir offen Donnerstag, Freitag und Samstags und da sind maximal zwölf Terminmöglichkeiten.
Simone Koren-Wallis:
Man kann ja in Graz nicht nur im Rathaus heiraten.
Anke Christina Neukam:
Es gibt auch so diese Exklusivplatzsäulen, glaube ich nennen sie das, oder? Genau, es sind exklusive Trauungslokalitäten, die von uns vorab besichtigt und dann auf ihrer Eignung überprüft werden. Und die Liste derer wächst stetig an. Also es wächst wirklich, weil wir haben derzeit 22 Lokalitäten, wo man wirklich auch außerhalb des Rathauses heiraten kann. Die findet man zum Beispiel auch auf www.graz.at/heiraten-exklusiv. Dann kann man sich das auf der Homepage anschauen, sich mit den Lokalitätenbetreibern in Verbindung setzen und dann eben eine Begehung machen, einen Termin ausmachen und schauen, ob das vielleicht auch ein Heiratsplatz sein kann.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, man kann theoretisch, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe meine Verlobte im Park kennengelernt, kann ich da jetzt theoretisch ansuchen und sagen, ich würde total gerne im Park heiraten?
Anke Christina Neukam:
Ansuchen schon, ja, aber da muss ich leider absagen, weil wir haben öffentliche Plätze und private Häuser und Gärten von diesen Örtlichkeiten ausgeschlossen. Es ist wirklich nur möglich, es muss ein Museumsstandort sein oder es muss eine Lokalität sein, wo es einen Betreiber gibt. Es gibt Vorgaben, die im Gesetz verankert sind. Das heißt, meine Vorgabe ist, dass Staat und Religion zu trennen sind. Das heißt, es darf zumindest einmal kein Ort sein, der einen religiösen Charakter hat. Es soll auch kein Ort sein, der fragwürdig oder lächerlich ist. Da steht zum Beispiel drinnen in den Kommentaren, ein Bierzelt oder eine Sauna wird da hinein subsumiert. Ja, also es gibt schon Anfragen von den Paaren, wo eben die Lieblingsplatzart tatsächlich sind, aber alles können wir halt nicht umsetzen.
Simone Koren-Wallis:
Ich glaube, das Aiola ist ja auch sehr gut gebucht. Das ist tatsächlich unsere Top 1 Lokalität. Das ist das Aiola Schlössl in St. Veit, die beliebteste Exklusiv-Trauungsörtlichkeit, die wir im Programm haben.
Anke Christina Neukam:
Aber das kostet dann mehr oder ist dann anders zum Buchen? Also eine Trauung an einem exklusiven Standort, der Stadt Graz, da muss man schon, wenn man jetzt nur inländische Urkunden vorlegt, mit ungefähr 500 Euro rechnen, dass der Standesbeamte eben dorthin kommt, beispielsweise an einem Samstag. Und im Rathaus kostet das Ganze um die 65 Euro, wenn man eben nur inländische Urkunden vorlegt.
Simone Koren-Wallis:
Das ist eigentlich ziemlich günstig für das, dass eine Scheidung, falls es dann einmal eine geben sollte, viel teurer ist.
Anke Christina Neukam:
Sagt man ja, aber wir tragen sie auch nur ein und sind eben für die Scheidungsverhandlungen zum Glück nicht zuständig.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele gleichgeschlechtliche Verpartnerungen, Eheschließungen gibt es bei uns?
Anke Christina Neukam:
Gleichgeschlechtliche Ehen im Vorjahr hatten wir 33.
Simone Koren-Wallis:
Okay, das wird aber vermutlich auch immer mehr, kann ich mir vorstellen.
Anke Christina Neukam:
Das wird mehr, es wird schon gern genutzt, also beides, auch die eingetragene Partnerschaft wird gern von verschiedenen Geschlechtlichen auch angenommen, sowie umgekehrt die gleichgeschlechtliche Ehe, also von gleichgeschlechtlichen Partnern. Wobei man muss sagen, in Graz haben wir, also die 1000 Stück sind die Anträge, die wir haben in Graz pro Jahr. Eheschließungen daraus resultierend haben wir ca. 870.
Simone Koren-Wallis:
Was passiert mit den 130 dann? Da überlegen Sie es doch anders?
Anke Christina Neukam:
Nein, da überlegen Sie es nicht anders. Da stellen wir z.B. ein Ehefähigkeitszeugnis aus und die heiraten im Ausland. Oder wir machen das Ermittlungsverfahren, also die sogenannte rechtliche Vorprüfung und die heiraten dann an einen anderen Ort oder in einer anderen Gemeinde in ganz Österreich.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es irgendwie so ganz skurrile Hochzeitsgeschichten aus Graz?
Anke Christina Neukam:
Also ich sage immer, die Eheschließung und der Rahmen, das liegt eben im Auge des Betrachters. Romantik an sich ist ja auch Ansichtssache, würde ich jetzt sagen, weil viele mögen es klassisch, elegant, schlicht, einfach. Viele halt eher pompös mit allem, was halt dazugehört und Trompeten und Pauken. Von dem her ist es immer so schwierig, eine globale Aussage zu treffen, was ist skurril und was nicht. Aber es gab tatsächlich, ein Kollege hatte einmal eine Hochzeit, da war die Hochzeitsgesellschaft alle in Schlumpfkostümen verkleidet, zum Beispiel. Und die wollten das wirklich so haben. Das war einfach für sie ganz, ganz besonders und wichtig und wenn es natürlich für das Paar sowie auch für die Gesellschaft so gewünscht und gewollt ist, dann versuchen wir das natürlich auch dementsprechend zu begleiten und das haben wir auch getan.
Simone Koren-Wallis:
War der Standesbeamte dann auch ein Schlumpf?
Anke Christina Neukam:
Nein, ich habe tatsächlich ein Foto gesehen, nein war er nicht. Aber es war einmal eine etwas andere Hochzeit.
Simone Koren-Wallis:
Und gibt es auch vom Alter her, habt ihr irgendwie so ganz besonders junge oder ältere?
Anke Christina Neukam:
Statistisch kann ich es Ihnen sagen, das voriges Jahr zum Beispiel, war der größte Altersunterschied in einer Eheschließung 34 Jahre. Der älteste Partner, der geheiratet hat bei uns, war 89 Jahre alt. Und der jüngste Partner, ich sehe jetzt leider nicht, ob es männlich oder weiblich war, war 18.
Simone Koren-Wallis:
Okay, das heißt, die Spanne ist ja wirklich von 18 bis 89 relativ weit.
Anke Christina Neukam:
Genau, das war zumindest voriges Jahr so der Fall.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele haben wir heuer? Wie viele sind heuer geplant? Ihr habt ja die Anträge wahrscheinlich schon reinbekommen.
Anke Christina Neukam:
Ist laufend. Bei uns kann man sich bis drei Monate vorher einen Termin im Trauungskalender unverbindlich reservieren. Und wir haben so diese Regelung, dass wir sagen, innerhalb von drei Monaten schaffen wir das Ermittlungsverfahren und können dann meistens den Trauungstermin zusichern. Weil jetzt darf man nicht vergessen, wir haben in Graz einen sehr hohen Auslandsanteil, also mit nichtösterreichischen Urkunden, also Fremdsprachigen. Da sind wir bei ca. 50%. Also man kann sagen, jede zweite Eheschließung hat irgendwie einen nichtösterreichischen Bezug. Und da sind wir natürlich auch angehalten, die Dokumente inhaltlich genau zu prüfen. Da müssen wir zuerst schauen, können wir sie überhaupt anerkennen? Können wir sie akzeptieren? Haben sie die Legalisierungsförmlichkeit? So heißt das ja, also die Beglaubigung oder Apostille auf dem Dokument. Und von dem her kann das schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn jetzt die Parteien zum Beispiel noch was nachbringen müssen, weil etwas fehlt oder für uns etwas unklar ist, dann kann das auch schon ein paar Wochen länger dauern.
Simone Koren-Wallis:
Sie sind ja auch Selbststandesbeamtin. Wie geht es Ihnen da bei einer Trauung? Weil ich bin ja zum Beispiel eine, die könnte ja im Fernsehen jedes Mal mitblären von lauter Freude oder was auch immer. Ist man da selbst auch emotional?
Anke Christina Neukam:
Ja. Ich kann von mir sprechen. Ja, man ist emotional. Ganz besonders, ich sage herausfordernd emotional war es für mich, weil ich selber geheiratet habe vor nicht allzu langer Zeit.
Simone Koren-Wallis:
Gratulation.
Anke Christina Neukam:
Dankeschön. Und die Trauungen, die einfach so kurz vor der Eheschließung von meiner eigenen waren, die waren noch einmal anders emotional jetzt für mich. Jetzt so ganz persönlich gesprochen. Aber ansonsten, es ist ein wunderschöner Moment, den man begleitet. Ich freue mich da jedes Mal, wenn zwei Personen gegenübersitzen, man ein Vorgespräch führt, man die kennenlernt, diese Emotionen mitbekommt im Trauungssaal und einfach das Paar an dem Tag begleitet und dann wirklich aussprechen kann, sie sind verheiratet, sie sind jetzt Mann und Frau, frisch verheiratetes Ehepaar. Und das ist ein schöner Moment. Viele Mitarbeiterinnen sagen sogar, dass die Durchführung von Trauungen, also dass man wirklich Trauungen abhalten kann, ist so der Bonus vom gesamten Standesbeamtinnen-Job.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es da auch irgendwie so einen Lieblingsspruch oder so? Weil ihr seid ja dann natürlich, ihr könnt ja auch romantisch sein ein bisschen dazu. Gibt es ein bisschen so einen Lieblingsspruch, den Sie dann gerne sagen, wenn Sie dann verheiratet sind?
Anke Christina Neukam:
Das ist ein Teil von unserer Arbeit am Standesamt, Trauungsreden zu schreiben und zu gestalten, das ist wirklich ganz individuell. Da gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, das ist offen für jede Standesbeamtin und jeden Standesbeamten. Und es gibt natürlich beliebte Zitate oder Zitate, die man gerne verwendet. Was mir jetzt gleich einfällt, was wir untereinander im Team immer sagen, wenn jemand zu einer Hochzeit aufbricht, also eine Trauung durchführt, sagen wir immer „Gut Ring". Das heißt, wenn jetzt die Kollegin in den Trauungssaal hineingeht und man macht im Regelfall zu zweit Dienst im Rathaus, dann wünscht man der Kollegin „Gut Ring".
Simone Koren-Wallis:
Nächstes Mal nehme ich euch mit in die Waldschule Graz, in den Leechwald. Wir hören uns, ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 44: Gewaltprävention an Schulen mit dem Grazer Friedensbüro
Wir lesen es immer öfter, einige sind vielleicht über Kinder oder Enkel sogar selbst betroffen: Gewalt oder Mobbing an Schulen.
Das Grazer Friedensbüro arbeitet daran, dass es erst gar nicht so weit kommt: denn für Friedensarbeit ist man nie zu JUNG! Wie diese Gewalt- und Konfliktbearbeitung funktioniert, erklären Heidi Bassin und Elisabeth Zurl-Zotter in der neuen Folge des Stadt Graz Podcasts.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Wir lesen es leider immer öfter. Gewalt macht auch vor unseren Schulen nicht halt. Das Grazer Friedensbüro arbeitet daran, dass es erst gar nicht so weit kommt. Wie das genau funktioniert, das gibt es in dieser Folge. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation.
Elisabeth Zurl-Zotter:
Meine Gäste Elisabeth Zurl-Zotter und Heidi Bassin.
Elisabeth Zurl-Zotter:
Mein Name ist Lisi Zurl-Zotter.
Heidi Bassin:
Und ich bin die Heidi Bassin. Und wir zwei arbeiten im Team des Friedensbüros als Referentinnen im Bildungsbereich.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Das Friedensbüro Graz kennt vielleicht nicht jeder, deswegen meine erste Frage. Was macht das Friedensbüro Graz?
Heidi Bassin:
Das Friedensbüro Graz existiert schon seit ca. 35 Jahren. Wir gehören organisatorisch zum Bürgermeisteramt dazu. Seit einigen Jahren haben wir drei Hauptsäulen unserer Arbeit. Die eine Säule ist der sogenannte Nachbarschaftsservice. Dabei geht es um die Vermittlung und gemeinsame Lösungssuche bei Nachbarschaftskonflikten. Das ist gleich Werbung in eigener Sache. Also wenn in Graz jemand Probleme mit den Nachbarn hat, in einem Mehrparteienhaus, kann es sich an uns wenden. Der Service ist kostenlos.
Die zweite Säule ist die mobile Stadtteilarbeit. Da bekommen wir Siedlungen von der Stadt Graz zugewiesen, die wir ungefähr drei bis fünf Jahre begleiten. Das schaut so aus, dass wir da ein bis zweimal die Woche wirklich vor Ort sind und gemeinsam mit den Bewohnern schauen, was sind die Themen, die behandelt werden müssen oder was braucht es für ein gutes Miteinander. Also Schwerpunkt klingt einfach auf Gemeinschaftsförderung.
Und die dritte Säule, wo eben die Lisi und ich tätig sind, ist der Bildungsbereich. Ja, da werden wir dann glaube ich noch drüber sprechen.
Simone Koren-Wallis:
Friedensbüro, es steckt ja eh schon im Namen. Frieden, egal wo. Jetzt hört man es ja in letzter Zeit immer öfter, man liest immer öfter das Konfliktpotenzial in den Schulen. Habt ihr jetzt mehr zu tun oder ist es eigentlich immer gleich?
Elisabeth Zurl-Zotter:
Wir haben mehr zu tun, aber das hat jetzt nicht damit zu tun, dass Konflikte jetzt per se zugenommen haben. Es hat damit zu tun, dass Workshops jetzt schneller gebucht werden einerseits und andererseits auch kostenlose Workshops angeboten werden. Und wir auch andererseits Workshops recht günstig in Graz an die Schulen mit Workshops gehen können. Und das ist glaube ich so eine Gesamtkombination aus allem heraus, warum wir eigentlich recht gut beschäftigt sind.
Simone Koren-Wallis:
Es ist ja Gewaltprävention an Schulen. Also es ist ja nicht dann, wenn was passiert und ihr kommt dann, weil das macht ja die Kinder- und Jugendhilfe und der Bereitschaftsdienst, wenn schon was passiert ist.
Elisabeth Zurl-Zotter:
Beziehungsweise die Schulpsychologie Steiermark hier.
Simone Koren-Wallis:
Aber ihr schaut präventiv, also schon davor, dass es gar nicht so weit kommt. Wie schaut das jetzt genau aus? Können Sie uns das einmal ein bisschen erklären?
Elisabeth Zurl-Zotter:
Ganz oft rufen Lehrer und Lehrerinnen an, die gerne einen Workshop hätten, weil einerseits wollen sie wirklich ganz primär präventiv was machen, schon wirklich bevor nur irgendwas passiert ist im sozialen Miteinander, also Workshops haben mit uns. Auf der anderen Seite ist vielleicht manchmal schon ein bisschen was vorkommen und sie haben es dann vielleicht gut gelöst, aber wollen einfach noch einmal vorbauen fürs nächste Mal.
Und andererseits manchmal sind schon so Anfangsdynamiken, vielleicht Konflikten oder Mobbing. Und da sind wir trotzdem noch immer präventiv, weil sie wollen es gar nicht an die Spitze treiben lassen, dass es so weit kommt, weil dann dürften wir eh nicht mehr kommen. Dass wir dann mit den Kindern reden, Workshops machen, uns die Gruppendynamik anschauen, über Gefühle, Grenzen und so weiter sprechen.
Heidi Bassin:
Sehr oft kommt es auch vor, dass sich Eltern an uns wenden. Eher dann Eltern von Kindern, die in irgendeiner Weise betroffen sind von der Sache. Und wir können natürlich nur in Schulen kommen, wenn uns die Schule einladet. Also nicht, wenn irgendeine Mutter oder Papa beschließt, dass wir hinkommen sollen. Aber das gelingt recht oft so, dass wir all unsere Informationen, wie wir arbeiten und über welche Themen wir mit den Kindern sprechen, diesen Eltern zukommen lassen. Gleich im Hintergedanken, sie sollen das gleich so als Paket der Lehrerin oder dem Lehrer weitermelden und der soll sich bei uns melden. Dass ja nicht irgendwie die Angst aufkommt, wir stehen jetzt über drüber mit einem erhobenen Zeigefinger und wissen, wie es geht. Sondern einfach, dass wir dem Lehrer weitersagen. Da gibt es ein Friedensbüro, die machen das. Und es gelingt sehr oft, dass dann die Lehrperson Kontakt zu uns aufnimmt und eh mit uns redet, was braucht die Klasse konkret und wie können wir das machen.
Und ganz selten, aber doch kommt es vor, dass uns Schüler anfordern. Nämlich, ja, über das Kinderparlament haben wir jetzt schon zwei, dreimal geredet. Es war in dem Fall ein Mädchen und die hat sich das angehört. Und hat dann gemeint, das hätte ich gern für meine Klasse. Und über das Kinderparlament, die haben dann mit der Lehre in Kontakt aufgenommen. Und das haben wir total lieb gefunden, weil es war echt ein netter Klassenworkshop. Und sie war ganz stolz, sie hat das produziert.
Elisabeth Zurl-Zotter:
Und eins haben wir noch vergessen oder möchten wir noch dazu ergänzen. Ganz oft rufen uns auch Schulsozialarbeiterinnen oder Schulsozialarbeiter, die im Rahmen ihrer Tätigkeit an den Schulen, die auch nur begrenzte Anzahl an Stunden haben, ganz froh sind, wenn sie externe Kooperationspartner und Partnerinnen haben. In dem Fall das Friedensbüro und uns. Die zu bestimmten Themen Workshops mit den Schülerinnen und Schülern machen, weil sie einerseits schon als Teil der Schule gesehen werden und vielleicht da die Kinder auch in Workshops anders tun würden oder gar keine Kapazitäten haben, Workshops abzuhalten mit den Schülerinnen und Schülern. Und da ganz froh sind, wenn sie auf unsere Ressourcen zurückgreifen können.
Simone Koren-Wallis:
Aber was passiert dann? Also egal, wer euch dann ruft?
Heidi Bassin:
Meistens hat die Person, die uns ruft, schon eine ungefähre Idee davon, welches unserer Module sie gern hätte. Und vielleicht sollten wir dir mal kurz aufzählen.
Wir haben uns irgendwie bemüht, dass wir knackige Titel finden für unsere Themenbereiche. Und zwar hätten wir den Themenbereich Mobbing mit dem Workshop. Es war ja eh nur Spaß, weil das oft genau der Satz ist, der als Antwort kommt, weil man darauf angreift, „was hast du da gemacht?", „Ja, war eh nur Spaß".
Ist oft kein Spaß mehr für den anderen. Themenbereich Schlagfertigkeit und Zivilcourage, heißt der Workshop, werde ich aber richtig. Dann zum Themenbereich Resilienz haben wir den Workshop, was ich alles schaffen kann. Themenbereich Umgang miteinander, heißt ich schaue auf dich, ich schaue auf mich. Dann haben wir noch einen Themenbereich Manipulation, nicht mit mir. Und dann so allgemeines zur Klassengemeinschaft, das haben wir genannt, wir sind klasse.
Elisabeth Zurl-Zotter:
Wir haben schon einen roten Faden, aber können aus einem ganzen Methodenpool unsere Methoden zusammensuchen, was die Klasse braucht und das finden wir heraus, indem wir ein längeres Vorgespräch mit den Lehrerinnen oder Lehrern, die uns Buchen führen.
Simone Koren-Wallis:
Habt ihr da ein Beispiel von so einer Methode, dass wir das vielleicht irgendwie greifbarer machen können, dass sich die Leute irgendwie was vorstellen können?
Heidi Bassin:
Gerade bei unserem gern und viel gebuchten Mobbing-Workshop, da nähern wir uns dem Thema Mobbing. Was man dazu sagen muss jetzt, bei den ganz Jungen, machen wir gar nicht so Mobbing, also dieses M-Wort zum großen Thema, da geht es einfach um das Miteinander und wie es sich anfühlt, wenn man nicht mitspielen darf und so weiter. Aber bei so ab dritter Klasse Volksschule nähern wir uns diesem Thema, dass wir zuerst einmal über Gefühle reden. Ich fühle mich in der Klasse stolz oder traurig oder glücklich oder genervt. Das sammeln wir in Einzelarbeit, wie die Kinder sich fühlen und es wird dann vorgelesen und da ist zum Beispiel ganz oft der erste Aha-Effekt. Aha, es geht anderen auch so. Es nervt andere auch, dass es laut ist zum Beispiel.
Und von diesen Gefühlen gehen wir dann zum nächsten Thema Grenzen über. Da haben wir so eine Art Grenzenexperiment, wo die Kinder aufeinander zugehen und versuchen zu fühlen, wann sie stehen bleiben sollen oder in mehreren Schritten haben wir das aufgebaut oder der andere soll irgendwie einen Stopp signalisieren mit Gesichtsausdruck oder mit Körperbewegung. Und dann sagen wir, es braucht Grenzen. Man muss Grenzen auch erkennen können, man muss Grenzen auch laut sagen, wenn es über meine Grenzen geht. Und wenn aber ständig Gefühle verletzt und Grenzen überschritten werden, dann kann es zu etwas kommen, was wirklich schlimm werden kann. Und dann erzählen wir über Mobbing. Fragen wir zuerst einmal ab, was sie schon wissen über Mobbing... Sammeln wir auf einem Plakat. Das ist meistens recht viel. Und gerade bei Viertklässlern, Volksschule, machen wir das sehr gern, weil wir auch sagen, Kinder ihr kommt nächstes Jahr in eine völlig neue Umgebung, neue Schule, neue Gruppe. Es wäre wichtig, dass ihr wisst, wie schaue ich hin, wie erkenne ich es rechtzeitig, wie traue ich mich rechtzeitig was zu sagen, Hilfe zu holen. Wir müssen da immer groß diskutieren, Unterschied zwischen Hilfe holen und petzen.
Simone Koren-Wallis:
Was ist der Unterschied?
Heidi Bassin:
Frag Kinder... Also meistens kommt dann unterm Strich das raus, petzen ist dieses Weitersagen von eher Kleinigkeiten, die auch jemandem nicht gefährlich werden können. Schon ein bisschen mit dem Hinblick darauf, der könnte jetzt Probleme kriegen. Wenn ich sage, der hat einen Kaugummi im Mund und ich weiß genau, Kaugummi ist verboten, dann kriegt er jetzt ein Problem.
Und Hilfe holen ist tatsächlich, wenn jemand so im Schlamassel steckt, dass er alleine nicht mehr rauskommt. Wir sagen dann echt immer, lasst euch nicht sagen, dass ihr Petzen seid, wenn ihr Hilfe holt. Ihr seid keine Petzen.
Simone Koren-Wallis:
Was würdet ihr euch wünschen?
Heidi Bassin:
Was wir uns auf alle Fälle auch wünschen würden und wo wir glauben, dass es zur Verbesserung der ganzen Situation beiträgt, ist die Zusammenwirkung von allen Schulpartnern, Partnerinnen. Dazu zählen jetzt Lehrer, Lehrerinnen, Eltern und die Schüler, Schülerinnen. Und nur wenn die drei Gruppen miteinander schauen, dass es allen gut geht, kann es irgendwie zum Ziel führen.
Das ist völlig kontraproduktiv, wenn Elternschaft gegen Lehrer, Lehrerinnen arbeitet oder umgekehrt und Eltern in die Schule gehen und sagen, dem Kind geht es schlecht und zur Antwort bekommen, na, das kann nicht sein, in unserer Schule kommt das nicht vor. Dagegen wollen wir wirklich appellieren, bitte zusammenarbeiten.
Elisabeth Zurl-Zotter:
Und da muss man viel miteinander reden und vielleicht auch einiges aushalten können. Und auch wenn die Lehrpersonen sagen, na, so ist mein Unterricht, dass man als Elternteil das nicht alles kritisiert, aber trotzdem Vertrauen drauf haben soll, dass wenn man mit seinen Sorgen und Problemen in die Schule geht, dass man ein offenes Ohr hat, dass man Dinge losführt, dass man Dinge gemeinsam bespricht. Was das Kind betrifft, dass es einfach ein gutes Miteinander ist, das wäre uns wichtig. Weil das spüren die Kinder dann auch.
Simone Koren-Wallis:
Und wie kann man euch jetzt buchen? Also wie nimmt man Kontakt zu euch auf?
Elisabeth Zurl-Zotter:
Man kann sich einerseits über unsere Homepage informieren, www.friedensbuero-graz.at. Und sonst könnte man einfach auch bei uns im Büro anrufen und mit uns persönlich sprechen, mit der Heidi oder mit mir. Ja, einfach nachfragen, anfragen, sich trauen anzurufen. Manchmal coachen wir auch nur so telefonisch ein bisschen. Sie probieren dann selber was aus, wenn sie sagen, na, es passt der Workshop gerade nicht so rein. Also wir sind dafür sehr vieles offen. Weil wir Friedensbüro Graz heißen und natürlich könnten wir darauf schauen, dass es in der ganzen Welt weniger Krieg, mehr Frieden gibt. Aber das können wir als kleines Grazer Friedensbüro, ist jetzt oft sehr schwierig. Aber das, was wir schon machen können, ist, auf den Frieden in der Stadt zu schauen. Und der Frieden fängt immer im Kleinen an. Und deswegen sind unsere Workshops, finde ich, ein guter Beitrag dazu.
Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge läuten die Hochzeitsglocken. Wie und wo können wir in Graz heiraten? Was muss man beachten? Und vieles mehr für den hoffentlich schönsten Tag im Leben.
Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 43: Tigermücken-Alarm in Graz
Heuer wurde bereits im Jänner die erste Tigermückensichtung in Graz gemeldet. Tigermücken können massiv auftreten und nachdem sie tagsüber stechen, können sie ziemlich lästig werden und die Lebensqualität einschränken.
Was die Stadt Graz macht, um die Ausbreitung dieses tropischen Insekts einzudämmen und was jeder von uns dazu beitragen kann, das erklären Dr. Eva Winter und Erwin Wieser vom Gesundheitsamt. HIER gibt's auch alle Infos zum Nachlesen!
Intro/Simone Koren-Wallis:
Tiger-Mücken-Alarm in Graz. Was die Stadt macht, um die Ausbreitung dieses lästigen tropischen Insekts einzudämmen und was jeder von uns dazu beitragen kann, das hört ihr in dieser Folge. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste, Eva Winter und Erwin Wieser.
Eva Winter:
Mein Name ist Eva Winter, ich bin die Leiterin vom Gesundheitsamt der Stadt Graz und damit bin ich zuständig für einen ganzen Haufen Sachen, aber das Entscheidende ist darin die Fürsorge für die öffentliche Gesundheit, das heißt, dass die Grazer und Grazerinnen möglichst gesund bleiben und vor ansteckenden meldepflichtigen Krankheiten verschont bleiben.
Erwin Wieser:
Hallo, mein Name ist Erwin Wieser. Ich arbeite derzeit im Gesundheitsamt, bin seit 33 Jahren beim Magistrat und im Gesundheitsamt leite ich das Referat für Infektionsschutz und da gehört auch die Tiger-Mücke dazu und derzeit bin ich mehr oder weniger fast immer unterwegs im Kampf gegen die Tiger-Mücke.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Wir sind in einem Garten in Wetzelsdorf, total heimelig, es sind ein paar Regentonnen herum und so weiter, wo ich mir denke, wie gesagt, heimelig ist, es ist ein schöner Garten und du, Erwin, denkst dir, um Gottes Willen, oder?
Erwin Wieser:
Ja genau, das nur deswegen, weil Wasserstädel da sind und man sieht die Wasserstädel, wenn man da hereinkommt und das sind potenzielle Brutstätten für die Tiger-Mücke, für andere Größenorten. So schön ein Garten ist, so gefährlich ist es eben als Brutstätte zu dienen.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt haben wir April, jetzt muss ich da einmal reinschauen in so eine Regentonne. So, was sieht man da drinnen jetzt, außer dass das ein abgestandenes Wasser ist?
Erwin Wieser:
Ja, was sieht man da? Wenn du genau schaust, am Rand dieser Tonne sieht man schon die Larven, da wuselt es ja schon wirklich anständig und jetzt braucht man da noch ein bisschen mit dem Finger reinfahren, sieht man, wie sich das so bewegt. Da muss man sagen, ist es schon wirklich höchst an der Zeit, dass man eine Maßnahme setzt, dass man diese Tonne leert oder aber mit Biozid behandelt, mit einem Larvizid, um diese Mücken nicht schlüpfen zu lassen, dass da ja nichts ausschlüpft.
Simone Koren-Wallis:
Wenn man da reinschaut, man sieht es glaube ich vor allem am Rand, das sind ja Tausende.
Erwin Wieser:
Das sind wirklich viele. Also es ist für diese Jahreszeit, jetzt im April und diese Menge ist wirklich extrem. Also da ist Handlungsbedarf gegeben. Ausleeren oder ein Biozid, ein Larvizid da hineinschütten, ansonsten geht es im Kürze hoch.
Simone Koren-Wallis:
Wie lange dauert das, bis die geschlüpft sind?
Erwin Wieser:
Jetzt dauert es zwischen fünf und 15 Tagen, je nach Witterung, wie warm ist das Wasser und so weiter. Das kann man nicht genau sagen, aber so in dem Zeitraum. Deswegen sagen wir auch, das Wasser wöchentlich wechseln, wenn es sich in einem Blumenuntersetzer zum Beispiel oder bei Vogeltränken, wenn man das hat, wenn man es wöchentlich wechselt, kann nichts passieren, weil man es ja immer wieder vorher ausleert, bevor eben der Schlüpfprozess in Gang gesetzt ist.
Simone Koren-Wallis:
Wie erkennt man jetzt, ob es jetzt eine Tigermücke ist oder normale, wie wir sagen, Gelser?
Erwin Wieser:
Im Larvenzustand sehr schwer, vielleicht an der Bewegung. Die Larve der Tigermücke, die ist sehr graziös, langsam unterwegs und die anderen sind sehr schnell unterwegs, sehr flink. Also wenn man so sieht, dass da wirklich was sehr elegant durchs Wasser schwebt, dann ist es wahrscheinlich eine Tigermücke. Sonst müsste man ein Mikroskop nehmen und das untersuchen oder aber auch groß züchten und dann schauen wir, was es wird. Es könnte auch eine japanische Buschmücke sein oder die normale Hausgelse, die der Tigermücke sehr ähneln.
Simone Koren-Wallis:
Du, aber heuer relativ früh, oder?
Erwin Wieser:
Heuer sehr früh, ja und die ersten haben wir schon am 28. Jänner gemäht bekommen, da allerdings natürlich in einen Wintergarten mit hineingeschleppt. Der Winter war nicht kalt und deswegen ist es so früh, so explodiert. Also es wird explodieren noch in Graz.
Simone Koren-Wallis:
Warum ist die Tigermücke so ein Problem?
Erwin Wieser:
Weil sie lästig ist, weil sie das Leben im Garten nicht lebenswert macht und sie ist so lästig, sie sticht am Tag. Du kannst draußen nicht arbeiten, du kannst draußen nicht spülen als Kind und deswegen lästig. Die Übertragung von Krankheiten ist ja nicht das wahre Problem, also das ist ja eher gering, dass das passieren kann, aber das lästig sein. Wenn du da draußen bist, du wirst von fünf Zehen gleichzeitig gestochen und das ist nicht angenehm und da gibt es wirklich Gegenden und Häuser in Graz, wo die Leute nicht mehr wohnen wollen, weil eben so stark der Befall da ist.
Simone Koren-Wallis:
Wie unterscheidet man jetzt die Tigermücke von der Hausgelse?
Erwin Wieser:
Die Tigermücke ist circa fünf bis zehn Millimeter groß, das ist das erste. Sie ist auffällig schwarz, also dunkelschwarz in Wirklichkeit im Vergleich zur Hausgelse. Die haben sie in Brauntönen gehalten und dann hat sie eben diese silbrig-weißen Streifen und das macht sie zum Tiger oder zur Tigermücke und das ist wirklich charakteristisch. Wichtig ist nur, am Kopf und am Torso muss ein weißer Längsstreifen sein. Das dritte Beinpaar, also das letzte Beinpaar, das ändert weiß und dann kann man sagen, dann ist es eine Tigermücke. Wenn diese Merkmale nicht vorhanden sind, dann ist es vielleicht eine japanische Buschmücke oder unsere Hausgelse, die ihr sehr ähneln, aber genau diese Merkmale fehlen.
Simone Koren-Wallis:
Surren die dann irgendwie auch anders? Weil ich hasse das ja, wenn das in der Nacht so richtig ist und dann denkst du, boah, da ist eine Gelse. Surren die auch anders?
Erwin Wieser:
Nein, die surren gar nicht. Das ist ein Riesenvorteil, also in Wirklichkeit der Nachteil, weil du hörst sie nicht und sie sticht und du merkst sie erst, wenn sie gestochen hat. Also da ist es wirklich so, wo der Vorteil, wenn du sie nicht hören magst, aber der Nachteil, du wirst sie spüren und das ist das Problem und das macht sie wirklich lästig, also du hörst sie nicht.
Simone Koren-Wallis:
Liebe Frau Doktor, wie ist das eigentlich gesundheitlich, wenn jetzt wirklich diese Tigermücke in Graz da ist, was hat das für gesundheitliche Ausmaße?
Eva Winter:
Im Moment einmal noch gar keine, außer dass sich vielleicht ein Stich lokal entzündet und einem länger Schmerzen macht, als das unbedingt notwendig ist. Langfristig kann das aber sehr starke Auswirkungen haben, nämlich dann, wenn wir genug Mücken haben und wenn wir erkrankte Menschen in der Stadt Graz haben, also Menschen, die sich eine Tropenkrankheit aus dem Urlaub mitgebracht haben im ungünstigsten Fall und davon braucht man natürlich eine Anzahl, dass die Wahrscheinlichkeit einfach groß genug ist, dass eine Übertragung passiert. Das heißt, die Mücke müsste kommen, den erkrankten Menschen stechen, die Erkrankung sozusagen mitnehmen in dem Tröpfchen Blut, das die Mücke sich hineingesaugt hat und den nächsten Menschen stechen und dort würden dann die Viren über die Mücke im anderen landen. Der könnte dann erkranken, aber momentan ist die Gefahr noch sehr zu vernachlässigen.
Es ist auch in Österreich noch keine solche dokumentierte Übertragung passiert, sondern alle Krankheiten, die in das Spektrum fallen sind bis jetzt noch nachgewiesenermaßen importiert worden.
Simone Koren-Wallis:
Aber kann das mit einer normalen Gelse, kann das mit der auch passieren oder nur mit der Tigermücke?
Eva Winter:
Nein, nein, das können schon auch andere Stechmücken, also die Tigermücke hat eine besondere Begabung, das muss man schon festhalten, aber rein theoretisch kann auch unsere ganz stinknormale Hausgelse auch Krankheiten übertragen. Es ist halt immer eine Frage der Menge, die Tigermücke hat vermutlich größeres Blutreservoir sozusagen, die kann größeren Tropfen mitnehmen, die Viren fühlen sich in der Tigermücke vorübergehend wohler, aber ganz grundsätzlich kann es unsere Hausmücke auch.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt gibt es ja sogar eine App, wo ich solche Viecher melden kann, die Moskito Alert App. Was ist jetzt, wenn ich so eine Tigermücke sehe und die dann melde? Was passiert dann von eurer Seite aus?
Erwin Wieser:
Wir nehmen in der Regel Kontakt auf mit den Personen, wir schauen in die Gegend, ob es irgendwo potenzielle Brutstätten gibt und dann schauen wir uns die Gegend an und untersuchen genau, wo Brutstätten sind, weil sie ist ja sehr faul, die Tigermücke, sie fliegt nicht weit. Das heißt, wenn ich hier gestochen werde in den Garten, muss irgendwo im Umkreis von 150 Metern diese Brutstätte sein und da gehen wir dann eben von Tür zu Tür, werfen Flyer ein oder klären die Leute auf, wenn sie uns in den Garten lassen, so wie hier, da dürfen wir herein und das ist auch ein Appell, dass uns die Leute reinlassen, dass sie sagen, bitte komm und hilf uns, zeig uns, weil das Aha-Erlebnis ist meistens gegeben. Alle sagen, ich habe keine und wenn man dann wirklich im Garten ist und dann gibt es das Aha-Erlebnis und überall gibt es etwas zu finden, wenn man wirklich genau sucht, also in welchem Garten gibt es kein Wasser, auf welchem Balkon gibt es kein Wasser, wenn man Pflanzen dort stehen hat, also es ist überall die Gefahr gegeben.
Simone Koren-Wallis:
Und was macht die Stadt Graz dann sonst noch, also das ist eh schon viel, aber was macht sie sonst noch?
Erwin Wieser:
Ja, neben der Öffentlichkeit soweit ist dann zusätzlich noch die Bekämpfung im öffentlichen Raum, also zusammen mit der Holding Graz machen wir das, wir schicken die Holding Graz in solche Gebiete, wo vermehrt Meldungen eintrudeln und da fährt einer durch die Straßen, durch die Gassen und besprüht praktisch jeden Kanal, jeden Gully und das tötet dann Larven, die da drin sein könnten, ab und so schauen wir, dass aus dem öffentlichen Raum, aus dem Kanal nichts heraus schwirrt, damit wir auch da unseren Beitrag leisten, dass wir auch zeigen, hey, das hilft, wenn du etwas tust.
Simone Koren-Wallis:
Ist die Mur da auch so ein Problemfall, dass da ganz viel dann an der Mur auch schlüpfen wird?
Erwin Wieser:
Nein, die Mur ist kein Problemfall, die Tigermücke geht in kein natürliches Gewässer, weil da sind natürliche Fressfeinde drin und das meidet sie wie der Teufel das Weihwasser und sie bleibt eher in den künstlichen Gewässern und da ist sie vom Joghurtbecher, der irgendwo herumliegt und mit Wasser gefüllt ist, bis zur Regentonne, wie wir es gerade vorher gesehen haben, ist sie überall vertreten und sie legt ihre Eier, damit sie eben ihr Leben oder Fortkommen gesichert hat.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele legt denn da ein, so ein Viecherl an Eiern?
Erwin Wieser:
Na ja, das können bis zu 300 sein, aber so in der Regel pro Stelle 20, 30 und sie geht aber von A nach B nach C und legt sie überhaupt nicht alle auf einmal, das wird es uns ein bisschen einfacher machen, aber leider verteilt sich es.
Simone Koren-Wallis:
Was kann man jetzt als Grazerin, als Grazer machen? Du hast die Moskito Alert App schon angesprochen, die kann man runterladen am Handy und da eben dann melden, hey ich habe eine Tigermücke gefunden, was kann man aber sonst noch machen? Also Wasser überall wirklich ausleeren, wo geht? Ausleeren, wo geht?
Erwin Wieser:
Ja, wenn befallene Gefäße da sind, diese Gefäße reinigen, gründlich reinigen, wirklich mit einem Tuch, mit der Bürste reinigen und dann natürlich wieder verwenden, aber schauen, dass sich das Wasser nicht wieder ansammelt. Also im Prinzip das Wasser ausleeren, regelmäßig ausleeren, einmal in der Woche ausleeren und es wird nichts passieren. Wenn es länger dauert, wenn es eben 5 bis 20 Tage dauert, dass das ausgeleert wird, dann besteht die Gefahr, dass diese Larven schlüpfen und die nächste Population oder die nächste Generation eigentlich genau genommen da ist.
Simone Koren-Wallis:
Und wenn man jetzt dann irgendwo eben so eine Wasserstätte hat, wo man merkt, da ist ganz viel drinnen, dann einfach in die Wiese leeren?
Erwin Wieser:
Genau, in die Wiese leeren und bitte ja, nicht in den Kanal oder in den Regenläufer, weil dann kriegen wir es wieder retour über den Kanal, die sterben ja dann nicht. Letztendlich in der Wiese ist die beste Möglichkeit und wenn es eben nicht zum Ausleeren geht, dann muss man eben zu einem Stoff greifen, zu einem Larvizid und die Larven vernichten, wenn Larven drin sind. Aber bitte in die Wiese leeren und kein Problem, aber nicht in den Kanal, das wäre wirklich ein dringender Appell, weil sonst freuen sich die Nachbarn dann wieder.
Simone Koren-Wallis:
Und jetzt, wenn ich schon eine Ärztin da habe, es gibt ja so viele Hausmittelchen, wenn man dann gestochen worden ist und vielleicht einen kleinen Dippel hat und der juckt dann ordentlich, was hilft denn jetzt wirklich, was sagen Sie als Ärztin?
Eva Winter:
Ich darf keine Werbung machen, aber es gibt da so ein gewisses Pharma-Produkt, das ist ein klares Gel in einer Tube, das hilft eigentlich recht zuverlässig, sonst hilft alles, was das beruhigt. Also es gibt ja auch diese Stifte, die mal kurz heiß machen, das wirkt eigentlich auch sehr, sehr verlässlich, ist ganz ohne Chemie und im Grunde völlig ungefährlich. Ein Eiswürfel hilft oder nicht dran denken, auf einem Bein stehen und dabei ein Lied singen, dann juckt es auch nicht mehr.
Simone Koren-Wallis:
Nächstes Mal geht es um Gewaltprävention an Grazer Schulen und zwar mit dem Friedensbüro.
Wir hören uns, ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 42: EU-Studie: wie lebenswert ist Graz?
Die europäische Kommission führt in regelmäßigen Abständen eine Zufriedenheitsanalyse durch und da schafft es Graz in der aktuellen Studie gleich 3x unter die Top 10 der 83 analysierten Städte! Magistratsdirektor Martin Haidvogl und Statistikerin Barbara Rauscher berichten über die Details.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Wie lebenswert ist Graz eigentlich? Die Antwort gibt jetzt eine EU-Studie und da ist Graz gleich dreimal unter den Top Ten von den 83 analysierten Städten. Und genau über das reden wir heute. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste Martin Haidvogl und Barbara Rauscher.
Martin Haidvogl:
Hallo, mein Name ist Martin Haidvogl. Ich bin der Leiter des Inneren Dienstes des Magistrats, der Magistratsdirektor und damit verantwortlich für die gesamte interne Organisation der Stadtverwaltung.
Barbara Rauscher:
Mein Name ist Barbara Rauscher. Ich bin zuständig für die Statistik in der Stadt Graz.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Ich habe schon sehr, sehr viele Podcast Folgen für die Stadt Graz aufnehmen dürfen. Noch nie hat ein Tisch so ausgeschaut. Es ist alles voll mit Zetteln und Zahlen. Es geht nämlich um eine Zufriedenheitsanalyse. Wem darf man zu dem Ergebnis jetzt gratulieren?
Martin Haidvogl:
Ich würde einmal sagen vielen europäischen Städten. Es geht nämlich in erster Linie aber nicht nur um die Lebensqualität in den europäischen Städten im Jahr 2023, die von der Europäischen Kommission erhoben wurde. Es geht aber in weiterer Folge auch um unsere Lebensqualitätsintegratoren in der Stadt Graz, die von unserem Referat für Statistik von der Frau Rauscher in regelmäßigen Abständen erhoben werden. Und bei der europäischen Studie muss man nicht nur, aber man kann auch Graz gratulieren. Ein Spoiler vorweg, Zürich schneidet besonders gut ab und lässt einen vor Neid erblassen.
Aber Graz ist trotzdem gut drauf. Wobei diesmal alle Städte ein bisschen schlechter abgeschnitten haben. Man sieht, dass wir momentan in einer Zeit voller Krisen sind: Ukraine, Covid, Flüchtlingsbewegungen, all das hat natürlich auch seine Spuren hinterlassen. Und das sieht man ganz deutlich auch in den Umfragen. Die Werte sind alle ein bisschen schlechter als bei der letzten Umfrage 2019, also vor Covid, wie die Welt noch so für alle komplett in Ordnung war, auch wenn wir es selbst nicht gewusst haben, das sieht man einfach durchwegs.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt schaue ich die Dame der Statistik an.
Barbara Rauscher:
Wir springen kurz in die Welt der Zahlen hinein, was mich immer sehr freut, weil ich der Meinung bin, dass die Welt der Zahlen eine sehr lebendige ist. Und auch diese Studie zeigt dann wieder, dass sie eigentlich sehr nah am Leben ist und sehr nah an uns allen ist, auch wenn es einem nicht so bewusst ist. Diese EU-Studie ist mit den Daten von 2023 durchgeführt worden, im Jahresanfang. Es sind von jeder der 83 befragten Städte im EU-Raum, EWR, Türkei ist unter anderem auch dabei, mindestens 839 Personen pro Stadt gefragt worden. Für alle, die jetzt ganz schnell Kopf rechnen, ich sage es, es sind fast 72.000 Antworten, die zurückgekommen sind, um eben auch vergleichen zu können. Wobei die Bandbreite der Städte, die dabei ist, für mich faszinierend ist. Von Istanbul als Riesen-Millionenstadt hin bis zu Valletta als Hauptstadt von Malta und auch die kleinste EU-Stadt.
Es gibt viele Städte, die jetzt quasi im direkten Vergleich mit Graz so um die 200.000, 300.000, 350.000 Einwohner haben, wo man natürlich zumindest ich aus meiner Zahlensicht sehr gern drauf schaue, weil das Vergleichen mit Gleichwertigen, Gleichartigen halt einfach spannender ist. Aber ich denke, für das Erste waren die Zahlen schon ausreichend, die ich da jetzt so mitgebracht habe.
Simone Koren-Wallis:
Die Frage aller Fragen, wie lebenswert ist Graz?
Martin Haidvogl:
Ja, Graz ist zum Glück sehr, sehr lebenswert. Bei der Frage, ob Graz im Allgemeinen gesprochen ein guter Platz ist, um hier leben zu können, sagen 95% Ja. Wir sind damit unter allen 83 Städten auf Platz 16. Das klingt jetzt relativ weit hinten, wenn man doch 95% Zustimmung hat. Zum Glück sieht man, dass die meisten Menschen dort leben, wo sie auch gerne leben wollen. Ich sage jetzt Augen-zwinkernd, das Schöne ist, Wien ist auf Platz 36.
Simone Koren-Wallis:
Das klingt fast ein bisschen nach einer Rivalität.
Martin Haidvogl:
Ich sage das deswegen, weil es ja immer heißt, Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Und wenn wir lebenswerter sind als die lebenswerteste Stadt der Welt, zumindest in den Augen der Grazerinnen und Grazer, dann ist das natürlich ein schönes Kompliment.
Simone Koren-Wallis:
Aber da sind ja noch ganz viele andere Faktoren abgefragt worden.
Barbara Rauscher:
In dieser EU-Studie sind acht große Bereiche abgefragt worden, wo es jetzt um wirtschaftliche Sicherheit geht, wo es auch um Umweltqualität geht, wo es um die Wohnqualität geht zum Beispiel. Das sind Themenbereiche, die wir in unserer Stadt Graz eigenen Analyse ja auch seit vielen Jahren schon monitoren. Aber das sind sozusagen die Highlights. Vielleicht springen wir gleich einmal rein in einen Bereich. Ich würde jetzt vielleicht einmal mir so anschauen den Bereich Verkehr. Da wurde konkret gefragt, was ist denn dein bevorzugtes erstes Verkehrsmittel, mit dem du unterwegs bist. Da hat sich der Bereich der Autobenutzer reduziert ein bisschen. Und was ich sehr schön finde, dass die Fahrradfahrer ordentlich zugenommen haben. Das merkt man jetzt nicht nur, wenn man selber mit dem Radl in der Stadt unterwegs ist und das sieht. Aber auch der Anteil derjenigen, die zu Fuß unterwegs sind, hat sich zumindest laut dieser Studie von 2019 mit 14% circa auf über 30% entwickelt.
Martin Haidvogl:
Bei den Radfahrerinnen und Radfahrern sind wir sogar auf Platz 9. Und das Schöne ist, wir sind das einzige südliche Stadt unter den Top 10. Angeführt wird die Liste von Groningen, Amsterdam, Kopenhagen.
Simone Koren-Wallis:
Diese typischen Radfahrhauptstädte.
Martin Haidvogl:
Und es geht dann so weiter. Und wir sind die einzige, die nicht quasi in dieser nördlichen Liga mitspielt.
Simone Koren-Wallis:
Wo sind wir noch top unterwegs?
Martin Haidvogl:
Besonders freut mich natürlich als Magistratsdirektor, dass wir in einer Kategorie besonders gut abschneiden, die gerade in der Pandemie eine große Rolle gespielt hat. Nämlich bei den Online-Services der Stadtverwaltungen. Dort sind wir auf Platz 5 gekommen. Und damit wirklich an der Spitze vor uns natürlich auch diesmal wieder Zürich, Aalborg, Groningen und Kopenhagen. Also auch Städte, bei denen man sich nicht genieren muss und die zumindest zum Teil eine ganz andere Größenordnung haben. Das ist natürlich für uns eine wirklich große Freude, weil wir da auch sehr viel Wert darauf gelegt haben, uns ja selber auch als die digitale Stadt und Stadtverwaltung bezeichnen.
Weil, wie gesagt, gerade in Zeiten der Pandemie die digitale Transformation in ganz Europa stattgefunden hat. Und viele Bürgerinnen und Bürger darauf angewiesen waren, dass sie Online-Dienste beanspruchen können. Und wenn man da vorne ist, ist man zumindest am Puls der Zeit.
Barbara Rauscher:
Man sieht auch, dass sich in den letzten Jahren so eine Entwicklung gezeigt hat, dass die Leute mehr möchten von der Stadt. Was ich sehr schön finde, weil das das Service überhaupt hebt und auch damit die Lebensqualität wieder hebt, dass die Leute zufrieden sind und dass das passt, dass sie das bekommen, was sie brauchen. Und das ist halt schön, wenn das dann mit Zahlen auch noch unterlegt wird.
Simone Koren-Wallis:
Es ist jetzt nicht nur diese EU-Studie, sondern auch wir von der Stadt fragen immer wieder die Grazerinnen und Grazer, wie gefällt es euch eigentlich, was passt euch?
Barbara Rauscher:
Wir schauen uns seit 2005 an, was die Grazerinnen und Grazer sagen, wo wir alle paar Jahre jeden Haushalt mit einem Fragebogen kontaktieren. Wir haben das 2018 zum letzten Mal gemacht, das nächste ist in Vorbereitung und Planung und quasi schon abgestimmt.
Simone Koren-Wallis:
Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber gibt es auch Bereiche, in denen Graz jetzt vielleicht nicht so positiv gesehen wird?
Martin Haidvogl:
Die Europäische Kommission hat insgesamt 52 Fragen gestellt und die in 27 Indikatoren zusammengefasst. Und tatsächlich sind wir bei 24 Indikatoren über dem Durchschnitt. Bei drei, heißt das umgekehrt, sind wir aber auch unterdurchschnittlich. Das sind, um die auch gleich zu benennen, die Luftqualität, das sind die Grünflächen, da sind wir ganz knapp unter dem Durchschnitt und bei der Frage nach dem leistbaren Wohnen. Und da ist aber ganz interessant und insofern ist es schon auch wichtig, sich mit den Statistiken auseinanderzusetzen. Man kann das übrigens sehr, sehr gut auf der Seite der Europäischen Kommission, alle Städte schnell miteinander vergleichen. Man sieht dann nämlich sehr rasch, dass überall dort, wo die Menschen sehr, sehr gerne leben, das Wohnen kaum leistbar ist. Und umgekehrt, wenn wir uns zum Beispiel Istanbul und Palermo anschauen, die beiden Städte, die bei den allgemeinen Lebensqualitätsfragen am schlechtesten abschneiden, die schneiden nur bei der Frage nach dem leistbaren Wohnen gut ab. Das heißt, man kann dort billig wohnen, wo niemand wohnen möchte. Das ist ein gordischer Knoten, der schwer zu lösen ist. An dem man arbeiten muss, gar keine Frage, aber der nicht einfach zu lösen ist.
Simone Koren-Wallis:
Wo wir jetzt nicht mehr so arbeiten müssen, wir haben vorher gesagt, das sind drei Mal unter den Top Ten. Wir haben schon gehabt digitale Verwaltung, wir haben gehabt die täglichen Radfahrerinnen und Radfahrer und jetzt fehlt uns nur ein drittes. Wo sind wir noch top?
Martin Haidvogl:
Das ist die Finanzsituation der Haushalte. Da wird sich jetzt vielleicht jeder denken, bei mir ist das nicht so, aber im Vergleich zu anderen Städten stehen wir hier auch sehr gut. Das ist in dem Fall ein sehr, sehr schöner Indikator, weil sich auch zeigt, dass wenn man selbst seine persönliche finanzielle Situation positiv einschätzt, auch die Lebensqualität als sehr positiv einschätzt, klarerweise.
Barbara Rauscher:
Ich sehe auch noch den Gesundheitsbereich als wirklich einen unserer Top Themen. Wir haben in der EU-Stunde ja eine Zufriedenheit mit dem Gesundheitswesen, das als Bürger zur Verfügung steht, mit 86 Prozent. Durchschnitt hätten wir 67 Prozent gehabt. Und das freut mich besonders, weil wir auch in unseren Detailfragen unserer eigenen Studie also ganz, ganz gute Top-Werte bekommen haben, wie zufrieden die Leute sind mit Erreichbarkeit von Ärzten und solchen Sachen.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt haben wir heute von zwei Studien gehört. Wo kann ich mir das Ganze jetzt genau anschauen?
Martin Haidvogl:
Am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn man auf unsere Homepage unter graz.at/statistik nachsieht. Dort gibt es die LQI-Studie, also die Lebensqualitätsindikatorstudie der Stadt Graz. Und dort ist auch verlinkt zur Studie der Europäischen Kommission. Und wenn man beide Studien ansieht, dann wird man auch merken, dass die Grazerinnen und Grazer bei der reinen Grazer-Studie etwas kritischer sind als bei jener der Europäischen Kommission. Wenn man sich zum Beispiel die Frage nach der Lebensqualität ansieht, also ist die Stadt Graz ein guter Platz zu leben, dann stimmen 95 Prozent bei der EU-Studie zu, bei unserer eigenen Lebensqualitätsindikatorstudie aber nur 91 Prozent. Ich persönlich interpretiere das so, dass man im eigenen Bereich einfach ganz gern auch ein bisschen, ich will nicht sagen nörgelt, aber durchaus kritischer hinsieht. Wenn man dann aber weiß, da geht es um den Vergleich zu anderen Städten, dann ist man schon auch ein bisschen stolz darauf, in dieser schönen Stadt leben zu können.
Simone Koren-Wallis:
Dass Graz auch lebenswert bleibt, dafür kann jeder was tun. Denn in der nächsten Folge geht es um die Tigermücke und was die Stadt Graz macht, um die Ausbreitung dieses tropischen Insekts einzudämmen. Und was auch jeder von uns dazu beitragen kann. Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 41: 300 Jahre GGZ-Geschichte
Vom Armenhaus bis hin zur modernen Geriatrie, von der ersten Gebärklinik für ledige Mütter bis hin zur ersten Operation mit Narkose in der Steiermark: wir werfen mit dem Geschäftsführer Gerd Hartinger und Historikerin Elfriede Huber-Reismann einen Blick auf die Geschichte und die Meilensteine der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Happy Birthday GGZ. Die geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz feiern ihr 300. Jubiläum. Wir schauen zurück auf eine imposante Geschichte mit vielen Meilensteinen und natürlich auch auf die Gegenwart. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste Elfriede Huber-Reismann und Gerd Hartinger.
Gerd Hartinger:
Mein Name ist Gerd Hartinger. Ich bin der Geschäftsführer der geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz.
Elfriede Huber-Reismann:
Mein Name ist Elfriede Huber-Reismann. Ich bin Historikerin und habe die Geschichte des Armenhauses in Graz geschrieben.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Wir sind jetzt mitten in Graz in der Arbeit Schweizergasse beim Portier vorbei und sind mittendrin in den geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz. Wenn man reinkommt, lieber Geschäftsführer, was sehen wir da jetzt gleich?
Gerd Hartinger:
Sie sehen hier den renovierten Altbau aus dem Jahre ursprünglich 1726 und gleich nebenan die Kirche, die dann 1731 dazu kam.
Simone Koren-Wallis:
Wir feiern ja 300 Jahre GGZ, ein ganz großes Jubiläum. 300 Jahre klingt richtig mächtig, oder?
Elfriede Huber-Reismann:
Ja, das sind wirklich viele Jahre und es ist auch ganz viel passiert. Interessant ist, dass der Befehl des Kaisers Karl VI. am 11. April 1724 ergangen ist, dass dieses Armenhaus errichtet werden soll. Und weil schon die Kirche erwähnt wurde, das Besondere war, das Geld hat nicht für Kirche und Armenhaus gereicht und so hat man die Kirchenbau zurück gestellt und mit dem Armenhaus angefangen, dass die Leute untergebracht werden konnten.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, was ist damals wirklich da als erstes passiert? Wer konnte da reinkommen? Wirklich die Armen, weil im Armenhaus?
Elfriede Huber-Reismann:
Genau, die ganz, ganz, ganz Armen, die beim besten Willen nicht gewusst haben, wie sie überleben sollen.
Simone Koren-Wallis:
Klingt schwierig in der damaligen Zeit, gell? So einfach wird es nicht gewesen sein.
Elfriede Huber-Reismann:
Nein, es war ganz schwer, Sozialsystem hat es nicht gegeben. Man war auf Spenden angewiesen. Wenn schlechte Zeiten waren, haben die Leute, die gespendet haben, auch nichts gehabt und von den wenigen dann nicht sehr viel hergeben können. Und so sind die ganz Armen, meistens Frauen und Kinder, oft auf der Strecke geblieben und waren dem Hungertod nahe.
Simone Koren-Wallis:
Es ist ja nicht immer dieses Armenhaus geblieben.
Elfriede Huber-Reismann:
Genau, es war dann zwischendurch noch ein Zwangsarbeitshaus hier drinnen, das war zeitgleich. Dann wurde es umbenannt das Armenhaus in Siechenhaus.
Simone Koren-Wallis:
Siechenhaus, kommt das von Seuche?
Elfriede Huber-Reismann:
Nein, es kommt von dahin Siechen, vom sehr krank sein. Also es waren wirklich die, die schwer leidend waren.
Simone Koren-Wallis:
Es war ja auch, glaube ich, das erste Krankenhaus für ledige Mütter oder so, irgendwas habe ich gelesen.
Elfriede Huber-Reismann:
Es hat eine Gebärklinik gegeben, das war im Bäckenhäusl untergebracht, da war davor eine Bäckerei drinnen, darum war es so genannt und das war eine Notlösung, dass da die Gebärenden untergebracht wurden und zwar meistens die ledigen Mütter, die keine Unterkunft hatten, nicht zu ihren Eltern zurückkonnten, nicht zu Verwandten konnten, die sind da hinkommen und sind damit ihren Kindern dageblieben, haben für einen Aufenthalt bezahlt. Wenn sie kein Geld hatten, dann konnten sie das abdienen, indem sie ein paar Wochen dageblieben sind und als Armen für die Kinder gedient haben, deren Mütter vielleicht bei der Geburt verschworen sind oder einfach verschwunden sind.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es auch irgendwas, wo Sie sagen, das war ein Meilenstein in diesem Haus?
Gerd Hartinger:
Ja, also ich glaube, es war das Jahr 1848 mit der Anton Hinterthür, der Chirurg, der eine der ersten Narkosen, also die erste in der Steiermark und eine der ersten weltweit mit Schwefelether durchgeführt hat oder erst seit dieser Zeit gibt es wieder Narkosen vor der Operation als Hilfe, dass der Schmerz nicht so stark empfunden wird.
Simone Koren-Wallis:
Kann man sich das wirklich noch so vorstellen, wie aus den Filmen, das mit dem Tuch auf der Nase und dann hat man geschlafen oder so?
Elfriede Huber-Reismann:
Man hat den Schwefelether in eine Schweinsblase hineingegeben, die hat man sich dann vor den Mund gehalten und das ausströmende Gas eingeatmet.
Simone Koren-Wallis:
Wenn wir jetzt die GGZ heute hernehmen, 300 Jahre, wie würden Sie das kurz beschreiben?
Gerd Hartinger:
Das ist eine gewaltige Reise durch Medizin und Pflege, die sich hier abgespielt hat, die ein Zeitzeuge ist und die schön revitalisiert wieder hier erblüht. Sie sehen den Altbau sehr schön im Denkmalschutz erhalten und Sie sehen die Neubauten hier, die Albert-Schweizer-Klinik 1 mit vorgelagerter Tagesklinik, Albert-Schweizer-Klinik 2, das Albert-Schweizer-Hospiz, das Logistikzentrum, wo fast 1000 Essen am Tag produziert werden und hier sind sehr, sehr viele Vereine, die mit uns die Patientenversorgung durchführen, wie der Hospizverein Steiermark, die bunten Blätter, ehrenamtliche Vereine, also viele, die mit uns zum Patientenwohl heute beitragen. Also wir haben jetzt seit dem Anfang des 21. Jahrhunderts die Patientenzahlen verzehnfacht, die Mitarbeiterzahl verdreifacht, auch den Umsatz etwa verdreifacht und ja mehr enorme Versorgungswirkung erzielt.
Simone Koren-Wallis:
Ich glaube, wir können froh sein, dass wir heute leben und nicht damals, oder?
Elfriede Huber-Reismann:
Ja, auf alle Fälle, allein wenn ich daran denke, dass die Pflege damals von jenen Armen besorgt worden ist, die ein bisschen besser beieinander waren und damit die betreut haben, die gar nicht mehr gehen haben können zum Beispiel. Also es war keine Pflegeeinrichtung, so wie man es heute kennt, ausgebildete Pfleger und Pflegerinnen, die sich um die Leute kümmert haben, sondern man hat sich da ein bisschen gegenseitig geholfen.
Simone Koren-Wallis:
Wann hat sich die Pflege einmal zumindest ein bisschen Richtung wirkliche Pfleger hin verbessert?
Elfriede Huber-Reismann:
Also medizinisch auf alle Fälle so ab 1850. Da sind so viele fortschrittliche Entwicklungen gemacht worden, dass man einfach besser helfen konnte, dass man besser versorgen konnte und die Pflege, auch um die Zeit würde ich sagen, da hat man nämlich die barmherzigen Schwestern engagiert. Zuerst im LKH, am Paulusdorf damals und dann hier heraußen, da hat man ebenfalls die Schwestern eingeteilt, die den großen Vorteil unter Anführungszeichen gehabt haben, dass sie weit günstiger waren, wie zu bezahlende Pflegerinnen. Was vielleicht noch als Meilenstein ganz wichtig wäre, in Graz, im Krankenhaus hier, im städtischen Krankenhaus, ist 1909 die erste Krankenpflegeschule der Steiermark eingerichtet worden.
Simone Koren-Wallis:
Wann ist das Ganze dann an die Stadt Graz gegangen?
Elfriede Huber-Reismann:
Das muss man ein bisschen getrennt sehen. Die Stadt Graz war von Anfang an zuständig, das Armenhaus zu finanzieren. Die Bürger der Stadt Graz mussten das bezahlen, hatten dafür aber den Vorteil, dass die Bettler, die sie in der Stadt hausieren gegangen sind, hier aufbewahrt, eingesperrt, versorgt worden sind und ab 1862 ist die Stadt Graz Eigentümer des Geländes.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Personen sind hier jetzt aktuell untergebracht?
Gerd Hartinger:
Also hier rund 400 und insgesamt in den kroatischen Gesundheitszimmern über 900. Wir haben ja fünf Standorte in Graz, aber hier ist die zentrale.
Simone Koren-Wallis:
Sie sagen, jetzt hier alt werden, ja?
Gerd Hartinger:
Wir bekommen sehr gute Feedbacks sozusagen, also dass die Leute hier sich gesunden. Sie müssen bedenken, im 1999 sind 95 Prozent der Patienten, die hierher gekommen sind, verstorben und heute gehen 90 Prozent nach Hause. Also man hat auch ganz andere Aussichten und ja, wenn es aber auch dem Ende des Lebens zugeht, dann gibt es hier lebenswerte Umgebungen, wie das Hospiz, die Palliativ-Care, gerontopsychiatrische Tagesstätten, Pflegeheime. Also es tut sich viel und es ist ein Erneuerungsgeist in der Geriatrie durch eine junge Mannschaft gegeben.
Simone Koren-Wallis:
Wir sind jetzt herinnen im Albert-Schweizer Tageshospiz. Wie viele Menschen sind da jetzt herinnen?
Gerd Hartinger:
Im ersten Stock sind zwölf und im zweiten zwölf Einzelsimmer für Hospizpatienten und sechs Tageshospizplätze und im Dachgeschoss ist ein eigener Hörsaal und da können die Patienten auch noch einmal sozusagen das Tageslicht sehen. Ja, kann auch einmal das letzte Mal sein, nicht? Deswegen haben sie sich so gewünscht, dass man das Dachgeschoss auch ausbaut und der wurde jetzt auch für Hochzeiten verwendet. Die Tochter einer Hospizpatientin hat hier geheiratet.
Simone Koren-Wallis:
Na schön. Wachkommastation ist auch glaube ich eine große Station.
Gerd Hartinger:
Ja, Sie sehen da im Hintergrund in der Albert-Schweizer-Klinik eins in den obersten beiden Stockwerken. Zwei Stationen, insgesamt 25 Patientinnen im Wachkoma oben in der Wachkoma-Frühförderung, also dort, wo noch viel zu tun ist, wo wir versuchen nach Akutereignis und übrigens Menschen ab 18, die aufgenommen werden, wieder ins Leben so schnell wie möglich zurückzubringen und die Station darunter, Wachkoma-Langzeitförderung, da geht es nicht so schnell voran, dass eine Reintegration nicht möglich ist oder länger benötigt, ist die größte Wachkommastation Österreichs.
Simone Koren-Wallis:
Aber wenn man jetzt so durchgeht, es ist erstens einmal extrem groß und es schaut sehr vieles so neu aus.
Gerd Hartinger:
Das stimmt, wir haben also in den letzten 24 Jahren alles erneuert von den unterirdischen Leitungen, entweder die Baudenkmäler generalvitalisiert oder völlig neu gebaut. Das heißt, die GGZ heute sind ein vollkommen erneuertes Unternehmen an allen fünf Standorten.
Simone Koren-Wallis:
Aber es ist sozusagen in den letzten 25 Jahren mehr passiert als in den letzten, also in den ganzen 300?
Gerd Hartinger:
Ich glaube, also von der Bausubstanz auf jeden Fall, weil wir haben jetzt 175 Millionen Euro investiert und die Bausubstanz ist vollständig erneuert und das muss man schon sagen, gebaut insgesamt vom Bau Volumen ist in den letzten 25 Jahren mehr als in den vorhergehenden 275 Jahren.
Simone Koren-Wallis:
Also was hat sich für Sie als Historikerin in den letzten 300 Jahren am meisten verändert?
Elfriede Huber-Reismann:
Aus einem Armenhaus, das eine Verwahranstalt für alte Leute in eine Besserungsanstalt für Müßiggänger war, zu einer modernen Einrichtung, wo man sehr gerne lebt und die letzten Jahre seines Lebens verbringt, wenn man nicht mehr zu Hause sein kann und Betreuung braucht.
Gerd Hartinger:
Wir arbeiten jetzt vermehrt in die Richtung, dass wir Leute nach traumatischen Ereignissen, typisch Oberschenkel-Halsfraktur oder dergleichen, wieder ins Leben zurück, nach Hause zurückbringen können. Das heißt, die Reintegrationsrate ist über 85 Prozent. Die Leute müssen nicht bei uns bleiben, sie kommen wieder gesund nach Hause.
Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge geht es darum, wie lebenswert Graz eigentlich ist. Und so viel darf ich verraten. Wir schneiden wirklich gut ab. Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 40: Wie viel Bildschirmzeit ist für Kinder ok?
Egal ob Smartphone, Tablet, Fernseher und Co: Wie wirkt sich zu viel Bildschirmzeit auf Kinder und Jugendliche aus und wie wichtig sind Eltern als Vorbilder? Kinderarzt Werner Sauseng und Gerald Friedrich, Leiter der Kinder- und Jugendhilfe Graz-Nordost aus dem Amt für Jugend und Familie, berichten über Grenzen und wie diese auch eingehalten werden können.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Handy, Tablet, Fernseher. Die Nutzung all dieser Geräte fällt unter Bildschirmzeit. Wie lange darf die bei Kindern sein? Welche Auswirkungen hat das und wie wichtig ist die Vorbildfunktion von uns Erwachsenen? Meine Gäste Werner Sauseng und Gerald Friedrich.
Werner Sauseng:
Hallo, mein Name ist Werner Sauseng, ich bin von Beruf Kinderarzt, biete bei der Stadt Graz Beratung zum Thema Schlaf an und habe mich im Zusammenhang mit dem Schlaf auch mit dem Thema Bildschirmzeiten beschäftigt.
Gerald Friedrich:
Hallo, mein Name ist Gerald Friedrich, ich leite die Kinder- und Jugendhilfe Graz Nord-Ost und den psychologischen Dienst der Stadt Graz.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Wir sind jetzt mittendrin in der Fastenzeit. Es gibt sicher auch einige Erwachsene, die sagen, ich mache ein bisschen eine Bildschirmreduktion, das ist mein Fasten. Ich verzichte jetzt nicht auf Fleisch oder auf Sonstiges, sondern ich versuche zum Beispiel Social Media zu verzichten. Meine Schwester macht das zum Beispiel. Wie lange dürfen wir vor dem Bildschirm sein? Wir Erwachsene und dann vor allem die Kinder, da muss man ja komplett differenzieren.
Gerald Friedrich:
Ein wie lange greift bei Erwachsenen sicherlich zu kurz, weil auch wenn man Suchtverhalten sieht, ist Suchtverhalten nicht eine Frage nur von sozusagen der Zeit oder des Volumens, sondern vor allem, dass man etwas zum Beispiel nicht macht, was man ansonsten tun würde, dass man Coping-Strategien, also Strategien mit schwierigen Situationen umzugehen, auf zum Beispiel genau dieses Medium hinschiebt, also auf digitale Medien und da wird es problematisch. Bei kleinen Kindern kann man natürlich schon sagen, da gibt es Regeln. Es ist sowieso jede Regel besser als keine Regel zu haben bei Kindern.
Also unter drei Jahren, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber unter drei Jahren würde ich sagen, keine Bildschirmzeiten.
Werner Sauseng:
Es gibt von der Kinderärztegesellschaft Empfehlungen dazu. Da steht drinnen keine Bildschirmzeiten unter zwei Jahren, weil das Lernen in diesem Alter einfach mit Begreifen, mit realer Welt zu tun hat und sie auch zwischen real und Fiktion in dem Alter gar nicht unterscheiden können.
Danach fängt es so bei 30 Minuten an, kann dann je älter die Kinder werden, in kleinen Schritten immer erhöht werden. Für Jugendliche steht in diesen Empfehlungen drinnen maximal zwei Stunden außerhalb ihrer Schul- und Arbeitszeit. Das ist natürlich erstens schwierig zu handhaben und andererseits natürlich ist nicht nur die Zeit das Wichtige, das stimmt in dem Alter.
Simone Koren-Wallis:
Vor allem, wie sagt man das dann einem, ich sag so gern Pubertier, die Pubertierenden, sagt ihnen das einmal, von wegen maximal zwei Stunden. Also ich glaube, es ist gleich schwierig mit einem Kleinkind wie dann mit einem Teenager, oder? Den Handykonsum vielleicht einzuschränken, oder?
Gerald Friedrich:
Naja, ich glaube, es hängt immer von seinem eigenen Verhalten ab. Im Grunde genommen kann man Kindern nicht erzählen, sie machen einem sowieso alles nach. Und wenn schon Eltern selbst vor dem Kind ständig vor dem Handy sind, dann ist es halt schwierig. Im Kleinkindalter ist meiner Ansicht nach ein anderes Problem auch gegeben. Ich glaube, es gibt kaum mehr Eltern, die mit dem Baby am Schoß rauchen.
Aber es gibt immer wieder, und man sieht es sehr häufig, Eltern, die mit dem Baby am Schoß ständig in ihr Smartphone schauen. Und du musst dieses Kleinkind erst einmal durchdringen zu seiner Mutter oder zu seinem Vater und halt da mit einer Konkurrenz zu kämpfen, die schwierig ist. Und der Umgang, die Interaktion zwischen Mutter und Kind und zwischen Vater und Kind, das ist das Entscheidende, vor allem in den ersten zwei, drei Jahren. Und das kann man nicht ersetzen durch ein Smartphone. Und ganz, ganz besonders schlimm meines Erachtens ist, wenn man Kinder in dieser Zeit mit dem Smartphone beruhigt. Weil das macht in weiterer Folge sicherlich ein erhöhtes Suchtverhalten oder erhöhten Medienkonsum aus. Weil da lernen die Kinder schon im Kleinkindalter eigentlich, dass das was Beruhigendes ist und dass das der Umgang ist, wenn man Stress hat oder wenn man Probleme hat.
Simone Koren-Wallis:
Aber warum sagt man jetzt unter zwei Jahre? Sie haben das vorher schon angesprochen. Es geht auch darum, was ist real, was ist Fiktion? Das heißt, bis zum gewissen Alter können das die Kinder gar nicht differenzieren?
Werner Sauseng:
Nein, in dem Alter können sie das nicht unterscheiden. In dem Alter ist Lernen nichts, was man von einem Bildschirm lernt, sondern was man angreifen muss. Die Interaktion, wie der Gerald gesagt hat, mit den Bezugspersonen ist ganz was Entscheidendes. Es gibt Eltern, die auch glauben, Kinder können eine Sprache lernen durch Bildschirmberieselung. Auch das stimmt so nicht. Sprache lernt man durch die Interaktion mit Menschen, die so sprechen.
Simone Koren-Wallis:
Kann das dann auch gesundheitliche Auswirkungen haben? Also wenn man jetzt zu viel Handyspiele oder Videospiele spielt, zu viel am Handy, dass man es nicht verarbeiten kann. Aber sind das auch gesundheitsschädliche Auswirkungen?
Werner Sauseng:
Ja, das weiß man. Da gibt es viele Untersuchungen dazu. Wenn Kinder sehr, sehr viele Stunden vor Bildschirmen verbringen, leidet schon mal die Bewegung darunter. Das heißt, Kinder machen dann weniger Bewegung. Es leidet der Schlaf darunter. Kinder schlafen weniger und sie schlafen schlechter. Wenn sie viel Bildschirmzeit haben und auch Bildschirmzeit vor dem Schlafen gehen oder Bildschirme in den Kinderzimmern, ist auch ein Risikofaktor. Und dann ist Bildschirmzeit auch mit Übergewicht verbunden, mit schlechten Ernährungsgewohnheiten. Und dann kommen auch in den Bereich natürlich Verhalten rein, wo man dann auch über Inhalte sprechen muss.
Gerald Friedrich:
Bei ganz kleinen Kindern beeinflusst das einfach auch die Gehirnentwicklung. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Deswegen sagt man ja unter zwei oder drei Jahre keine Bildschirmzeiten. In weiterer Folge gilt es für die Eltern, den Kindern eine Medienkompetenz zu vermitteln. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, weil Medien auch etwas Positives sein können. Und über alle vermeintlich gefährlichen Dinge wird ja letztlich auch Beziehung in der Familie geregelt. Das war immer schon so, auch bevor es digitale Medien gegeben hat. Die Eltern wollen, dass Kinder etwas nicht machen. Die Kinder sehen das in der Regel als Ablehnung ihrer eigenen Person zuerst einmal an, weil sie auch nicht verstehen, warum, wenn die Eltern das auch machen. Also das Wozu ist immer gut, wenn die Kinder auch wissen, wozu sie auf etwas verzichten. Da komme ich auf das Thema Fastenzeit zurück. Wenn wir wissen, wozu wir fasten, dann machen wir es ganz anders. Dann machen wir es eigentlich erst freiwillig. Wenn jetzt jemand sagt, du musst fasten oder das ist gut für dich, dann steigt man normalerweise eher in eine ablehnende Haltung, in eine Konfrontation ein. Und das machen Kinder natürlich auch. Und deswegen ist die Auseinandersetzung, die Kommunikation mit den Kindern, mit den größeren Kindern vor allem wichtig.
Simone Koren-Wallis:
Dann die große Geschichte ist auch der Inhalt. Nicht nur, wie lange schaue ich, sondern was schaue ich, oder?
Werner Sauseng:
Da gibt es, wenn man bei kleinen Kindern anfängt, natürlich altersentsprechende Empfehlungen. Es gibt Inhalte, die für kleine Kinder nicht geeignet sind. Man weiß vor allem, aus interessanter Weise bei Buben, dass aggressive, gewalttätige Inhalte sehr stark auch das Verhalten von Kindern beeinflussen können. Scheinbar bei Burschen noch stärker als bei Mädchen. Und da macht es sicher Sinn, dass man von Anfang an, wenn kleine Kinder Inhalte von Bildschirmen konsumieren, dabei ist. Weil es den Kindern die Möglichkeit gibt, auch in den Austausch zu kommen. Man soll auch als Eltern dann darüber reden, was die Kinder da gesehen haben, was man gemeinsam gesehen hat. Weil es manchmal auch überraschend ist, was Kinder belastet oder betroffen macht. Wenn sie dann die Möglichkeit haben, darüber zu reden, ist es sicher hilfreich. Und es geht dann über bis zu den Jugendlichen, wo man nicht mehr alles gemeinsam konsumiert, aber wo man Interesse haben soll und schaut, wofür interessieren sich meine Kinder, was sind das für Inhalte, die sie konsumieren.
Simone Koren-Wallis:
Stimmt es, dass da irgendwie die Bildschirmabfolge dann schon so schnell ist, dass die gar nicht mehr mitkommen eigentlich?
Gerald Friedrich:
Auf alle Fälle. Also die schnellen Schnitte sind für die kindliche Entwicklung sicherlich nicht gut. Wenn man Kinder fernsehen lässt, dann ist es sicherlich besser, Inhalte zu haben, die langsamere Schnitte haben. Weil was machen diese schnelleren Schritte? Die Kinder sind damit überfordert. Aber es löst aus, dass die Kinder mehr dranbleiben. Es ist eine ähnliche Sache wie bei Instagram und TikTok, wo man das schnell weiterwischen eigentlich dann führt wieder zu einem Dopamin-Kick und letztlich wird es immer mehr erhöht. Man erhöht die Dosis unter Anführungszeichen. Es ist wie bei einer Sucht.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt reden wir darüber, was gut ist, was nicht gut ist, was man tun sollte. Aber wie kann man das als Eltern umsetzen?
Werner Sauseng:
Das eine ist, es macht Sinn, sich für das Thema zu interessieren. Es macht Sinn, zu wissen, was wird empfohlen. Weil ich glaube, dass manchmal auch das Verständnis, dass das überhaupt ein Problem ist, gar nicht da ist. Also wenn man es einmal weiß, dass das ein Thema ist, auf das man achten soll, ist das schon ein erster Schritt. Die Vorbildwirkung ist ganz wichtig. Und bei kleinen Kindern denke ich doch, dass es Sinn macht, in der Familie gewisse Regeln oder einen Umgang zu definieren, zu sagen, das ist unser Ziel, das ist erlaubt, das ist zu viel.
Gerald Friedrich:
Alternativen anbieten. Möglichst frühzeitig, würde ich sagen, Wert darauf legen, dass Kinder sogenannte Coping-Strategien erlernen, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen, die nicht Medienkonsum sind. Vorbildwirkung ist schon gesagt. Es macht wenig Sinn, zu sagen, das Kind, du darfst nur eine halbe Stunde am Handy sein, wenn das Kind den ganzen Tag sieht, wie wir am Handy sind. Kindererziehung heißt, ein eigenes Verhalten zu modifizieren, nicht das Kind zu ändern. Man glaubt immer, man könnte einen anderen ändern. Spätestens in der Ehe oder in der Partnerschaft ist man dann vor das Problem gestellt, dass man sieht, dass das nicht geht. Aber es geht auch beim Kind nur bedingt.
Werner Sauseng:
Was helfen kann, ist, dass man nicht zu früh den Kindern eine eigene Geräte zukommen lässt. Da rede ich vor allem vom Smartphone, das meiner Meinung nach im Volksschulalter noch zu früh ist. Und auch die Nacht sollte man gerätefrei, oder das Kinderzimmer sollte in der Nacht gerätefrei bleiben. Das ist auch etwas, was helfen kann, weil man nicht alles unter Kontrolle hat, was sich in der Nacht im Kinderzimmer abspielt.
Simone Koren-Wallis:
Wenn ich jetzt als Elternteil merke, dass das Ganze Überhand nimmt, dass das Kind gar nicht mehr weg will von, egal ob Fernseher, Computer, Handy oder was auch immer, egal in welchem Alter. Gerhard, wo kann ich dahin kommen in der Stadt?
Gerald Friedrich:
Ich glaube, das ist ein Familienberatungsthema, weil das Kind entwickelt sich nicht von selbst so, sondern da gehört in der Familie das Ganze einmal besprochen. Das Kind hat keine Alternativen offensichtlich.
Simone Koren-Wallis:
Das muss man sich dann aber auch einmal auf die Augen führen.
Gerald Friedrich:
Das muss man sich dann auf die Augen führen und auch anschauen. Das kann man nicht mehr isoliert als Handy-Problem des Kindes sehen.
Simone Koren-Wallis:
Aber das heißt, wo kann ich dann hinkommen, wenn ich es mir dann vor Augen geführt habe, dass es da ein Problem gibt in meiner Familie?
Gerald Friedrich:
In die Familienberatung, im Familienkompetenzzentrum. Es gibt natürlich auch von anderen Institutionen psychologische oder psychotherapeutische Beratung, Familienberatung.
Simone Koren-Wallis:
Wichtig jetzt für alle, die zugehört haben, ist selbst ein bisschen an der Nase zu nehmen, als Erwachsener und zu sagen, hey, Fastenzeit. Nicht nur in der Fastenzeit, sondern vielleicht allgemein ein bisschen das Handy wegzulegen und die Bildschirmzeit zu minimieren.
Werner Sauseng:
Bildschirmzeit reduzieren tut auch Erwachsenen gut. Man soll sich Zeit für die Kinder nehmen.
Gerald Friedrich:
Und für sich selbst, weil das ist auch eine Erkenntnis in der Fastenzeit, dass man, wenn man nur sich ablenkt, nicht bei sich selbst ist. Und das sollen weder Kinder lernen, aber da können auch Erwachsene in der Fastenzeit wieder auf sich selbst zurückkommen und sagen, ich erlebe einmal das bewusst, was sich abspielt in der Welt.
Simone Koren-Wallis:
Nächstes Mal feiern wir Jubiläum und zwar mit den geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz und werfen einen Blick zurück auf 300 Jahre GGZ.
Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 39: Rathauswache: hilft, beschützt und rettet Leben
Vom Brandanschlag über Bombendrohungen bis hin zur Wiederbelebung. Nein, das ist nicht der Alltag der Rathauswache, das sind Ausreißer, aber solche Dinge kommen vor.
Aber was macht die Rathauswache der Stadt Graz sonst eigentlich?
Markus Kammerhofer und Kurt Lerch erzählen von ihren Aufgaben, von ihren Einsätzen und ihren Highlights.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Sie hilft, beschützt und rettet sogar Leben. Die Rathauswache und nein, Brandanschläge, Bombendrohungen und Wiederbelebungen sind jetzt nicht der Alltag. Aber was macht die Rathauswache der Stadt Graz sonst eigentlich? Markus Kammerhofer und Kurt Lerch erzählen von ihren Aufgaben, von ihren Einsätzen und ihren Highlights.
Markus Kammerhofer:
Mein Name ist Markus Kammerhofer, ich darf die Rathauswache leiten.
Kurt Lerch:
Mein Name ist Kurt Lerch, bin seit sechs Jahren bei der Rathauswache und bin Stellvertreter.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Jeden Tag in der Früh, wenn ich ins Büro kommen darf, sind es die ersten freundlichen Gesichter, wenn man reinkommt ins Rathaus, bevor man dann die Stufen raufkommt, die Gesichter der Rathauswache. Und zwei dieser freundlichen Gesichter sitzen heute bei mir. Bitte erklärt einmal euren Job.
Markus Kammerhofer:
Die Rathauswache besteht zwischen fünf und im Peak waren wir 16 Personen. Wir überwachen, betreuen die Amtsgebäude in Graz, das sind insgesamt 40 Stück. Wir sind direkt stationiert im Rathaus, im Wohnungsamt und im Amtshaus.
Den Rest betreuen wir über Alarmknöpfe. Also jeder Bedienstete oder die meisten Bediensteten haben auf ihrem Telefon einen Alarmknopf, der mit uns direkt verbunden ist und wir kommen dann dorthin.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, das ist einmal das Aufgabengebiet, wo ihr steht und was macht ihr genau?
Kurt Lerch:
Im Grunde ist es so, dass wir die Hausordnung dieser Häuser eigentlich schauen, dass das alles ok geht. Sprich, es gibt da gewisse Vorschriften, was auch die Parteien, die in ein Haus kommen, einhalten müssen.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, ihr seid auch speziell geschult?
Markus Kammerhofer:
Wir sind alle als ausgebildete Ordnungswächter, also vom Grund aus sind wir bei der Ordnungswache. Wir zwei sind auch noch Brandschutzbeauftragte. Also wir haben da schon langjährige Erfahrungen in dem Ganzen und haben auch die Ausbildungen dazu.
Simone Koren-Wallis:
Was ist das Besondere an eurem Job? Weil er jeden Tag anders ist oder weil ihr nicht wisst, was auf euch zukommt?
Kurt Lerch:
Also es ist grundsätzlich so, dass man schon eine gewisse Berufung für diesen Job braucht. Man muss sich das so vorstellen, wir sind für die Mitarbeiter des Hauses da. Wir schauen darauf, dass ein gewisser Schutz vorhanden ist und das liegt auch nicht jedem. Aber wir sind auch für Parteien da, die zum Beispiel das Haus betreten und gewisse Hilfestellungen brauchen. Also Kommunikation ist sehr wichtig in unserem Job, das braucht man. Und wenn man mit dem nicht so zusammenkommt, dann wird es schon schwierig.
Markus Kammerhofer:
Ja, es ist einfach, jeder Tag entwickelt sich anders. Wir haben schon einen versuchten Brandanschlag gehabt. Wir haben das Königsbau betreut, das im Rathaus war. Wir haben Bombentragungen, wir haben versuchte schwere Körperverletzungen. Also wir sind da von A bis Z voll dabei. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir haben insgesamt, ich und der Kurt, schon drei Leute wiederbelebt im Dienst, im Rathaus und im Amtshaus. Zwei waren erfolgreich, eine leider nicht. Und das bringt jeden Tag was anderes.
Simone Koren-Wallis:
Das letzte Mal, wo ihr auch einer Dame das Leben gerettet habt, das war am Hauptplatz. Wie ist das damals abgelaufen?
Markus Kammerhofer:
Ja, wir waren zufällig beide gerade im Rathaus, weil wir eine Besprechung gehabt haben. Und dann ist ein Passant eben von draußen reingelaufen gekommen und hat gesagt, da liegt jemand. Ja, wir haben dann den Defibrillator geholt, dort hingegangen und haben mit der ersten Hilfe geleistet.
Simone Koren-Wallis:
Wie geht es einem da?
Kurt Lerch:
Naja, es ist so, es ist schon richtig, wenn man sich denkt, es ist eine absolute Ausnahmesituation. Auch für uns natürlich, auch wenn wir eine gewisse Ausbildung haben und geschult sind. Aber ganz einfach ist es nicht zum Verarbeiten, das muss man so sagen. Also man muss ja dann wirklich sagen, du stehst komplett unter Strom. Da entscheiden sehr viele Sachen, aber man ruft einfach gewisse Dinge ab, was man irgendwie gehört hat, was man von seiner schulischen Ausbildung in dem Sinn hat und probiert dann einfach das Bestmöglichste zu machen. Funktioniert sehr gut in diesem Moment, aber ist natürlich auch wichtig, das Übereinandergreifen von allen Beteiligten, die da einfach mitwirken. Erst danach, natürlich so wie es oft ist, wird dann erst bewusst, um was da eigentlich gegangen ist und wie knapp vielleicht gewisse Situationen waren. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, nimmt sehr vieles ein glückliches Ende.
Simone Koren-Wallis:
Dass man Lebensretter sein darf, ist glaube ich eh schon so eine Geschichte, die man nie in seinem Leben vergessen wird. Aber gibt es irgendwie auch noch so lustige Sachen, wo ihr sagt, das passiert uns noch im Rathaus oder? Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht.
Markus Kammerhofer:
Einer der größten Herausforderungen für uns war sicher die Corona-Pandemie. Da, wo wir die Massentestungen geleitet haben. Ich und der Kurt mit über 180 Leuten, wo wir die Sicherheit gemacht haben. Also das war schon einer der größten Herausforderungen in meinem beruflichen Werdegang. Und dann kommen immer wieder schöne Sachen. Die Cup-Feier im Rathaus. Als Sturm Graz Cup-Sieger geworden ist natürlich, war ein Highlight. Der Königsbesuch war ein Highlight. Wir haben da schon viele Diplomaten bekommen, Präsidenten und so weiter. Das ist schon eine super Geschichte, sage ich einmal.
Kurt Lerch:
Und Highlights sind natürlich auch, dass wir ganz nah an der Stadtregierung sind. Das ist ja auch nicht so für jedermann. Aber wie angenehm es eigentlich auch ist zu arbeiten mit denen, dass die wirklich auch sehr freundlich sind und dass da so viel zurückkommt. Auch die Parteien sind jederzeit ein Highlight. Weil man nie weiß, was kommt dann auf einen zu. Einer hat eine liebe Frage, einer hat vielleicht jetzt dann irgendeine Beanstandung oder kennt sich nicht aus, Hilfeleistung braucht und so weiter. Ich freue mich immer wieder, wenn jemand auf mich zukommt und ich kann dem helfen. Also das sind Highlights, kleine Highlights, aber sie sind da.
Simone Koren-Wallis:
Wir sind froh, dass wir euch haben.
Markus Kammerhofer:
Ich muss jetzt einmal dazu sagen. Ich meine, zum Glück haben wir eh circa 30 Alarme im Monat. Und davon sind, sage ich einmal, 90 Prozent Fehlalarme.
Simone Koren-Wallis:
Aber von den 10 Prozent, was ist da alles dabei?
Markus Kammerhofer:
Also Parteien, die nicht gehen wollen, die es nicht verstehen, dass es nicht geht. Leute, die dann im Amtsgebäude irgendwo schlafen, weil sie betrunken sind. Randalierer haben wir auch viel. Dann medizinische Fälle, dass sie Hilfe brauchen, dass jemandem schlecht geworden ist. Oder für blinde Menschen zum Beispiel, dass man die runter begleitet aus dem Amtshaus. Also es sind ganz...
Kurt Lerch:
Also auch Hilfestellungen, also absolut dabei. Sehr viele sogar.
Markus Kammerhofer:
Oder wenn sich ein Bediensteter unwohl fühlt mit der Partei, weil sie nicht allein sein will mit dem. Vielleicht auch einen Zeugen braucht oder solche Sachen. Wo wir viel sind, ist im Jugendamt drüben. Wenn man sagt, da geht es um sensible Sachen wie Kindsentnahmen, Abnahmen und schwierige Gespräche. Da wollen die das halt nicht allein machen. Da sind sie halt froh, wenn wir da dabei sind. Entweder sind wir dann im Nebenzimmer, dass wir das nicht zusätzlich pushen, das Ganze, die Situation. Oder wir sind halt direkt dabei.
Simone Koren-Wallis:
Aber das ist schon so, wie du am Anfang auch gesagt hast. Oder weißt du das, Kurt? Man muss im Nachhinein dann schon schauen, wie sehr man den Job dann mit Heim, Kopf, Herz, was auch immer, und denkt dann über das nach, was man eben im Job gehört hat, gesehen hat, getan hat.
Markus Kammerhofer:
Auf jeden Fall, ja.
Kurt Lerch:
Ist absolut so. Das kann man nur bestätigen.
Markus Kammerhofer:
Wie geht es einem, wenn eine Kindesabnahme war und du bist da dabei...
Kurt Lerch:
Es kommt ja auch vor, dass Leute bei uns vorbeigehen und sagen, stellen wir das schon wieder an, oder was auch immer. Auch diese Ansagen gibt es natürlich bei uns. Nur, die wissen ja nicht, was im Hintergrund läuft. Wieso wir eigentlich auch da sind. Wie es Gott sei Dank vorgekommen ist, Gott sei Dank seid ihr da, und ich fühle mich einfach besser, ich fühle mich sicherer. Und ihr könnt mir helfen, oder wie auch immer in dieser Richtung. Aber natürlich, Gegenteiliges gibt es auch immer wieder. Aber wie gesagt, das prallt eigentlich an einem ab, weil wir wissen genau, was wir tun. Und wie gesagt, auch wenn es für viele vielleicht eigenartig ausschaut, dass wir da jetzt vor dem Eingang stehen, oder wie auch immer, wissen wir schon, wieso und warum das war. Und auch der Großteil der Bevölkerung wird das sicher wissen.
Simone Koren-Wallis:
Wenn ihr jetzt unten steht, und es kommt jetzt irgendwer, so wie du sagst, Parteien, oder irgendwer möchte ins Rathaus hinein, kontrolliert ihr dann jeden?
Kurt Lerch:
Ja, das ist immer so situationsbedingt, weil an und für sich die Frau Bürgermeisterin das jetzt ja nicht so will. Es ist ein offenes Haus, und sie hat kein Problem damit, dass alle Parteien praktisch reingehen können. Natürlich, wie gesagt, es gibt eine gewisse Hausordnung, da schauen wir schon ein bisschen. Weil es ist natürlich, wenn jetzt einer stark betrunken kommt, oder er kommt mit Alkohol, von einer Waffe will ich gar nicht reden, was klar ersichtlich wäre, dann ist das Betreten des Hauses nicht erlaubt. Aber bei allem anderen kein Problem.
Markus Kammerhofer:
Solange wir kein Bedrohungsszenario haben. Beim Waffenfund ist gar keiner reingekommen. Während Corona ist gar keiner reingekommen. Also da ist es strikt nur mit Termin. Deswegen kann man das nicht so sagen, kann man so ins Rathaus rein oder nicht. Das ist wirklich, wie gerade das Bedrohungsszenario ist, wie es eingeschätzt wird, so reagieren wir.
Ob mit Metalldetektor-Kontrollen oder mit Personenkontrollen, nur mit Termin darf man rein, alle dürfen rein, das kann sich von heute auf morgen ändern. Haben wir wieder einmal eine Bombendrohung, gibt es eine Drohung gegen die Frau Bürgermeister, und so ist unser tägliches Brot.
Kurt Lerch:
Oder natürlich Weltgeschehen, weil man jetzt so mit Israel und Palästina, da hat man dann ja auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen, die normal nicht so im Programm sind, durchgeführt.
Simone Koren-Wallis:
Mit welcher Rechtsgrundlage arbeitet ihr da herinnen?
Markus Kammerhofer:
Also wir arbeiten prinzipiell nach dem Hausrecht, das ist bei jedem Eingang der Amtsgebäude festgeschrieben, was die Rechte und die Pflichten von den Parteien sind. Das heißt, wir haben ein striktes Alkoholverbot, Rauchverbot, Hunde dürfen nur mit Leine und Maulkorb ins Amtsgebäude betreten. Und ganz wichtig ist auch, dass dem Sicherheitsdienst Folge zu leisten ist, in den Amtsgebäuden.
Also das heißt, wenn jemand schläft drinnen, wenn jemand randaliert, wenn jemand einfach nicht gehen will, sind wir dafür zuständig und nicht die Polizei. Weil solange es nicht gerichtlich strafbar ist, ist das quasi unser Ding, dass wir den rausbegleiten. Und wir probieren natürlich alles immer mit Worten zu regeln, aber ab und zu versteht es einer nicht, und den müssen wir dann halt rausbegleiten.
Kurt Lerch:
Wie wir sagen, wir probieren das deeskalierend, was noch geht. Aber natürlich, wenn dann ein Angriff von uns gegenüber schon stattfindet, und dann reicht es absolut, dass der einen Schubser macht.
Markus Kammerhofer:
Wir sagen ja immer, aufpassen, wir sind Beamte im Dienst. Das heißt, wenn du es jetzt her haust, dann wird es richtig heftig, weil das ist dann automatisch schwere Körperverletzung. Nur der Versuch. Ich würde mich jetzt ein bisschen zurückhalten und nicht her hauen. Der Versuch ist gleich strafbar wie die Handlung selber.
Simone Koren-Wallis:
Was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen?
Kurt Lerch:
Eigentlich muss ich sagen, wenn es so bleibt, bin ich schon zu 90% zufrieden. Natürlich wäre es noch schöner, wenn sie noch viel mehr verstehen würden von den Parteien, die auf uns zukommen, wenn das einfach eine friedlichere Geschichte wäre, hin und wieder. Aber ansonsten muss man sagen, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt und es funktioniert alles sehr gut.
Simone Koren-Wallis:
So, Hand aufs Herz. Wie hoch ist euer Handykonsum? In der nächsten Folge ist nämlich genau das das Thema und vor allem auch, wie viel Bildschirmzeit ist für Kinder in Ordnung? Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 38: Fastenzeit: Zeit des Verzichts mit Tipps von der Ernährungsexpertin
Auf Wiedersehen Faschingszeit, hallo Fastenzeit. In dieser Folge sprechen wir mit Dr. Ines Pamperl aus dem Amt für Jugend und Familie über das Fasten aus ernährungstechnischer Sicht. Wie sinnvoll und gesund ist dieses Fasten? Auf was soll ich achten? Wie ziehe ich es durch? Und vielleicht schauen wir damit gleich 365 Tage im Jahr auf unseren Körper :)
Intro/Simone Koren-Wallis:
Wiederschauen, Faschingszeit. Hallo, Fastenzeit.
Na, wer von euch hat sich auch irgendwas vorgenommen für diese 40 Tage? Falls es irgendwas mit Ernährung zu tun hat, seid ihr hier genau richtig. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Ines Pamperl.
Ines Pamperl:
Ja, hallo, mein Name ist Ines Pamperl. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin. Ich leite den ärztlichen Dienst und der ärztliche Dienst gehört zum Amt für Jugend und Familie.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Saftfasten, Eintagesfasten, Basenfasten, Intervallfasten, Wasserfasten, Buchinger Heilfasten und so weiter und so fort. Es gibt so viele Arten des Fastens. So, jetzt sind wir mittendrin in der Fastenzeit, auch schon Mittwoch gestartet. Was ist Fasten überhaupt?
Ines Pamperl:
Grundsätzlich geht es beim Fasten darum, dass man auf etwas verzichtet. Du hast jetzt einfach Fastenarten angesprochen, wo es um Ernährung geht. Aber natürlich gibt es auch andere Arten. Handyfasten, Autofasten, kein Alkoholtrinken. Fasten bedeutet, ich esse etwas nicht oder ich mache etwas nicht. Also ich verzichte auf etwas.
Simone Koren-Wallis:
Findest du es sinnvoll?
Ines Pamperl:
Durchaus. Man muss nur überlegen, wie faste ich, wenn wir jetzt bei der Ernährung bleiben. Das ist ja heute unser Thema. Wenn ich jetzt faste, man muss ja unterscheiden, das Teilfasten oder eben zum Beispiel das Intervallfasten und ein Heilfasten. Ein Heilfasten muss immer medizinisch begleitet werden. Das ist über einen längeren Zeitraum, wo ich praktisch kaum Kalorien zu mir nehme.
Simone Koren-Wallis:
Körper ist ein bisschen rebooten, oder?
Ines Pamperl:
Ja, genau. Da geht es ja einfach darum, dass Stoffwechselprozesse verändert werden und dass es auch für die Psyche eine Änderung ist. Also man kommt dann schon ab dem dritten Fastentag in so einen leicht euphorischen Zustand. Das hängt mit Hormonproduktion zusammen. Die ersten drei Tage sind sicher die härtesten, aber dann nach dem dritten Tag hat man dann diese Glückshormone und dann funktioniert das wunderbar. Und ein Heilfasten ist zum Beispiel aber auch immer mit Bewegung kombiniert. Weil was passiert natürlich, wenn ich über drei, vier Wochen nicht esse oder kaum esse, dann nehme ich ab. Ich möchte aber nicht Muskelmasse abnehmen. Das heißt, ich muss schauen, dass ich mich während diesem Fastenprozess auch bewege. Kein Leistungssport, aber einfach spazieren gehen, Yoga, Schwimmen, einfach Bewegung, sodass die Muskulatur einen Anreiz hat, sich nicht komplett abzubauen. Weil das wäre natürlich wieder ein gegenteiliger Effekt. Unser grundsätzliches Problem ist, dass wir einfach viel zu viel essen. Chronisch zu viel essen. Wir essen, weil wir Langeweile haben. Wir essen, weil etwas gut riecht. Wir essen, weil es einfach am Tisch steht. Das heißt, wir essen ständig über unseren Hunger. Und da kann man eigentlich schon ansetzen. Fasten würde der erste Schritt für mich bedeuten, einmal zu überlegen, wie ist mein aktuelles Essverhalten. Wie viel Fastfood ist in meinem Ernährungsplan drinnen? Wie viel sogenanntes Conveniencefood ist in meinem Ernährungsplan drinnen? Das heißt, wir essen so oft nebenbei, im Gehen, ohne darauf zu achten, was wir in uns hinein essen. Conveniencefood heißt, es ist alles praktisch vorbereitet, verzehrfertig. Ich muss mich eigentlich um nichts mehr kümmern. Ich gebe es in die Mikrowelle und esse. Das Problem ist, diese Produkte, Fastfood, Conveniencefood, hat von vielem zu viel. Und zwar zu viel Salz, zu viel Fett, zu viel Zucker und meistens sind die Lebensmittel hoch verarbeitet.
Das heißt, der erste Schritt Richtung Fasten ist logischerweise, Verzicht auf ständig Verfügbares. Hinzu bewusste Essen, Frischessen, regional, saisonal, in diese Richtung. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt Richtung Fasten ist, zu überlegen, was trinke ich und wie viel trinke ich. Unser Körper funktioniert optimal, wenn wir sehr viel Flüssigkeit zu uns nehmen. Und damit meine ich jetzt tatsächlich Wasser. Also Leitungswasser, evtl. auch Mineralwasser, Kräutertees, Ungezuckert. Zwei Liter, zweieinhalb Liter, auf diese Menge könnte man schon kommen.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es dann noch einen dritten Schritt?
Ines Pamperl:
Der dritte Schritt ist dann natürlich der Gedanke Fasten. Warum möchte ich Fasten? Was möchte ich meinem Körper damit Gutes tun? Wenn ich den Gedanken habe zu Fasten, dann sollte ich mir schon ein bisschen überlegen, was will ich damit eigentlich bezwecken? Wenn ich nur Fasten möchte, um Gewicht abzunehmen, dann ist es vielleicht nicht richtig. Natürlich ist es meistens ein guter Nebeneffekt, dass die Kilos ein bisschen purzeln. Aber wenn ich langfristig Gewicht abnehmen möchte, dann muss ich doch meine Ernährungsgewohnheiten langfristig umstellen. Da hilft das Fasten kurzfristig, aber nicht langfristig.
Das Fasten hat sehr viele positive Auswirkungen. Was man sagen kann, ist, dass ziemlich sicher Intervallfasten einen positiven Effekt auf den Körper hat.
Simone Koren-Wallis:
Erklär das einmal für alle, die das vielleicht gar nicht kennen.
Ines Pamperl:
Beim Intervallfasten geht es darum, dass ich über einen längeren Zeitraum immer Phasen habe, wo ich nicht esse. Also so 14 bis 16 Stunden, wo dem Körper keine Nahrung zugeführt wird.
Simone Koren-Wallis:
Warum?
Ines Pamperl:
Es gibt Hinweise, dass die Zellen im Körper das durchaus brauchen. Es gibt einen Begriff, der sich Autophagie nennt. Das ist eine Art Selbstverdauungsprozess, also eine Reinigung. Unserem Körper tut es gut, über längere Zeit einmal nicht verdauen zu müssen. Weil die Selbstreinigungskraft des Körpers, der Zellen einfach besser funktioniert, wenn einmal ein bisschen Pause ist. Und gut erklären kann man das damit, dass in unserer Ernährung meistens zu viel Zucker enthalten ist, aber auch zu viel Eiweißstoffe. Und ein zu hoher Blutzuckerspiegel hat negative Effekte auf den Körper. Da entstehen einfach Substanzen, die Entzündungsprozesse im Körper anheizen können und Entzündung im Körper verstärken können. Und diese Substanzen nennen sich AGEs. Die entstehen eben, wenn ich Speisen zu mir nehme, die eben zu viel Zucker enthalten, zu viel Eiweiß enthalten. Oder auch bei der Herstellung von Lebensmitteln. Bei sehr, sehr hohen Temperaturen können auch diese sogenannten Ages entstehen.
Die verursachen im Körper, wie gesagt, Entzündung. Und Entzündung vor allem in den Gefäßen. Das heißt, wenn ich mich über lange Zeit chronisch schlecht ernähre, also viel Fast Food, viel Convenience Food, einfach zwischendurch essen und ständig esse, esse, esse, der Blutzuckerspiegel sehr hoch ist, dann habe ich gute Chancen, dass ich meine Entzündungsprozesse im Körper extrem anheize und dann einfach chronische Erkrankungen eher begünstige. Gefäßerkrankungen, Herzerkrankungen, Diabetes, alles was mit dem Stoffwechsel zusammenhängt. Wenn ich es schaffe, über 15 bis 16 Stunden immer wieder nicht zu essen, tue ich etwas Gutes für meinen Körper. Ich rege die Selbstreinigung der Zellen an, die sogenannte Autophagie. Das heißt, möglicherweise lebe ich dann länger und schaue jünger aus. Und deshalb ist es gut, über längere Zeit regelmäßig einmal nicht zu essen.
Simone Koren-Wallis:
Damit der Körper sich quasi ein bisschen erholen kann von dem, was wir ihm sonst so antun.
Ines Pamperl:
Genau, genau.
Simone Koren-Wallis:
Bei uns im Freundeskreis, in der Familie, da gibt es natürlich das Fleischfasten, dieses ursprüngliche, ich esse jetzt 40 Tage kein Fleisch. Ganz beliebt ist auch Alkoholfasten, du hast es eh schon angesprochen. Ich trinke jetzt einmal 40 Tage keinen Alkohol, natürlich mit zwei Joker.
Und ganz neu, das heißt neu, kenne ich auch schon seit ein paar Jahren, ist dieses Zuckerfasten. Also ich sage, okay, ich probiere jetzt 40 Tage lang auf Zucker zu verzichten.
Ines Pamperl:
Also Zuckerfasten ist grundsätzlich eine super Idee. Ich würde dafür plädieren, den Zucker einfach langfristig deutlich zu reduzieren. Das ist auch leichter, als den Zucker komplett wegzulassen. Man kann in den ersten zwei, drei Tagen tatsächlich Kopfweh bekommen, wenn ich auf Kohlenhydrate, sprich auch Zucker, massiv verzichte, weil unser Gehirn braucht, um zu funktionieren, einfach Kohlenhydrat. Und wenn ich auf den Zucker verzichte, dann kann das bei vielen Kopfweh auslösen.
Simone Koren-Wallis:
Und was macht die Stadt Graz jetzt genau mit Ernährungsmedizin? Also im ärztlichen Dienst bieten wir eine ernährungsmedizinische Beratung an, nicht für Erwachsene. Das heißt, es funktioniert meistens so, Kinder werden ja schulärztlich untersucht von Ärztinnen in unserem Team. Und wenn hier Ernährungsauffälligkeiten auffallen, also das heißt Übergewicht, Untergewicht oder sonstige Probleme, dann können die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam einen Termin vereinbaren. Und wir reden einmal darüber, was es braucht, damit die Ernährung wieder top ist. Und seit Jänner 2024 gibt es auch etwas Neues. In der Zentrale des Amtes für Jugend und Familie in der Kaiserfeldgasse biete ich einmal im Monat, und der nächste Termin ist Donnerstag, 7. März, am Nachmittag von 15 bis 17 Uhr eine offene Ernährungsberatung an. Da geht es um gesund oder ungesund. Das heißt, da können Eltern mit Kindern oder nur die Eltern oder nur die Kinder oder Jugendliche einfach kommen und sich unverbindlich informieren über Ernährung. Das ist jetzt in dem Sinn keine Ernährungsberatung, sondern einfach, wenn man Fragen hat zum Thema Ernährung, kann man kommen.
Simone Koren-Wallis:
Und vielleicht dann schon einmal, dass die Kinder zumindest ein bisschen gesünder werden.
Ines Pamperl:
Ja, das wäre natürlich der große Wunsch.
Simone Koren-Wallis:
Nächstes Mal plaudern wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es so schön heißt. Denn die Rathauswache gewährt uns einen Einblick in ihre Arbeit. Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 37: Das Superwahljahr 2024
Dieses Jahr hat es in sich: wir dürfen gleich 3 Mal unsere Stimme abgeben: bei der EU-Wahl, der Nationalratswahl und der Landtagswahl. Wie sich die Stadt Graz rund um Wolfgang Schwartz und dem Referat "Meldewesen und Wahlen" darauf vorbereitet, was sich für uns Wähler:innen ändert und warum die Ergebnisse an den Wahlsonntagen später als bisher bekannt gegeben werden, hören Sie in dieser neuen Podcastfolge!
Intro/Simone Koren-Wallis:
Super Wahljahr 2024, gleich drei Wahlen stehen uns heuer bevor. Wie sich die Stadt Graz dafür vorbereitet, was sich für uns als Wähler:Innen dabei ändert und warum die Ergebnisse an den Wahlsonntagen später als bisher bekannt gegeben werden. Ich bin Simone Koren-Wallis, mein Gast Wolfgang Schwartz.
Wolfgang Schwartz:
Hallo, mein Name ist Wolfgang Schwartz. Ich habe bei der Stadt Graz das Referat für Meldewesen und Wahlen über und darf da im heurigen Jahr auch die drei voraussichtlich stattfindenden großen Wahlereignisse organisieren mit meinem Team.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Lieber Wolfgang, wie sehr freust du dich auf dieses Jahr?
Wolfgang Schwartz:
Dieses Jahr ist ganz entspannend. Wir wissen schon seit längerer Zeit, dass es herausfordernd wird. Was es besonders macht ist, wir kennen unsere Projekttermine noch nicht. Die einzige Wahl, die schon feststeht, ist eben der 9. Juni, die Wahl der Mitglieder zum Europäischen Parlament. Und alle anderen Wahltermine sind zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Und wir werden dann schauen, wie wir uns darauf einstellen müssen, wenn wir erst kurzfristig erfahren, wann dann konkret die anderen Wahltermine stattfinden. Für uns natürlich ein gewisser Aufwand und innerhalb von kurzer Zeit muss eventuell eine Wahl dann eingeplant werden und alles auf Schiene sein und das ist schon eine Herausforderung, die uns aber bekannt ist und auch unsere Arbeit ist.
Simone Koren-Wallis:
Von welchen Wahlen sprechen wir?
Wolfgang Schwartz:
Also wir sprechen heuer einmal von der Europawahl am 9. Juni dieses Jahres, dann normalerweise im September die Nationalratswahl und wenn der Fünfjahrestakt auch eingehalten wird, im November, dort haben wir vernommen, eventuell am 24. November, die Landtagswahl in der Steiermark.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt hat man aber letzte Woche in verschiedensten Zeitungen gelesen, dass es doch im Juni passieren könnte, dass die Steiermark wählt. Was löst das in dir aus, wenn du sowas liest?
Wolfgang Schwartz:
Es ist schon eine gewisse Spannung, weil wir wissen, okay, wir haben teilweise Wahlrechtsänderungen letztes Jahr beschlossen bekommen im Nationalrat, die noch nie so in der Praxis vollzogen wurden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir kurz hintereinander zwei Wahlen zu vollziehen haben und viele Prozesse parallel laufen für zwei Wahlen oder eventuell sogar einen Superwahlsonntag geben sollte, dann ist viel Neues an einem Tag sehr intensiv. Wenn ich zwei Wahlen habe, heißt das nicht, dass sich das vereinfacht, sondern ich habe alles doppelt. Ich habe zwei Wahlurnen, ich muss zwei Niederschriften führen, ich muss zwei Abstimmungsverzeichnisse, zwei Wählerverzeichnisse führen. Die Befürchtung ist einfach groß, dass die Personen vor Ort eine gewisse Überforderung vielleicht damit haben und dass Fehler passieren können. Und wie wir seit 2016 wissen, Fehler in der Wahl müssen nur den Anschein erwecken, dass irgendetwas nicht ganz korrekt gelaufen ist und können zu einem Einspruch führen. Alle sind bemüht, das einwandfrei zu organisieren, aber es sind sehr viele Personen an einem Wahlsonntag österreichweit im Einsatz und es kann immer irgendwo eine Kleinigkeit vielleicht so ablaufen, wie man es nicht geplant hat.
Simone Koren-Wallis:
Für was bist du jetzt eigentlich genau verantwortlich? Wirklich für die komplette, nehmen wir jetzt eine Wahl her, egal was für eine, mit deinem Referat, ihr macht wirklich von Anfang bis Ende alles zu dieser Wahl?
Wolfgang Schwartz:
So kann man sagen, genau. Also wir müssen die Wahlrechtsvorschriften, die entsprechenden Wahlen, umsetzen in der Praxis. Das bedeutet natürlich, meistens startet es mit einem Stichtag, der ist so circa 80 Tage ungefähr vor einer Wahl. Da wird abgezogen, wer ist wahlberechtigt in der Datenbank im zentralen Wählerregister, das wir jetzt haben in Österreich seit 2018. Und dann wird festgestellt, wer ist wahlberechtigt, wie viele Wähler haben wir. Das Ganze wird dann auch verwendet, die Daten weiter, um eben die Leute zu informieren, dann später mit der amtlichen Wahlinformation, Achtung, du bist wahlberechtigt, bitte gehen das und das Wahllokal oder wenn du das nicht besuchen kannst, fordere gerne die Briefwahl an oder andere Möglichkeiten. Hausbesuche gibt es auch für bettlägerige und erkrankte Personen natürlich.
Und das alles heißt zu organisieren, das heißt die Drucksorten, das Papier, das Personal. Ein großer Aufwand ist natürlich in den letzten, eigentlich jetzt muss man sagen 15-16 Jahren, die Briefwahl geworden, die stetig steigt, weil wir einfach in kurzen Zeitrahmen von drei, dreieinhalb Wochen 40.000-50.000 Wahlkarten ausstellen müssen in Graz, die auch korrekt nach Hause geschickt werden. Es sollte richtig befüllt sein mit den richtigen Stimmzetteln und die Materialien müssen passen. Und gleichzeitig muss aber auch die Parallelstruktur der Wahllokale und Wahlsprengel in gleicher Art und Weise aufrechterhalten werden. Und das geht eben Los von Ausschreibung von Transporten, Dienstleistungen, Einkauf von Papier, Unterlagen, Mappen, Kugelschreiber, alles was man braucht als Wahlbehörde. Und dann natürlich der große Brocken Personal... 270 Wahlsprengel, also werden noch mehr werden sogar in Graz wahrscheinlich, sind entsprechend zu bestücken und auszustatten, auch personalmäßig natürlich. Das heißt wir als Stadt Graz stellen den Wahlleiter und Stellvertreter, eventuell noch ein Hilfsorgan und der Rest wird von den Parteien nominiert. Die Parteien nominieren ein Wahlbehördenmitglied, einen Beisitzer. Und dann wissen wir, das ist das Team für den Wahlsonntag. Und wenn man das hochrechnet, 270 mal zwei Personen, sage ich mal ungefähr, haben wir mit Reserve, die wir brauchen, circa 700 Personen, die wir einmal schulen müssen und für den Wahlsonntag zur Verfügung stellen. Das wäre einmal das Team vor Ort. Und im Hintergrund gibt es dann eben noch natürlich IT, die wir brauchen, unser Organisationsteam, das sind noch einmal mit Rücknahmeteams, die Wahlunterlagen müssen ausgegeben werden und so weiter. Da sind circa noch einmal 70-80 Leute im Einsatz.
Simone Koren-Wallis:
Klingt nach ein bisschen Arbeit, hätte ich gesagt, oder?
Wolfgang Schwartz:
Ja, wobei man, wenn man das dreimal macht, gut dann eingeschossen ist in dem Jahr wahrscheinlich.
Simone Koren-Wallis:
Du hast von Änderungen gesprochen, also was hat sich geändert?
Wolfgang Schwartz:
Also letztes Jahr sind im Nationalrat große Wahländerungen beschlossen worden, einstimmig von allen Parteien. Ein großes Thema ist zum Beispiel die Barrierefreiheit. Die Barrierefreiheit bedeutet jetzt, dass jedes Wahllokal barrierefrei zugänglich sein muss. Es gibt eine Übergangsfrist, aber wir versuchen als Stadt Graz eben schon vor dem 01.01.2028 dem Genüge zu tun, sind jetzt mitten in der Analyse, eben auch schon im Jänner jetzt, um zu schauen, welche Wahllokale eventuell noch mit Stufen oder problematischen Zugängen ausgestattet sind oder wo wir wie was beheben könnten. Aber im Endeffekt ist es dann oft die Frage wahrscheinlich, ist eine schräg verlaufende Stufe von 4 cm auf 2 cm ein Hindernisgrund oder nicht? Oder müssen wir das Wahllokal verlegen und alle dann dort befindlichen Wähler müssen dann zwei Kilometer weiterfahren, weil man sagt, die Stufe ist vielleicht nicht optimal barrierefrei. So sind jetzt Entscheidungen auf die Wahlbehörde zugekommen, die wir so noch nicht hatten.
Simone Koren-Wallis:
Du hast vorher auch die Briefwahl angesprochen, da hat sich jetzt auch ja einiges geändert, oder?
Wolfgang Schwartz:
Genau, der Gesetzgeber hat erkannt auch, dass diese Montagszählungen, die damals ja auch der Einspruchsgrund waren, 2016 teilweise einfach in gewisse Größenordnungen kommt. Und da muss man sagen, als Stadt Graz sind wir die größte Verwaltungseinheit diesbezüglich, weil Wien magistratische Bezirksämter hat und kleiner ist wie Wien in dieser Struktur, die einfach gefährlich wird für einen Wahleinspruch, weil einfach die Übersichtlichkeit, wenn ich mit so vielen Personen in einer großen Fläche Wahlkarten auszähle, irgendwo problematisch werden könnte. Und somit hat der Gesetzgeber jetzt beschlossen, letztes Jahr, dass die Briefwahlunterlagen nicht nur am Montag ausgezählt werden, sondern alle jene, die bis Freitag 17 Uhr zurückkommen, müssen wir auf die Sprengel aufteilen, dort, wo sie eigentlich ursprünglich gewählt hätten. Die bringen wir am Sonntag in die Sprengel hinaus und die werden in den Sprengeln mitgezählt. Das bedeutet jetzt, der Sprengel hat natürlich einen gewissen Mehraufwand, weil er im Schnitt zwischen 150 und 200 Wahlkarten noch bewerten muss nach Wahlschluss und auch auszählen muss, gemeinsam mit den Stimmen, die am Sprengel am Wahlsonntag abgegeben wurden. Das verzögert natürlich in Wirklichkeit auch eine Ergebnisermittlung. Wir rechnen so, dass wir so eineinhalb, zwei Stunden später zu einem Ergebnis in Graz kommen werden. Dafür muss man aber sagen, hat man zirka, wenn man sich anschaut, wie hoch die Briefwahl ist, mit einem Viertel, einem Drittel der Wahlstimmen, ein Ergebnis, das wahrscheinlich 95 Prozent der Stimmen am Wahlsonntag schon beinhaltet.
Ein weiteres Thema, das jedem Wahlberechtigten auffallen wird, ist die Hausgrundmachung. Die Hausgrundmachung ist bis dato, kurz nach dem Stichtag, gleich im Haus angeschlagen worden und angebucht worden und hat alle Wahlberechtigten aufgelistet. Da hat der Gesetzgeber aus Datenschutzgründen jetzt auch die Notbremse gezogen und hat gesagt, okay, wir werden nicht mehr nachschauen, wer in dem Haus wahlberechtigt ist, sondern einen Hinweis geben, dass eine Wahl stattfindet. Und es gibt einen QR-Code drauf, mit dem kann man selber in die zentrale Wählerevidenz einsteigen, wenn man die ID Austria besitzt und kann nachschauen, ist man im Wählerverzeichnis. Das heißt, die Hausliste, bitte beachten, ist nicht mehr wie gewohnt, dass man schauen kann, ist man wahlberechtigt, sondern man bräuchte die ID Austria, dann kann man nachschauen.
Simone Koren-Wallis:
Eigentlich macht man es ja immer leichter für möglichst viele Personen, dass sie auch wählen können. Du musst nicht mehr hin zum Wahllokal, du kannst Briefwahl machen und wie auch immer. Warum gehen aber immer weniger Leute wählen?
Wolfgang Schwartz:
Also ich glaube, wenn jemand wählen möchte, kann er seine Stimme abgeben. Er hat durch die Briefwahl in Wirklichkeit nahezu drei Wochen lang Zeit. Also gehe ich davon aus, dass es andere Beweggründe sind, dass man vielleicht so die Sinnhaftigkeit nicht erkennt, was die einzelne Stimmabgabe bewirken kann. Und die Gespräche habe ich des öfteren, sowohl im privaten wie auch im beruflichen, oder wenn wir eben manchmal mit Schülern zu tun haben oder mit jungen Leuten, dann probiere ich es ihnen auch näher zu bringen. Die einzelne Stimme darf ich da nicht betrachten. Wenn sich das viele Leute denken, dann sind es viele einzelne Stimmen, die schon etwas bewirken können. Und vor allem bei den Schülern sage ich ganz gerne, ihr seid heute zu uns hergekommen. Wie seid ihr hergefahren? Seid ihr mit den Öffentlichen gefahren? Dann habt ihr dort eine Verkehrsbestimmung gehabt, die die Politik bestimmt in Wirklichkeit. StVO, Straßenverkehrsordnung, wo dürft ihr gehen? Dürft ihr mit dem Auto da parken? Was dürft ihr machen? Dürft ihr draußen auf der Straße euren Kaugummi irgendwo hinpicken? Alles Rechtslagen, die in Wirklichkeit über unsere Politiker, die wir wählen, mit den Rahmenbedingungen in den entsprechenden Gremien geschaffen werden.
Also betrifft es uns jeden. Ich kann nicht sagen, die Politik betrifft mich nicht. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch schafft von der Politik, die zwar immer wieder, man sieht es ja, um die Wahlbeteiligung zu heben, verschiedene Schienen aufmacht und probiert, die Leute zu motivieren, aber ich glaube, es ist nicht der Punkt, an dem es fehlt. Es ist die Politik selber, die in Wirklichkeit dazu hauptsächlich beitragen könnte, die Leute wieder zu motivieren, dass sie sagen, okay, das ist sinnvoll, was ich da an Stimme abgebe. Und wenn man wirklich ein bisschen surft, oder jeden Tag sind fast Nachrichten über Beeinflussung von Wahlen, über KI-gesteuerte Geschichten, über Personen, die nicht frei wählen können, weil eben dementsprechend Personen vor Ort sind, die genau schauen, was sie wählen, und das müssen wir einfach schätzen lernen. Wir leben in einem Land, wo es eigentlich, so muss man es empfinden, absolut frei ist. Ich kann meine Meinung äußern, ich kann wählen, was ich möchte, es hat keine Konsequenzen in meinem Alltag. Leider ist es weltweit, wenn man schaut, nicht in allzu vielen Ländern mehr so frei möglich, und das sollen wir schätzen wissen. Und je weniger wir das schätzen, umso gefährlicher wird es, dass dieser demokratiepolitische Prozess eigentlich uns abhanden kommt.
Simone Koren-Wallis:
Und wie geht es dir dann, wenn die Wahl geschlagen ist und die Wahl ist vorbei? Bist du dann richtig so, uah?
Wolfgang Schwartz:
In Wirklichkeit ist es so, dass es bei uns langsam abflaut. Also der Wahltag ist für uns natürlich schon herausfordernd, bis dorthin hat sich schon sehr viel getan. Wenn dann aus dem Bekanntenkreis mit uns diskutieren wollen, wie das Ergebnis ist, merkt man erst, wir wissen auch gar nicht, wie das Ergebnis ist. Wir versuchen befasst damit zu schauen, dass die Ergebnisse da sind, dass alle Sprengel da sind, dass die Ergebnisse passen, die Zahlen stimmen, dass wir oft gar nicht gemerkt haben, okay, wie ist das Österreichweit ausgegangen, welche Partei ist jetzt vorne, welche Gespräche gibt es da schon. Das realisieren wir dann oft gar nicht, weil wir gar nicht die Zeit haben. Das ist dann oft so zwischen Tür und Angel, dass man sagt, hast du gesehen, und da und dort und in dem Ort ist es so. Und auf der Ebene und auf Bundesebene sage ich, okay, ja, aber ich kämpfe gerade noch, ein Sprengel hat noch kein Ergebnis gemeldet, wir sind noch dahinter und so. Das realisiert man in dem Ding gar nicht. Man sieht, der Fokus ist von uns wirklich organisatorisch, alles muss da sein. Und die Ergebnisse und was dann daraus entsteht, was man langsam ein bisschen so einmal dann Medienlesen am Anfang wieder sieht, okay, es interessiert uns natürlich, aber es ist einfach keine Zeit dafür, muss man sagen, in diesem Ablauf.
Simone Koren-Wallis:
Ihr seid die Einzigen, die die Wahlergebnisse dann erst ein paar Tage später realisieren.
Wolfgang Schwartz:
Wir realisieren sie als Erste, aber wir realisieren sie nicht. Das stimmt, das ist auch ganz gut. Das habe ich so noch nie gesehen.
Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge starten wir hinein in die Fastenzeit und reden darüber, wie das Fasten gelingen wird und wie nicht und wie sinnvoll es eigentlich ist. Wir hören uns, ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 36: Verlieren, abgeben, wiederfinden: Das Fundservice
Koffer, Schultaschen, Musikinstrumente, Gebisse und Co: 14.324 Gegenstände sind 2023 im Fundservice der Stadt Graz abgegeben worden. Wie diese Gegenstände wieder zu ihren Besitzer:innen zurückfinden, wie lange die Gegenstände aufbehalten werden müssen und wie jeder von uns auf Schnäppchenjagd gehen kann, das erzählen Peter Krusic und Dieter Kainz vom Fundservice.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Egal ob man was verliert, was findet oder auf Schnäppchenjagd gehen will, da ist das Grazer Fundservice die richtige Adresse. Welche skurrilen Gegenstände da zu finden sind und vieles, vieles mehr hören wir in dieser Folge von Graz Geflüster.
Ich bin Simone Koren-Wallis, meine Gäste Peter Krusic und Dieter Kainz.
Peter Krusic:
Ja, mein Name ist Peter Krusic, ich bin aus der Präsidialabteilung, bin da zuständig für die Servicestellen und auch das Fundservice, wo wir uns heute befinden.
Dieter Kainz:
Mein Name ist Kainz Dieter und bin der Leiter im Fundservice in der Annenstraße 19.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Wenn man beim Fundamt der Stadt Graz einen Termin hat, hat man fast ein bisschen Angst, die Jacke abgeben zu müssen. Kriege ich die dann eh wieder zurück?
Peter Krusic:
Ja, spätestens nach einem halben Jahr nach der neuen Regelung.
Simone Koren-Wallis:
Vielen Dank, dass ich heute im Fundamt der Stadt Graz sein darf. Wie funktioniert es eigentlich? Was ist, wenn ich was verliere? Was ist, wenn ich was finde?
Peter Krusic:
Ja, es ist an und für sich ja in Österreich gesetzlich geregelt. Also wenn man etwas findet, hat man die Verpflichtung, das eigentlich so schnell als möglich abzugeben. Abgeben kann man das in Graz in jeder Servicestelle. Hier im Fundservice kann man es abgeben. Aber wir haben in Graz auch die Möglichkeit, rund um die Uhr, auch Sonntag, von 0 bis 12 Uhr, Mitternacht des nächsten Tages, das bei der Feuerwehr am Lendplatz bzw. im Amtshaus beim Portier abzugeben. Und immer, wenn etwas abgegeben wird, kann man sich sicher sein, wenn der Verlustträger seine Sachen wiederfindet, sein verlorenes Geldtascherl, seine Ausweise, der ist dann recht glücklich. Und das merken ja die Mitarbeiter dann da, wenn sie etwas ausfolgen können.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, auch wenn ich etwas finde, ich habe die Pflicht, zu einer Fundstelle zu gehen und es abzugeben?
Peter Krusic:
Ja, das ist eine Verpflichtung. Man hat aber auch Rechte. Das ist das Recht auf Eigentum. Also wenn es dann der Verlustträger nicht abholen würde, kann man das quasi dann beanspruchen, diesen Gegenstand. Beziehungsweise gibt es natürlich das Recht auf Finderlohn.
Simone Koren-Wallis:
Oh, okay, jetzt wird es dann schon spannend. Das heißt, Finderlohn, in welchem Bereich bewegen wir uns da?
Peter Krusic:
Ja, Finderlohn ist bis zu einer Wertgabe von 2.000 Euro haben wir, sind 10% des Finderlohns. Aber da wird immer unterschieden, ob das jetzt diese Sache verloren wurde, seine Feinheit, oder vergessen wurde. Wenn die Sache irgendwo vergessen wurde, also sprich, ich lasse mein Geldtascherl irgendwo im Gasthaus liegen, der Wirt findet das Ganze, bringt es zu uns, ist das eigentlich ein vergessenes Stück. Und da sind an und für sich dann nur mehr die Hälfte des Finderlohns dann zu beanspruchen.
Simone Koren-Wallis:
Gehen wir einmal weiter. Da sehe ich schon die ersten Schlüssel. Bitte, wie dokumentiert sich das Ganze immer? Das ist ja viel Aufwand, oder?
Dieter Kainz:
Ja, wir haben eine eigene Fundanwendung, ein Programm, wo wir die ganzen Produkte oder verlorenen Sachen aufnehmen, ist österreichweit einsehbar unter fundamt.gv.at. Jedes Stück, was hereinkommt, wird natürlich so gut wie möglich aufgenommen, dass wir erst einmal selber den Überblick haben, dass wir selber finden die Sachen wieder.
Simone Koren-Wallis:
Das ist nicht, dass es bei euch wieder verloren wird, oder?
Dieter Kainz:
Sollte normalerweise bei uns nicht verloren werden.
Simone Koren-Wallis:
Gut, jetzt sind wir da bei den Schlüsseln. Da ist ja alles dabei, gell? Von Autoschlüssel über Haustürschlüssel, also da ist wirklich alles.
Dieter Kainz:
Schlüsseln ist quer durch die Palette von teuersten Autoschlüsseln. Wir haben schon Maserati, Ferrari-Schlüsseln, also wir haben schon alles gehabt. Große Schlüsselbunde von Zeitungszustellern, quer durch die Palette, also wir sehen da jetzt ungefähr 1000 Schlüsseln in diesem Kasten. Es wird von uns nichts ausgegeben, ohne dass irgendein Nachweis erbracht wird, dass bei den Schlüsseln z.B. muss er mit einem Vergleichsschlüssel kommen, da vergleichen wir die Schlüsselnummer, also es geht nichts raus, ohne dass wir das genau kontrolliert haben vorher.
Simone Koren-Wallis:
Das finde ich schon lustiger, weil das ist auch mir schon einmal passiert, das sind die Regenschirme.
Peter Krusic:
Ja genau, die Regenschirme sind so ein typisches Klimaprodukt, muss man sagen, weil je nach Wetterlage bzw. in der Übergangszeit ist es so, in der Früh regnet es, hat man den Schirm, Mittag scheint die Sonne, dann vergisst man dann meistens irgendwo. Also wie gesagt, da merkt man die Wetterlage in der Abgabe der Regenschirme.
Simone Koren-Wallis:
Wow, also man geht da jetzt rein durch eine graue Tür und dann steht man so in einem Art Lager mit ganz hohen grauen Schränken und da haben wir einmal Sackerl und Rucksäcke und Koffer. Leute vergessen ihre Koffer?
Dieter Kainz:
Die werden natürlich auch vergessen, die meisten Koffer, auch volle Koffer, kommen meistens von der ÖBB, sind meistens Reisende, die die Koffer warum auch immer vergessen, weil sie einen großen Koffer vergessen, irgendwann muss er glaube ich einmal abgehen. Also wir haben schon alles gefunden, es gibt fast nichts mehr, was wir nicht schon gesehen haben.
Simone Koren-Wallis:
Was ist das skurrilste? Jetzt sind wir schon beim Thema. Aha, da lachen beide. Was sind die skurrilsten Sachen, die bei euch abgegeben worden sind?
Dieter Kainz:
Es sind schon viele skurrile Sachen, ich habe von Gebissen angefangen. Gebisse, muss ich sagen, wir haben schon mehrere Gebisse hereinbekommen.
Simone Koren-Wallis:
Nein, weil die Frage, die sich jetzt mir stellt, wie schaue ich dann, ob das mein Gebiss ist?
Dieter Kainz:
Das ist natürlich eine gute Frage, man weiß ja ungefähr, wie viele Zähne es fehlen, wenn man ein Gebiss hat oder nicht, das weiß man ungefähr von der Anzahl der Zähne. Wir haben natürlich auch schon gehabt, muss ich immer wieder sagen, dass einer gekommen ist, ein Mann, der hat im Zuge einer Feier seine Zähne verloren, und er war heute wieder da, der hat schon zum zweiten Mal sein Gebiss verloren. Und beim ersten Mal, wie er da war, hat er natürlich probiert, weil er sich nicht ganz sicher war.
Simone Koren-Wallis:
Also er hat mehrere Gebisse durchprobiert bei euch?
Dieter Kainz:
Die Auswahl war nicht so groß, von der Anzahl der Zähne, was er verloren hat, es hat aber ziemlich übereinstimmt, dass er gewusst hat, ich wollte nicht selber nachschauen. Aber das Glück war, es war wirklich sein Gebiss. Aber man schaut in dem Fall nachher gerne weg einmal ganz kurz.
Simone Koren-Wallis:
Schauen wir mal weiter, jetzt kommen wir nämlich zu den Jacken, Koffer gibt es einige, Räder, Räder sind dann auch, nicht nur gestohlen werden, sondern sind auch gefunden, dann Krücken.
Dieter Kainz:
Werden natürlich auch vergessen, Krücken. Ist natürlich auch die Frage, wie derjenige ohne Krücken weitergehen kann.
Simone Koren-Wallis:
Bei euch ist lustig, hab ich schon gesehen. Gut, dann gibt es ganz, ganz viele Jacken, und wirklich auch sehr, sehr schöne. Ein Jahr muss man es aufbewahren, und dann?
Peter Krusic:
Nein, wie gesagt, es hat jetzt nur eine Änderung gegeben, Fundstücke, das war jetzt hervorragend, Fundstücke, die unter 100 Euro wert sind, was eben die meisten Jacken da sind, braucht man nur ein halbes Jahr aufbewahren. Und danach versuchen wir sie, im Freiverkauf kann man sie erwerben, diese Jacken, nach einem halben Jahr. Jetzt nachher neu, das, was alles halb nicht abgeholt oder verwertet werden kann, kriegt jetzt neuerdings die Holding, die das Ganze dann auch im Zuge vom Recycling, da ist ja gerade Textilien ein wertvoller Rohstoff, die dann weiterverwenden und weiterverwerten.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, Didi, man kann zu euch auch herkommen, nicht nur, wenn man was verloren hat oder was gefunden hat, sondern auch, wenn ich was kaufen will?
Dieter Kainz:
Man kann natürlich bei uns auch Sachen kaufen, zu einem sehr guten Preis, wird sehr gut angenommen von der Bevölkerung.
Simone Koren-Wallis:
Ich glaube es nicht, ist da jetzt tatsächlich ein Rollstuhl?
Dieter Kainz:
Ja.
Simone Koren-Wallis:
Nein, es sind mehrere.
Dieter Kainz:
Zum Beispiel der Rollstuhl ist gestern abgegeben worden bei uns, ist am Jakomini-Platz gefunden worden, ist natürlich auch angerufen worden, das ist ein Verleih, wird leider nicht abgeholt.
Simone Koren-Wallis:
Können wir mal da so eins reinschauen, in ein sonstiges.
Dieter Kainz:
Das ist aber die sonstigen Sachen, da haben wir sämtliche Sachen gelagert, was vom Sturzhelm angefangen, Körbe, Trinkflaschen, alles was relativ kleine Sachen sind.
Simone Koren-Wallis:
Sind da auch Zigaretten, ist das tatsächlich ein Zigarettenpackerl oder ist das jetzt eins von euch? Fundzigaretten? Fundzigaretten, es werden Zigaretten angegeben.
Dieter Kainz:
Das sind meistens Sachen, was in Straßen, beim Bus gefunden werden.
Simone Koren-Wallis:
Ich meine, jetzt sind das alles Sachen, haben vielleicht viele Leute auch gar nicht den Hintergedanken, hey, ich könnte ja ins Fundamt schauen zu euch.
Dieter Kainz:
Ja, es wird natürlich sehr viele Leute geben, die das eventuell nicht wissen, aber es gibt auch sehr viele Leute, die wahrscheinlich sagen, sie kommen wegen einer Trinkflasche nicht, wegen einer Kleinigkeit, dass die einfach die Mühe auf sich nehmen, dass sie zu uns kommen.
Simone Koren-Wallis:
Aber da ist eine Gitarre. Eine Gitarre, da liegt eine schöne Holzgitarre.
Dieter Kainz:
Ja, bei Musikinstrumente kann man nicht sagen, ob das ein Kind verloren hat oder vergessen hat, vielleicht hat es mit dem Spielen aufhören wollen...
Simone Koren-Wallis:
Morgen gehen wir spielen, Mama, ich habe meine Gitarre verloren. Wahnsinn. Was wird am meisten abgeholt? Also können Sie das irgendwie, wo ihr sagt, da ist die Rücklaufquote die höchste?
Peter Krusic:
Ja, es ist natürlich so, überall, dort, wo wir den Verlustträger ermitteln können, das ist jetzt ganz klassisch bei Geldtaschen, bei Ausweisdokumenten, wo es verloren wird, da können wir die Leute anschreiben, da haben wir auch die höchste Rücklaufquote, da haben wir rund 80 Prozent, wo wir wieder den Verlustträger übermitteln können. Das Wenigste haben wir natürlich dort, was Gewand betrifft, also wie gesagt, dort werden ungefähr nicht einmal 10 Prozent davon wieder abgeholt. Also wirklich, mein Appell, hat mir irgendwas, eine Jacke verloren, die Kinder, ihr Turnsackerl verloren, es zahlt sich aus, bei uns danach zu fragen.
Also wie gesagt, man muss das nicht immer neu kaufen, diese Dinge. Wir haben ja gerade ganz frisch die Statistik von 2023, also voriges Jahr sind insgesamt über alle Kategorien 14.324 Gegenstände abgegeben worden, und wenn du früher gefragt hast, wie viel wird da wieder abgeholt oder den Verlustträger übermittelt, das waren 4.729, also man sieht, das Allermeiste bleibt bei uns da liegen.
Simone Koren-Wallis:
Ein Drittel wird abgeholt, zwei Drittel bleiben da.
Peter Krusic:
Genau, richtig, ja.
Simone Koren-Wallis:
Peter, jetzt sind wir wieder am Anfang mit ganz vielen Stofftieren, meine Güte, aber es ist schon ein Mordsaufwand, oder?
Peter Krusic:
Ja, natürlich, wie gesagt, das ist aber auch unsere Aufgabe, dass wir sagen können, wenn jemand etwas verloren hat, hat er bei uns die Chance, das wiederzufinden, und darum mein Appell, sage ich auch an alle Kolleginnen und Kollegen, einfach das verbreiten, es zahlt sich immer aus, wenn man etwas verloren hat, im Fundamt nachzufragen, beziehungsweise man kann selbst eine Recherche machen unter fundamt.gv.at, wenn man etwas verloren hat, da kann man auch etwas finden, wenn man das im Urlaub irgendwo verloren hat, ist das dort genauso drinnen, und man kann solche Sachen wiederfinden.
Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge reden wir über das Superwahljahr 2024. Wir Steirerinnen und Steirer können ja heuer dreimal unsere Stimme abgeben. Wir hören uns, ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 35: Fakten über die Grazer "Liesl"
Die „Liesl" im Grazer Glockenturm läutet immer das neue Jahr ein. Aber mit wie vielen Schlägen? Und was hat eine Bassgeige mit dem Glockenturm zu tun? Er kennt den Schloßberg und alle seine Geschichten wie seine Westentasche: Josef Matzi. Mit ihm geht's zur drittgrößten Glocke der Steiermark und damit wünschen wir allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Liebe für 2024!
Intro/Simone Koren-Wallis:
Jetzt genießen wir noch die letzten Tage im alten Jahr. Deshalb gibt es jetzt von uns Fakten über die Liesl im Grazer Glockenturm, die ja bekanntlich das neue Jahr einläuten wird. Vielleicht können Sie mit diesen Infos zu Silvester ein bisschen prahlen. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Josef Matzi.
Josef Matzi:
Mein Name ist Josef Matzi. Ich bin in der Abteilung für Immobilien beschäftigt. Ich habe das Veranstaltungsreferat, also alle städtischen Park- und Grünanlagen und natürlich auch den Schlossberg, den schon etwas länger. Und mein Aufgabenbereich umfasst die Genehmigung von Veranstaltungen in städtischen Park- und Grünanlagen und auch den Schlossberg.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
So, jetzt ist es dann bald vorbei mit dem Jahr 2023. Das ist auch die letzte Podcast-Folge vom Stadt Graz Podcast in diesem Jahr. Und wo machen wir den? Natürlich dort, wo man wirklich an Silvester denken muss, nämlich bei der Liesl. Josef, erklär mal kurz, wo stehen wir gerade?
Josef Matzi:
Wir stehen genau vor der Liesl, vor dem Schlossbergplateau und vor dem 34 Meter hohen Turm in achteckiger Bauweise, der 1588 vom Erzherzorg Karl II. als Turm für die Thomaskapelle errichtet worden ist.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt stehen wir davor. Ich würde sagen, die Liesl machen wir zum krönenden Abschluss. Aber du kannst ja unten auch rein. Es ist unten eine große Tür. Wo geht es da hinein?
Josef Matzi:
Das ist die sogenannte Bassgeige. Wenn wir jetzt reingehen, sieht man es eh schnell. Und es ist eine Erklärung deswegen, dass diese Bassgeige so konzipiert worden ist. Die hat die gleiche Weite wie die Glocke. Die Glocke ist ja sehr, sehr schwer, machen wir nachher. Aber sie wurde mit dem Turm in die Höhe gebaut. Und deswegen hat sie die Form einer Bassgeige.
Simone Koren-Wallis:
Wie in die Höhe gebaut?
Josef Matzi:
Die Glocke hat 4632 Kilo und die wurde mit dem Turm in die Höhe gebaut. Die wurde nicht nachträglich hineingebracht, das war damals nicht möglich, sondern die wurde mit dem Turm Stück für Stück hinaufgebaut.
Simone Koren-Wallis:
Ja, dann machen wir mal auf. Ah, jetzt sehen wir aber schon, vom Grundriss her ist es eben diese Bassgeige.
Josef Matzi:
Richtig, genau. Und man sieht, da zwischendrin, zwischen den Pfeilern, hat genau die Glocke Platz gehabt und die wurde praktisch mit dem Turm mit hinaufgebaut. Die Bassgeige, das war früher das Gefängnis für die Schwerverbrecher. Es gibt da oben ein sogenanntes Angstloch. Das haben wir unten auch in der Stahlbastei gehabt. Und da sind die Gefangenen eigentlich von oben heruntergelassen worden. Und auch verpflegt. Wenn du da herinnen einmal warst, war es ziemlich das Ende dann.
Simone Koren-Wallis:
Bist du narrisch, da ist schon noch was Schirches im Alten.
Ich würde sagen, wir schauen in den Turm.
Josef Matzi:
Machen wir.
Simone Koren-Wallis:
Machen wir das Schönere.
Wo wir da jetzt reingehen, ist das eigentlich öffentlich zugänglich?
Josef Matzi:
Ja, im Zuge von Führungen. Im Zuge von Führungen, die Graz-Guide machen das. Die führen hinauf bis in die Glockenstube. Und was eine Besonderheit da ist beim Glockenturm, es war früher das Stadtmuseum drinnen. Wird aber schon lange nicht mehr genützt. Und wir vergeben das jetzt auch für Ausstellungen.
Simone Koren-Wallis:
Wie weit müssen wir hinauf, wie viele Stufen sind es?
Josef Matzi:
Also die Stufen weiß ich nicht, aber wir haben drei, vier Stockwerke. Vier Stockwerke bis in die Glockenstube.
Simone Koren-Wallis:
Du weißt ja immer irgendwie alles von den Zahlen her. Du weißt sicher die Stufen auch.
Josef Matzi:
Wir sind im ersten Obergeschoss. Und der Glockenturm wurde auch als Gefängnis. Und da waren halt die Besseren wiederum untergebracht. Also nicht in der Bassgeige die...
Simone Koren-Wallis:
Die Schwerverbrecher?
Josef Matzi:
Richtig, ja gut, das waren vielleicht da auch Schwerverbrecher, aber die waren besser gestellt.
Simone Koren-Wallis:
Die waren besser betucht damals.
Josef Matzi:
Betucht, genau.
Simone Koren-Wallis:
So, das ist jetzt die Tür. Da kommt man wirklich nur rauf im Zuge einer Führung.
Josef Matzi:
In der Führung, genau. Das ist die Glockenstube. Da gehen wir jetzt zum Herzstück des Turmes.
Simone Koren-Wallis:
Ah, da ist sie, die Liesl. Die ist so mächtig.
Josef Matzi:
Ja, das ist die drittgrößte Glocke der Steiermark. Sie hat einen Durchmesser von 1,97 und eben wie gesagt 4.632 Kilo. Sie schlägt dreimal am Tag. Um sieben, zwölf und neunzehn Uhr.
Simone Koren-Wallis:
Ballert's dir da eigentlich auch die Ohren weg? Also ist das dann so laut, dass man sagt, man haltet's gar nicht raus herum?
Josef Matzi:
Das ist laut. Aber sie hat wirklich einen wunderbaren Klang und sie schlägt eh 101 Mal.
Simone Koren-Wallis:
Warum 101?
Josef Matzi:
Ja, das ist eine Überlieferung. Das wird aber nicht wirklich stimmen. Sie sagen, dass diese Glocke aus 101 türkischen Kanonen gegossen worden ist. Wird aber nicht so sein, sondern eher, dass wenn damals ein Thronfolger zur Welt gekommen ist, hat es 101 Salutschüsse gegeben. Und eher das wird der Grund sein, dass sie 101 Mal schlägt.
Simone Koren-Wallis:
Und damit man sich das vorstellen kann, für alle, die noch nie herinnen waren, es ist ja alles voller Holz. Und das Holz schaut schon relativ alt aus.
Josef Matzi:
Das wurde im Zuge des Turmbaus natürlich miterrichtet. Das ist das Stützgestell oder die Aufhängung der Glocke. Und bewegt sich. Also wenn die Glocke schwingt, dann ist Leben in dem Holz drinnen. Das ist wirklich so. Das geht ein bisschen mit. Das bewegt sich.
Simone Koren-Wallis:
Aber richtige, gute Maßarbeit von früher. Das kann man nicht hinmachen.
Josef Matzi:
Genau. Also das einzige Feuer ist gefährlich.
Simone Koren-Wallis:
Ja, natürlich. Holz.
Josef Matzi:
Und Nässe. Aber da passen wir schon auf, dass der Turm immer dicht ist.
Simone Koren-Wallis:
Man hat links und rechts eigentlich auch schöne Fenster hinaus. Was ist da heroben dann wirklich passiert? Wann hat die Glocke damals geschlagen? Heuer schlägt sie immer um sieben, zwölf und neunzehn Uhr. Natürlich auch zu Mitternacht.
Josef Matzi:
Zu Mitternacht, nur zu Silvester. Ja, genau. Weil das geht ja nicht. Die Leute wollen ja schlafen zu den normalen Nachtstunden.
Simone Koren-Wallis:
Nein, ich wollte ja sagen, zu Silvester. Sie läutert das neue Jahr ein.
Josef Matzi:
Genau, sie läutert das neue Jahr ein. Ja, richtig. Bis 1938. Ab dem Zeitpunkt wird sie elektrisch betrieben.
Es ist eine ganz interessante Inschrift oben drinnen. Die wurde 1995, 1996 im Zuge der Gesamtsanierung des Glockenturms einmal übersetzt. Ich habe es noch nicht auswendig lernen können, aber ich hätte diese Inschrift da, wenn ich es vorlesen soll. „Glocke, man nennet mich. Eitles nie künde ich. Töne bei Freudengebrängen. Töne bei Leichengesängen. Und in des Sturmes Pracht zeigt sich erst meine Macht. Wohl ruf ich andere zu des Glaubens heile. Mir selbst, aber bleibt die alte Stelle." Das ist diese, oben im oberen Bereich sieht man dann diese Inschrift. Das ist die Übersetzung dazu.
Simone Koren-Wallis:
Todesgeläute? Ist sie früher geschlagen worden, wenn wer gestorben ist?
Josef Matzi:
Auch zum Beispiel bei großen Begräbnissen von wichtigen Personen. Auch wenn ein Unwetter gekommen ist, steht sie in der Überlieferung drinnen. Bei Gefahr wurde sie auch geläutet. Das waren früher die einzigen Möglichkeiten, die Leute auf irgendetwas aufmerksam zu machen.
Simone Koren-Wallis:
Wenn wir uns jetzt die Glocke von unten anschauen. Man sieht genau, wo der Klöppel anschlägt.
Josef Matzi:
Anschlägt, genau. Und man sieht, dass er seitlich schon Anschläge oder sich dort schon angeschlagen hat. Sie hat einen Cis-Klang und um den zu erhalten, muss man die Glocke alle 100 Jahre drehen. Das heißt, der Fachbegriff ist, sie wird neu behelmt. Man dreht sie dann weiter, damit sie den Cis-Klang behält.
Simone Koren-Wallis:
Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor.
Josef Matzi:
Das ist auch sehr aufwendig. 1983 wurde sie das letzte Mal neu behelmt und zum dritten Mal überhängt. Wir haben ja schöne Tafeln da stehen. Ja, das ist viel Arbeit.
Simone Koren-Wallis:
Wenn man jetzt raufkommt über die Stiege und dann gleich links, steht eben, das ist ein alter Klöppel, oder?
Josef Matzi:
Ein alter Klöppel, genau. Das ist der ursprüngliche Klöppel der Glocke. Und der ist gebrochen.
Simone Koren-Wallis:
Wie?
Josef Matzi:
Gott sei Dank nicht während dem Läuten, weil das wäre dann relativ schlimm ausgegangen. Sondern die Glocke hat keinen Laut mehr von sich gegeben.
Und wie wir nachgeschaut haben, ist der untere Teil des Klöppels am Holzboden gelegen. Also der ist abgebrochen.
Simone Koren-Wallis:
Wann war das?
Josef Matzi:
Das ist jetzt sieben, acht Jahre her. Und dann wurde eben jetzt ein neuer, ein Edelstahl-Klöppel in Deutschland gefertigt und eingebaut. Und den alten haben wir noch da stehen, als, wie sagt man so schön, Andenken, Besichtigung.
Simone Koren-Wallis:
Stell dir vor, der wäre abgebrochen, wenn er schwingt, oder?
Josef Matzi:
Also der untere Teil, den sieht man eh, der hat circa 70 Zentimeter Höhe. Wenn der wirklich während dem Schwingen oder während dem Schlagen abbricht, fliegt er wirklich durchs Fenster raus.
Simone Koren-Wallis:
Was hat das für ein Gewicht, so ein Klöppel?
Josef Matzi:
Keine Ahnung, wirklich nicht, weiß ich nicht. Aber wird auch...
Simone Koren-Wallis:
...schwer sein.
Josef Matzi:
600, 700 Kilo wird er schon haben, schätze ich.
Simone Koren-Wallis:
Warum eigentlich Liesl?
Josef Matzi:
Das ist im Volksmund so überliefert, weil es jetzt der heilige Elisabeth eigentlich geweiht ist. Und deswegen sagen sie Liesl dazu.
Das ist genauso wie der Turm auch Liesl genannt wird.
Simone Koren-Wallis:
Man macht es schon immer so.
Josef Matzi:
Man macht es schon immer so, genau, ja.
Simone Koren-Wallis:
So, wir haben jetzt ein Fenster aufgemacht. Man sieht traumhaft über Graz. Und da unten sieht man so alte Gemäuer.
Was ist das, Josef?
Josef Matzi:
Das sind die Grundmauern der Thomas-Kapelle. Da ist eine Kapelle gestanden. Und für diese Kapelle wurde ja dieser Turm errichtet. Leider Gottes sind nur noch die Grundmauern übrig geblieben.
Simone Koren-Wallis:
Weil?
Josef Matzi:
Sie wurde 1809 im Zuge der Franzosenkriege, bis dorthin ist sie gestanden. Dann wurde sie des Daches beraubt und dann dem Verfall preisgegeben.
Simone Koren-Wallis:
Nun ein paar Tage bis Silvester. Und dann, wenn zu Mitternacht das Schwingen anfängt. Muss das eigentlich schon vorher passieren oder ist das wirklich um Mitternacht?
Josef Matzi:
Ja, das passiert zwei, drei Minuten vorher. Weil die Glocke mit so einem Elektromotor ins Schwingen gebracht wird. Mit einer riesigen Übersetzung. Wenn sie dann die richtige Höhe erreicht hat. Der Klöppel ist ja fixiert an der Glocke. Da gibt es zwei Halterungen. Und wenn sie dann die richtige Höhe erreicht hat, macht diese Fixierung auf. Und der Klöppel fährt in die Glocke rein. Und nach 101 Schlägen wird er dann wieder von dieser Fixierung gefangen. Und sie pendelt praktisch ganz gemütlich aus.
Simone Koren-Wallis:
Ja, dann würde ich sagen, wir machen schon eine kleine Vorschau für Mitternacht. Und wir hören rein, wie sie klingt. Und damit alles Gute für die letzten Tage im Altenjahr. Und natürlich alles, alles Liebe für 2024 von der Stadt Graz.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 34: Pflegeeltern gesucht - Teil 2
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Adoption und Pflege? Welche Unterstützungen bekommt man und wie oft kommt es vor, dass das Pflegekind wieder zu den leiblichen Eltern zurückkommt? Gerlinde Sternad, Leiterin des Pflegekinderdienstes der Stadt Graz, und Pflegemama Ulli Krapinger mit dem 2. Teil zum Thema "Pflegeeltern in Graz gesucht".
Intro/Simone Koren-Wallis:
Das ist Teil 2 von Pflegeeltern gesucht. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Adoption und Pflegeelternschaft? Und wie oft kommt es vor, dass das Kind wieder zu den leiblichen Eltern zurückkommt? Ich bin Simone Koren-Wallis, meine Gäste gelinde Sternad, Leiterin des Pflegekinderdienstes der Stadt Graz und Pflegemama Ulli Krapinger.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Wir haben in der ersten Folge schon viel gehört. Wie funktioniert das eigentlich, wie kann man Pflegefamilie werden, wie viele Pflegekinder gibt es und so weiter. Und wir haben von einer Pflegemama auch gehört, wie sie überhaupt zu ihrem, wie hast du vorher gesagt, zum Babyboy gekommen ist. Ihr habt dann den Anruf bekommen, das ist ein Bub, und das war dann von heute auf morgen warst du Doppelmama.
Ulli Krapinger:
Eigentlich schon, ja. Wie dann der Anruf kam, das Baby ist da, da war natürlich, ja, da war helle Aufregung allseits. Und das war schon eine sehr, sehr spannende und sehr schöne Zeit auch. Wir konnten damals leider nicht ins Krankenhaus gehen in der ersten Woche. Und wir haben ihn dann erst beim Abholen gesehen. Und das war dann irgendwie auch so eine seltsame Situation, weil man weiß, man geht da jetzt ins Krankenhaus und sieht da das erste Mal ein Baby und das ist dann deins. Und das war aber auch irgendwie so, als ob es hätte passen müssen. Wir sind da reingegangen und der hat uns gefühlt angelächelt, obwohl er erst sieben Tage alt war. Also wir haben ihn in den Arm genommen und das hat gepasst.
Simone Koren-Wallis:
Wie ist es dann der großen Schwester gegangen, eurer Lotti, die ja dann auf einmal große Schwester war von heute auf morgen?
Ulli Krapinger:
Ja, also die hat das erstaunlich gut eigentlich aufgenommen, weil sie hat ja noch weniger Zeit gehabt, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, weil wir haben ja erst, ich glaube, zwei Wochen vorher, nachdem wir das Detailgespräch dann gehabt haben, gesagt, dass wir das jetzt wirklich machen. Sie hat wohl gewusst, dass es ein Geschwisterchen geben wird, aber ja, das ist halt sehr unkonkret, wenn man so gar nichts hat, wo man sie anhalten kann. Sie ist dort auch mit reingegangen und hat den angeschaut und gesagt, das ist mein Bruder. Also die war sehr, sehr, sehr, also damals war sie sechs ein Viertel und die war begeistert.
Simone Koren-Wallis:
Und noch immer.
Ulli Krapinger:
Und ist noch immer. Fast ein bisschen zu viel, weil sie will den ganzen Tag knuddeln und er macht das halt nicht so ganz gern. Manchmal macht er es, manchmal nicht und sie wird halt so viel gern mit ihm kuscheln.
Simone Koren-Wallis:
Wie reagiert da das Umfeld? Also Nachbarn, Familie, Freunde, wie ihr denen dann auch gesagt habt, hey, wir nehmen ein Pflegekind auf.
Ulli Krapinger:
Wir haben eigentlich, egal wen wir das gesagt haben oder wer irgendwie das mitgekriegt hat, höchste Hochachtung zugesprochen bekommen, witzigerweise. Also die Leute waren alle so erstaunt, dass man sich das antut, unter Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist eben auch das Thema, dass das noch ein bisschen negativ besetzt ist, das Thema Pflegefamilie, weil man das von früher her noch kennt, dass das schwierige Kinder sind und schwierige Verhältnisse und alles so kompliziert und mit Amt und viele Termine und alles kompliziert. Und die haben dann alle gesagt, Hut ab, dass ihr das macht. Wir haben das aber eigentlich gar nicht so empfunden, also wie wir das angegangen sind, weil das für uns auch so eine schöne Erfahrung ist, dass wir dem Kind ein Zuhause geben können. Also wir haben jetzt nicht gesagt, oh, da tun wir uns jetzt was an, sondern das war jetzt eigentlich voll super, wir kriegen da jetzt noch so ein kleines Kind dazu und wir können dem eine Zukunft geben, die es sonst nicht gehabt hätte. Manche haben sogar gesagt, ja, ich habe sie eh noch gesehen mit dem großen Bauch. Ich habe gesagt, nein, sicher nicht. Das ist mir auch passiert.
Simone Koren-Wallis:
Ist das Amt kompliziert?
Gerline Sternad:
Ich hoffe nicht. Wir versuchen einfach Pflegefamilien so gut, wie es uns gelingen mag, zu begleiten, zu beraten. Ich glaube, wir sind mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt. Ich kann dazu sagen, den Pflegekinderdienst gibt es tatsächlich auch erst seit vier Jahren. Und ich glaube nicht, dass wir wahnsinnig kompliziert sind.
Simone Koren-Wallis:
Oder?
Ulli Krapinger:
Nein.
Gerline Sternad:
Danke.
Ulli Krapinger:
Also ich kann natürlich nur von Graz reden. Ich kenne die anderen Situationen nicht, aber wir haben wirklich nur sehr, sehr gute Erfahrungen. Also es sind alle super nett gewesen. Wenn man eine Frage oder irgendein Anliegen hat, das wird wirklich aufgenommen und beantwortet. Also wirklich total gut. Also ich habe Kinderbetreuungsgeld bekommen. Man kriegt Familienbeihilfe. Die finanzielle Abgeltung, wenn man das so will, man überlegt es. Das geht schon. Es ist beim eigenen Kind ja auch so. Wenn man aus dem Beruf rausgeht, ist man auch finanziell momentan ein bisschen schlechter gestellt. Unser Fabian, der ist einfach total gut entwickelt und ein ganz normales, kleines Baby. Aber es gibt natürlich andere Fälle, wo es halt wirklich komplizierter wird und wo es auch finanziell ein bisschen ein anderes Thema ist.
Gerline Sternad:
Also da reden wir dann von einfach Bedarf an Therapien. Logopädie, Ergotherapien, unterschiedliche Psychotherapien, psychologische Behandlungen. Wobei wir aber auch sehr unterstützend sind, denke ich, weil wir einfach erstens die Möglichkeit haben, diese Therapien auch zu vermitteln. Das heißt, wir können einfach zu unterschiedlichen Fachkräften Therapien vermitteln und natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten aufzustocken und einfach zu schauen, dass wir diese Therapien auch finanzieren. Und das passiert auch sehr häufig. Und wir versuchen auch, die Pflegekinder möglichst in ihren kreativen und sonstigen Talenten zu fördern. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit von Unterstützung beim Lernen von Musikinstrumenten. Wir haben unterschiedlichste Dinge schon gehabt, vom Trampolinspringen über einen Ferienkurs, über Malkurse. Also unterschiedlichster Natur sind da die Unterstützungsmöglichkeiten, je nach Interessen und Talenten des Kindes. Und da sind wir, glaube ich, auch sehr kulant in dem, dass wir sagen, wenn es dem Kind irgendwie Unterstützung ist, dann schauen wir, dass wir da auf jeden Fall auch hilfreich sind.
Simone Koren-Wallis:
Wie oft kommt es vor, dass die Originalfamilie sagt, nein, wir hätten unser Kind gern zurück?
Gerline Sternad:
Das kommt tatsächlich sehr, sehr oft vor, weil das ist, glaube ich, einfach das, was eine Mama und Papa ausmacht. Das ist einfach sehr schwierig zu sagen, okay, da gibt es jetzt eine andere Familie, die mein Kind auch betreut oder vielleicht besser betreut. Tatsächlich kommt es aber selten vor, dass die Kinder dann wieder zurückkommen. Also es werden Anträge gestellt, das muss man klar sagen. Das ist ja, glaube ich, für die Pflegefamilien eine ganz schwierige Zeit, weil so immer die Frage ist, wie geht dieser Antrag aus. Ich kann es jetzt nicht konkret in Zahlen sagen, weil das wird wahrscheinlich nicht hundertprozentig stimmen, aber ich glaube, ausgehend tun wir momentan von zwei Prozent Rückführungen. Und das sind von 100 Kindern zwei und ich denke, das ist überschaubar.
Simone Koren-Wallis:
Habt ihr Kontakt mit den leiblichen Eltern?
Ulli Krapinger:
Momentan nicht, nein. Die Mutter hat den Kontakt vor einem Jahr circa abgebrochen.
Simone Koren-Wallis:
Aber davor war der Kontakt da?
Ulli Krapinger:
Ja, genau. Also von Geburt weg, also quasi von dem Tag, wo wir den Fabian übernommen haben, ist festgelegt worden, dass es 14-tägige Kontakte gibt. Die sind auch begleitet, die Kontakte. Das heißt, da war immer jemand dabei, der geschaut hat, dass das alles passt. Die sind mehr oder weniger eingehalten worden von der Mama und sie hat dann einen Antrag auf Rückführung gestellt, der dann nicht zu ihren Gunsten ausgegangen ist und daraufhin hat sie den Kontakt abgebrochen.
Simone Koren-Wallis:
Aber wenn der Fabian jetzt irgendwann einmal sagen wird, in weiß nicht wie vielen Jahren, ich möchte meine leibliche Mama kennenlernen, also diese Chance besteht eigentlich immer, wenn es die Mama halt will.
Ulli Krapinger:
Wenn es die Mama will, ja. Und das ist ja auch das Modell der Pflegefamilien grundsätzlich, dass der Kontakt zu den leiblichen Familien erhalten bleibt. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zur Adoption.
Weil da ist einfach, wenn adoptiert ist, dann ist der Kontakt zur leiblichen Familie eigentlich, glaube ich, meistens unterbrochen, ohne dass ich das genau weiß.
Gerline Sternad:
Es gibt auch Möglichkeiten einer offenen Adoption mittlerweile, wo man, glaube ich, einmal im Jahr Kontakt halten kann. Aber grundsätzlich, genau, das ist, so wie Sie sagen, einfach der größte Unterschied zur Adoption, dass es die Möglichkeit gibt, zu den Kindern weiter Kontakt zu halten. Und nicht nur die Möglichkeit, sondern auch den Rechtsanspruch darauf. Also Kontaktrecht ist der erste Rechtsanspruch vom leiblichen Eltern, der natürlich erhalten bleibt. Da wird aber sehr genau darauf geschaut, was dem Kind gut tut, wie das Kind auch auf die Kontakte reagiert. Also die Kontakte sind nicht in Stein gemeißelt, nur weil sie jetzt, ich weiß nicht, alle drei Wochen stattfinden, heißt das nicht, dass es fünf Jahre lang so bleibt. Da muss man einfach gut schauen, wie geht es den Kindern damit. Und ich denke, dass es auch uns Blick auf das.
Das ist das eine, was von einer Adoption vielleicht noch unterscheidet. Das andere ist natürlich, dass sämtliche Rechte bei einer Adoption auf die Adoptivwerber oder dann die Adoptiveltern übergehen. Das ist bei der Pflegeelternschaft tatsächlich nicht der Fall. Das ist so, dass die Obsorge beim Kinder- und Jugendhilfeträger bleibt und von uns der Teilbereich der Obsorge der Pflege und Erziehung auf die Pflegepersonen übergeht und sie deswegen alles, was jetzt eben diesen Teilbereich betrifft, auch ausüben können. Tatsächlich bleibt die Obsorge das Sorgerecht beim Kinder- und Jugendhilfeträger.
Simone Koren-Wallis:
Ist aber eine Adoption dann möglich irgendwann nochmal?
Gerline Sternad:
Eher nein. Es braucht für eine Adoption immer die Zustimmung von den leiblichen Eltern und die wird ganz oft nicht kommen. Und wir sind ganz klar in dem, dass wir immer kommunizieren, ein Pflegekind ist kein Adoptivkind. Das ist wirklich eine ganz andere Situation, die da dahintersteht, weil es einfach weiter das Kontaktrecht gibt, weil es auch uns in dem System weitergibt. Also das Amt und auch die Kolleginnen von der Familienbegleitung bleiben erhalten. Das ist eine ganz eigene Form der sozialen Elternschaft, weil wir halt auch regelmäßig kommen, weil wir einen Kontrollauftrag haben. Passt alles am Pflegeplatz? Geht es dem Kind gut? Beim Adoptivkind, das ist in einer Familie, das bleibt dort und das sieht von uns grundsätzlich niemand mehr, sofern es nicht irgendwelche Probleme gibt bzw. Unterstützungsbedarf in den Adoptiveltern. Bei den Pflegekindern ist das deutlich anders und da kommt einfach auch ein ganzes System mit und ich glaube, dessen muss man sich schon bewusst sein.
Ulli Krapinger:
Wobei das System sehr nett ist.
Gerline Sternad:
Es ist wirklich sehr nett. Es schränkt auch im Alltag in keinster Weise ein. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Themenbereiche, wo man die Zustimmung dann braucht. Ich glaube, das ist ein Namensänderungswert, das Religionsbekenntnis, also Taufe. Aber ansonsten in der Pflege und Erziehung ist man eigentlich völlig frei. Also man kann frei entscheiden, welchen Kindergarten, welche Schule. Aber im Alltag spielt das eigentlich nicht wirklich eine Rolle, dass man nicht die volle Obsorge hat.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, ihr habt das auch noch keine Sekunde bereut?
Ulli Krapinger:
Nein. Im Gegenteil, nein.
Simone Koren-Wallis:
Wie lange dauert es zum Beispiel, dass man ein Pflegekind kriegt? Wie schnell würde eine Adoption bei uns in Graz funktionieren?
Gerline Sternad:
Also Pflegekinder, das kann manchmal sehr, sehr schnell gehen. Von Wochen über bestenfalls Monate. Also dass man ein Jahr wartet, kommt eher selten vor. Bei der Adoption hingegen haben wir momentan in Graz eine Warteliste von acht Jahren.
Simone Koren-Wallis:
Also deswegen, Pflegeeltern, meldet euch.
Jetzt sind wir mittendrin im Advent. Und jetzt haben wir allein in diesen zwei Folgen jetzt schon so viel Schönes gehört. Was wünscht ihr euch für die Kinder? Wunsch ans Christkind quasi. Gelinde, vom Amt aus, was wünschst du dir?
Gerline Sternad:
Dass es sehr viele Kinder gibt, die einfach gute Plätze finden, an denen sie gut aufwachsen können, wo sie liebevoll betreut werden. Und dass wir vielleicht ein bisschen einen Spark, ein kleines Sternchen halt da versuchen nach draußen zu bringen, dass vielleicht ein paar Leute sich überlegen, in Richtung Pflegeelternschaft nachzudenken.
Simone Koren-Wallis:
Was wünschst du dir für, vielleicht auch für den Fabian und eure Familie?
Ulli Krapinger:
Für unsere Familie wünsche ich mir, dass es so gut weitergeht, wie es bis jetzt gelaufen ist, weil es einfach wunderbar funktioniert und wir einen wunderbaren Pflegesohn haben. Außerdem wünsche ich mir, dass es so viele Pflegefamilien geben wird in den nächsten Jahren, dass es ganz normal ist, in einer Pflegefamilie aufzuwachsen und dass ich da kein Kind Sorgen machen muss, dass es da jetzt irgendwie in einer fremden Familie wäre.
Gerline Sternad:
Ja, dem darf ich beipflichten, weil es glaube ich vielleicht auch gesellschaftlich einen Unterschied macht, dass wenn es mehr Pflegeeltern gibt, wenn es mehr Pflegefamilien gibt, wo einfach Kinder mit zwei Familien aufwachsen dürfen, wäre das für uns auch etwas, wo wir uns sehr freuen würden.
Simone Koren-Wallis:
Wenn ihr euch noch ein bisschen ins Thema einlesen möchtet, sehr, sehr gern unter graz.at/Pflegeeltern. In der nächsten Folge nehme ich euch wieder mal mit und zwar in die Liesl auf dem Schlossberg, passend zu Silvester.
Wir hören uns, ich freue mich und wünsche allen einen schönen Advent.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 33: Pflegeeltern gesucht - Teil 1
Es kann sein, dass diese Podcastfolgen Ihr Leben verändern werden. Im positiven Sinn. Denn vielleicht entscheidet sich ja jemand, ein Pflegekind aufzunehmen. Gerlinde Sternad ist Leiterin des Pflegekinderdienstes der Stadt Graz und hat alle Infos dazu. Ulli Krapinger ist Pflegemama und erzählt aus ihrem Leben. Alle Infos finden Sie außerdem HIER!
Intro/Simone Koren-Wallis:
Jetzt kommen zwei Podcast-Folgen, die zum Nachdenken anregen sollen. Und wer weiß, vielleicht verändern sie sogar euer Leben. Und zwar im positiven Sinn. Es geht nämlich um die Pflegeelternschaft. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste Gerlinde Sternhardt und Ulli Krapinger.
Gerlinde Sternad:
Ich bin die Gerlinde Sternhardt. Ich bin die Leitung vom Pflegekinderdienst der Stadt Graz. Und freue mich, euch heute ein bisschen was über Pflegeeltern und Pflegekinder erzählen zu dürfen.
Ulli Krapinger:
Hallo, mein Name ist Ulli Krapinger. Ich bin Pflegemama eines 21 Monate alten Sohnes. Und ich freue mich, dass ich ein bisschen was vom Alltag eines Pflegekindes erzählen darf.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Ich bin selbst Mama einer aktuellen Sechsjährigen. Das heißt, ich weiß, was es bedeutet, Mama zu sein. Pflegemama oder Pflegepapa zu sein, ist noch einmal ganz was anderes. Gerlinde, bitte kannst du uns mal erzählen, wie wird man in Graz Pflegemama, Pflegepapa?
Gerlinde Sternad:
Also idealerweise nimmt man mal Kontakt zu uns auf. Da gibt es dann ein Erstgespräch, wo man mal ein bisschen abklopft, was ist so die Idee dahinter, was sind die Beweggründe. Nach diesem Erstgespräch geht es dann eigentlich schon relativ zackig weiter. Es gibt bei Affido, das ist ein privater Träger, der mit uns gemeinsam arbeitet an der Eignungsfeststellung, die ersten vier Wochenenden, wo man einen Kurs macht. Das heißt bei uns ein bisschen sperrig, Qualifizierungsmaßnahme. Und diesen Kurs, den versuchen wir gepaart mit Hausbesuchen zu machen. Das heißt, unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gemeinsam mit Kolleginnen von Affido besuchen dann die Pflegeeltern, Werberinnen zu Hause zu vier Terminen. Da kommt dann beim letzten Termin meistens auch noch eine Psychologin mit. Also es ist eine sehr umfassende Eignungsfeststellung und nach der gibt es quasi ein Okay. Und dann geht es eigentlich auch schon los mit der Suche nach dem geeigneten Pflegekind für die Pflegefamilie.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Pflegefamilien gibt es da aktuell in Graz?
Gerlinde Sternad:
Momentan sind wir ungefähr bei 130 und wir betreuen in Summe 300 Grazer Pflegekinder.
Simone Koren-Wallis:
Werden aber dringend Pflegeeltern gesucht?
Gerlinde Sternad:
Ja, wir brauchen immer Pflegeeltern, ganz, ganz dringend für alle möglichen Altersgruppen. Ich muss dazu sagen, es ist sehr, sehr leicht, oder leichter, muss man mittlerweile auch schon sagen, für sehr kleine Kinder was zu finden. Also ganz oft gibt es den Wunsch nach Babys, nach Säuglingen, alles unter einem Jahr. Für die Kinder, die dann schon zwei oder drei sind, wird es einfach zunehmend schwieriger. Und deswegen brauchen wir einfach immer wieder Personen, die sich das vorstellen können, die sich vorstellen können, ein Kind in ihrem Leben zu betreuen, aufzunehmen, zu umsorgen. Und wir freuen uns natürlich über jede Anfrage, die da kommt.
Simone Koren-Wallis:
Was war bei dir der Beweggrund, dass du gesagt hast, oder ihr als Familie gesagt habt, hey, ich möchte ein Pflegekind aufnehmen?
Ulli Krapinger:
Also bei uns war das so, wir sind ein sehr kinderliebes Paar. Und wir haben eine wundervolle, große, leibliche Tochter. Und wir haben uns dann eigentlich gedacht, wir wollen noch ein Geschwisterchen. Das hat so nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und haben dann über einen Artikel in einer kleinen Zeitung gelesen, dass Pflegeeltern gesucht werden. Und haben uns dann eigentlich aufgrund dessen mit diesem Thema mal auseinandergesetzt. Und haben dann beschlossen, wir schauen uns das einmal an. Und haben dann eben Kontakt aufgenommen. Und haben uns das einmal erzählen lassen, wie das funktioniert. Und wir haben uns das dann sehr gut vorstellen können, dass das für uns passen könnte. Und so sind wir dann hineingekommen in das Thema.
Simone Koren-Wallis:
Hineingerutscht quasi.
Ulli Krapinger:
Eigentlich ein bisschen hineingerutscht, ja.
Simone Koren-Wallis:
Wie ich schon mit Bekannten gesprochen habe, dass ich diese Folge aufnehme, habe ich mir wirklich ansehen können, naja, aber das machen ja Leute nur wegen dem Geld. Und außerdem sind das nur schwierige Kinder.
Ulli Krapinger:
Also zur finanziellen Komponente kann ich sagen, man wird sicher nicht reich davon. Es gibt aber einige finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten. Es gibt unterschiedliche Anstellungsvarianten. Also wer sich dazu informieren möchte, bitte einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Das würde nämlich die Zeit eines Podcasts sprengen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich karenzieren zu lassen. Es gibt die Möglichkeit, Familienbeihilfe zu beziehen. Also alles das, was man mit einem leiblichen Kind auch zustehen würde, bekomme ich auch als Pflegemama, Pflegepapa. Aber ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die das tatsächlich wegen dem Geld machen. Zu den Kindern vielleicht auch. Da muss man wirklich klar sagen, es gibt natürlich auch Pflegekinder, die mit einem großen Rucksack daherkommen. Das sind traumatisierte Kinder, die haben einfach ganz oft sehr schwierige Erfahrungen gemacht. Das hat Vernachlässigung gegeben vielleicht. Das hat Gewalterfahrungen gegeben. Also ich würde jetzt ein bisschen davon Abstand nehmen, das nur schön zu malen. Es kann natürlich sein, dass Kinder einfach schwierige Situationen durchlebt haben und dann einfach auch ein Packerl mithaben. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die absolut wie bei jedem anderen Kind funktionieren. Also Kinder, die nicht gleich einschlafen wollen, die einfach viel Zuwendung brauchen. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen darauf einlassen, wenn man im Vorfeld nicht so genau weiß, was man kriegt. Aber das weiß man beim leiblichen Kind auch nicht.
Simone Koren-Wallis:
Das stimmt. Meine schläft auch nicht ein. Aber ich finde es trotzdem, vielleicht ist es auch als Mama, dass sie da richtig sentimental wird, wenn man halt hört, dass es da so viele Kinder gibt, die halt wirklich eine neue Familie brauchen, weil sie in der alten nicht geklappt hat. Was gibt es dafür Gründe, dass man sagt, das Kind wird zum Pflegekind?
Gerlinde Sternad:
Also vielleicht fange ich nochmal kurz mit der Unterscheidung an. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Pflegefamilien. Und das heißt, es gibt Krisenpflegefamilien. Da kommt ein Kind hin, wenn es einfach eine akute Krisensituation gibt. Das heißt, es gibt eine akute Gefährdung, aus der ein Kind sofort in einer Krisenpflegefamilie untergebracht werden muss. Das schaut dann so aus, dass das Kind dort einmal zumindest drei Monate bleiben kann. Und in der Zeit gibt es eine Perspektivenklärung. Das heißt, man schaut einfach, gibt es die Möglichkeit, dass das Kind in die Familie zurückkann? Oder gibt es diese Möglichkeit nicht? Und erst wenn das wirklich ausgeschlossen werden kann, weil es einfach bei den leiblichen Eltern so viele Schwierigkeiten gibt, dass man sagt, das kann man nicht vertreten, dass das Kind dort weiter aufwächst, gibt es dann die Möglichkeit, dass man das Kind auf einem Dauerpflegeplatz unterbringt. Und was ist da im Vorfeld vorgefallen? Also unterschiedlichste Situationen. Hauptsächlich Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung.
Also die Sachen, die man einfach klassisch kennt aus Gefährdungssituationen, die am Kind zustoßen können. Es wird tatsächlich, und das sage ich vielleicht auch dazu, von Seiten des Amtes für Jugend und Familie im Vorfeld alles versucht, dass Kinder in ihren Familien bleiben. Da haben wir einfach auch die rechtliche Verpflichtung dafür zu sorgen, alles andere auszuschöpfen. Und das ist wirklich das letzte Mittel. Und zu dem Zeitpunkt ist dann wirklich klar, dass es eher kein Zurückgeben kann. Leibliche Eltern können aber jederzeit einen Antrag stellen. Und das ist das, was vielleicht auch viele Personen abschreckt, weil sie immer die Sorge im Hintergrund haben, es kann ja sein, dass unser Kind, zu dem Zeitpunkt ist es dann ja wirklich schon in die Familie hineingewachsen und integriert, dass das wieder zurück muss zu den leiblichen Eltern. Und da gibt es, glaube ich, auch ganz viel Sorge, wie es bezüglich einer Rückführung dann ausschaut. Aber die Möglichkeit, das leibliche Eltern diesen Antrag zu stellen, habe ich tatsächlich immer.
Simone Koren-Wallis:
Ihr habt aber als Familie gesagt, okay, diese Sorgen, das nehmen wir alles in Kauf. Wir wollen ein Pflegekind. Kannst du uns kurz den Ablauf ein bisschen erklären? Wie war das? Wie alt ist er jetzt?
Ulli Krapinger:
Der Fabian ist jetzt 21 Monate. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir ein ganz kleines Baby bekommen haben. Wir haben ihn aus dem Krankenhaus abholen dürfen. Und für uns war das ein Geschenk, dass wir so einen kleinen, entzückenden Buben bekommen durften. Wir sind gerade in diese Corona-Zeit gefallen, wie wir die Qualifizierungsmaßnahmen gemacht haben. Also wir haben das alles online gemacht. Normalerweise, glaube ich, läuft das in Präsenz. Das waren, ich glaube, vier Wochenenden, Online-Vorträge, Gespräche und so weiter. Und es hat ein paar Hausbesuche gegeben. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie viele. Und man wird einfach schon darauf vorbereitet, dass es auch schwierige Situationen geben kann. Also man wird wirklich umfassend informiert, in welche Richtung das gehen kann mit den Pflegekindern. Also es werden die Situationen beschrieben, woher die Kinder kommen. Es werden die Situationen beschrieben, was passieren kann, währenddessen die Kinder dann bei den Dauerpflegefamilien sind. Also dass eben auch Rückführungsanträge gestellt werden können. Nachdem wir das alles gehört haben, war das dann so, dass wir gesagt haben, na ja, wenn die sagen, es ist eine Rückführung sehr unwahrscheinlich, weil einfach die Situation so klar ist, dass das Kind eh schon auf die Dauerpflege geht, dann gehen wir davon aus, dass das bei uns bleiben kann und das Risiko nehmen wir in Kauf.
Natürlich ein Restrisiko bleibt, aber das ist halt so. Und damit haben wir irgendwie anscheinend die Qualifizierungsmaßnahme bestanden und sind dann in diesen Pool gekommen, wo wir dann gewartet haben darauf, dass uns jemand kontaktiert. Ich glaube, es hat dann fast ein Dreiviertel des Jahres gedauert, bis sich jemand gemeldet hat. Das war ein bisschen eine komische Zeit. Es hat geheißen, es werden ganz dringend Pflegeeltern gesucht und dann ist man fertig und voller Elan. Und dann wartet man und sitzt da und denkt sich, oh, niemand fragt. War dann aber am Ende so, dass wir kontaktiert worden sind und das hat dann gleich gepasst. Also das war wirklich die erste Anfrage, die wir gekriegt haben. War ganz anders, als wir ursprünglich gedacht haben, weil wir haben schon eine große leibliche Tochter mit acht Jahren und wir wollten eigentlich ein Mädchen mit so zwei, drei Jahren, damit der Altersabstand ganz okay ist. Mit Mädchen kennen wir uns aus. Buben da haben wir wenig Erfahrung, wenig Spielzeug und wenig drumherum. Und am Ende ist es dann ein Babyboy geworden. Und wir sind aber sehr happy, weil eigentlich am Ende war das goldrichtig. Also es war wirklich perfekt. Und es hat sich auch so richtig angefühlt. Wir sind kontaktiert worden und gefragt worden, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr ein Baby auch nehmt. Könnte sein, dass es ein Mädchen wird, könnte sein, dass es ein Bub wird. Hat man nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, weil es noch im Bauch der leiblichen Mama war. Also das war wirklich ganz komisch. Wir haben irgendwie in dem Moment gesagt, ja. Obwohl das eigentlich ganz anders war, als wir uns das vorgestellt haben oder gedacht haben.
Simone Koren-Wallis:
Und nachdem das Thema so, so spannend ist, würde ich gleich sagen, wir switchen zu Folge zwei. Das heißt, am besten gleich weiterhören.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 32: Advent in Graz
Advent in Graz: Ein Erlebnis für Groß und Klein.
Alles zu den 14 Adventmärkten mit allen Neuigkeiten, den Advent-Highlights, wie viele Menschen überhaupt erwartet werden und was ein gewisser Herr Frosti eigentlich in Graz macht: das gibt's in dieser Folge vom Stadt Graz Podcast "Grazgeflüster" mit Citymanagerin Verena Hölzlsauer.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Ein Erlebnis für Groß und Klein. Das ist Advent in Graz. Heute erfahrt ihr alles zu den Advent Highlights. Wie viele Menschen da überhaupt erwartet werden und was ein gewisser Herr Frosti in Graz macht. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Verena Hölzlsauer.
Verena Hölzlsauer:
Mein Name ist Verena Hölzlsauer. Ich bin die Leiterin des City Managements der Holding Graz. Und wir sind die umsetzende Abteilung unserer Grazer Adventmärkte.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Advent in Graz. Also für mich ist es eine der schönsten Zeiten hier in der Landeshauptstadt. Verena, wie geht es dir im Advent?
Verena Hölzlsauer:
Danke, für mich ist es natürlich auch eine der spannendsten und schönsten Zeiten in unserem Jahreszyklus. Wobei ich auch sagen muss, uns beschäftigt der Advent ja das ganze Jahr über. Das heißt, vor dem Advent ist nach dem Advent. Wir starten im Jänner mit der Aufarbeitung des vergangenen Advents. Und starten im Frühling mit den Vorbereitungen für den nächsten.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt sind wir ja wirklich mittendrin. Das heißt, wahrscheinlich die meiste Arbeit ist für dich im City Management dann eh schon getan oder ist gerade noch Vollgas?
Verena Hölzlsauer:
Nein, wir haben noch Vollgas. Wir haben am 18. November die Märkte eröffnet. Und am 2. Dezember kommt dann noch das große Event mit der Illumination des Christbaums, mit der Eröffnung einer Eiskrippe. Und dann haben wir mal alles so weit am Laufen, dass wir bis 23. Dezember hoffentlich operativ durch sind mit dem heurigen Advent.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, jetzt am Samstag leuchtet dann auch der Christbaum.
Verena Hölzlsauer:
Genau, also der Christbaum, den haben wir heuer aus Altaussee. Wir sind ja im Sommer mit dem Stadtförster und dem Georg Fuchs aus dem Bürgermeisterinnen Büro nach Alterssee gefahren und haben uns einen Christbaum ausgesucht. Und das war eigentlich ein super spannender Termin, weil der dortige Revierförster hat glaube ich neun Bäume schon vorselektiert, die wir uns angeschaut haben. Und das war wirklich ein großartiger Tag, da unterm Loser durch die Wälder zu fahren und einen Christbaum auszusuchen. Und wir haben jetzt einen, der wirklich super schön ist, der zum Bergen okay war. Und den werden wir am 2. Dezember mit einer Delegation aus Altaussee, mit der Salinenmusik aus Alterssee illuminieren.
Simone Koren-Wallis:
Du hast es vorher schon angesprochen, diesen Samstag wird nicht nur der Christbaum illuminiert, also eingeschaltet, sondern auch die Eiskrippe. Und ich finde ja, die Eiskrippe, das ist so ein Platz, da muss man hin im Advent, da kommt man nicht vorbei in Graz. Bitte erzähl uns was über die Eiskrippe.
Verena Hölzlsauer:
Die Eiskrippe haben wir in Graz seit 1996 und seit rund zehn Jahren macht es der finnische Eiskünstler Kimmo Frosti.
Simone Koren-Wallis:
Der heißt wirklich so? Wirklich jetzt?
Verena Hölzlsauer:
Der heißt wirklich so, ja.
Simone Koren-Wallis:
Kimmo Frosti.
Verena Hölzlsauer:
Kimmo Frosti. Und es werden jährlich knapp 35 Tonnen kristallklares Eis verarbeitet und ist die letzten Tage schon in der Nähe von Stainz vorbereitet worden und wird heute aufgestellt.
Simone Koren-Wallis:
Zu den Adventmärkten, wie viele gibt es eigentlich in Graz?
Verena Hölzlsauer:
Wir haben 14 Märkte. Was wir heuer neu haben, ist die Adventlounge in der Schmiedgasse. Wir haben im Frühjahr eine Umfrage gemacht, wie gefällt euch der Advent, was fehlt euch? Grundsätzlich haben wir ein sehr positives Feedback über unsere Umfrage bekommen, was den Advent in Graz betrifft. Aber eines der Dinge, die den Leuten so ein bisschen fehlt, ist, dass man sie wo hinsetzen kann, dass sie ältere hinsetzen können. Mit der Schmiedgasse sind wir diesem Wunsch nachgekommen und haben jetzt eben diesen Lounge-Bereich. Und wir haben auch vier mit Rollspur unterfahrbare Sitzmöbel, wo man mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt Graz eben hat, unser Marktbetreiber, die Konstruktion dieser Sitzmöbel gemacht.
Simone Koren-Wallis:
Ich finde es auch total schön geworden. Es schaut so edel aus, irgendwie, dort in der Schmiedgasse. Also mir gefällt es sehr, sehr gut.
Verena Hölzlsauer:
Ja, danke Simone. Also mir gefällt es auch sehr, sehr gut und es hat auch jetzt am ersten Wochenende schon wirklich gut, sehr gut angenommen worden. Also wir haben gute Frequenzen gehabt. Wir haben am ersten Wochenende nahe 110.000 Besucherinnen auf unseren Adventmärkten gehabt, was im Gegensatz zum Vorjahr, wo ich es jetzt mal verglichen habe, wirklich ein super guter Wert ist. Und das Wetter hat natürlich auch super mitgespielt, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber wenn es so weitergeht, dann können wir uns gleich wirklich auf eine tolle Adventmarktsaison freuen.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Menschen erwartet man jetzt im Advent in Graz? Hast du da eine Zahl? Kann man das überhaupt messen?
Verena Hölzlsauer:
Über A1 haben wir anonymisierte Frequenzdatenmessungen in der Zone Grazer Innenstadt. Und letztes Jahr hatten wir in den sechs Adventwochen rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher.
Simone Koren-Wallis:
Und jetzt, wenn das erste Wochenende schon so gut war, kann es sein, dass wir das knacken?
Verena Hölzlsauer:
Ich hoffe, dass wir es knacken, ja. Es ist das Ziel, es zu knacken.
Simone Koren-Wallis:
Du hast gesagt, 14 Adventmärkte haben wir. Ich meine, Hauptplatz ist klar, Eisernes Tor ist für mich klar, Schlossberg ist auch klar. So, da fehlen nachher noch ein paar.
Verena Hölzlsauer:
Okay, dann muss ich jetzt mit aufzählen. Wir haben den Hauptplatz, wir haben das Eiserne Tor. Wir haben den Glockenspielplatz und den Mehlplatz. Dann haben wir am Färberplatz den Kunsthandwerkmarkt. Dann, nicht zu vergessen, Franziskanerviertel mit oberer Neutorgasse, mit dem Kinderschwerpunkt in der oberen Neutorgasse. Dann haben wir das Joanneumsviertel mit dem Lesliehof, wo wir im Lesliehof wieder die Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen haben. Aufsteirern sitzen wir gerade davor. Südtirolerplatz, Maria-Hilfer-Platz haben wir einen Markt. Christkindlmarkt heißt unser Adventmarkt am Nikolaiplatz. Und buntes aus aller Welt am Tummelplatz ist dann last but not least.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt gibt es da so viel zum Anschauen. Also man muss ja hoffen, dass man sich wirklich alles anschauen kann im Advent. Aber gibt es von dir irgendwie, wo du sagst, die Sachen, die müsst ihr machen?
Verena Hölzlsauer:
Ich finde, wir haben ganz tolle Fotopoints. Wir haben drei beleuchtete Fotopoints am Hauptplatz, am Eisernen Tor und heuer neu am Franziskanerplatz. Dann haben wir noch den Grazgutschein-Fotopoint direkt am Hauptplatz am Markt. Und dann haben wir noch einen weiteren Fotopoint am Andreas-Hoferplatz in der Ecke Neutorgasse. Da werden wir heuer mit 1. Dezember einen Christkind-Postkasten installieren, wo die Kleinsten ihre Wünsche ans Christkind abgeben können. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man wahrscheinlich auch das Christkind in der Nähe mal herumfliegen sehen.
Simone Koren-Wallis:
Du hast es gerade vorher angesprochen, und zwar die Graz-Gutscheine. Das ist wirklich was, wenn man sagt, man weiß vielleicht nicht ganz, was man schenken soll, weil das so vielfältig ist, oder?
Verena Hölzlsauer:
Genau, das ist ein super Gutschein, den du inzwischen in über 950 Geschäften und Gastronomiebetrieben in der Kratzer Innenstadt einlösen kannst. Und hat sich wirklich sehr, sehr gut etabliert die letzten Jahre.
Simone Koren-Wallis:
Du hast auch so einen super Plan mit, wo es alle Christkindl-Märkte gibt, was alles geboten wird. Wo kriegt man den Plan?
Verena Hölzlsauer:
Den Plan kriegt man bei all unseren Märkten und natürlich im Kratztourismusbüro, bei unserem Andreas-Hoferplatz und im Rathaus, im Dispenser, beim Portier sollten, glaube ich, auch Pläne aufliegen.
Simone Koren-Wallis:
Und da ist eingezeichnet, und zwar, das ist so in einem schönen, altrosa hätte ich fast gesagt, ein Krippenweg. Bitte, was ist ein Krippenweg?
Verena Hölzlsauer:
Also den Krippenweg, den gibt es eigentlich schon recht lang. Der war ursprünglich in der Stempfergasse etabliert. Da haben die Händlerinnen und Händler vom Diözesanmuseum geborgte Krippen in ihren Auslagen ausgestellt. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch schön, wenn wir diesen Krippenweg auf die gesamte Innenstadt ausweiten könnten. Wir haben jetzt über 20 Händlerinnen und Händler, die daran teilnehmen. Das Ganze endet jetzt im Diözesanmuseum mit der jährlichen Krippenausstellung. Ja, die Krippen sind eben teils eine Leihgabe des Diözesanmuseums. Andererseits gibt es Betriebe, die selbst ihre Krippen gestalten. Da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen.
Simone Koren-Wallis:
Und eines, was vielleicht noch wichtig ist, der Bummelzug. Der Bummelzug gehört dazu, oder? Zum Grazer Advent.
Verena Hölzlsauer:
Der Bummelzug gehört fix dazu. Der Bummelzug fährt seine gewohnte Runde. Und ja, einsteigen und mitfahren.
Simone Koren-Wallis:
Und wenn man sagt, okay, Bummelzug ist schön und gut, ich will aber mit der BIM nachher nach Hause fahren. Es gibt wieder gratis BIM-Fahrten.
Verena Hölzlsauer:
Genau, an den Samstagen gibt es wieder die gratis Straßenbahnfahrten.
Simone Koren-Wallis:
Und ich als Mama einer Sechsjährigen, das ist vielleicht nicht nur für mich spannend, es gibt Kinderbetreuung. Das heißt, ich kann dem Christkind helfen, einkaufen zu gehen. Und kann man ein Kind wo abgeben, oder?
Verena Hölzlsauer:
Genau, du kannst, wenn du das Wort abgeben verwenden möchtest. (lacht) Betreuen lassen. Du kannst deine Tochter am 2.,8..9.,16. und 23.12. in der Volksschule Ferdinandeum betreuen lassen. Die Kinderfreunde sind da unser Partner. Und du kannst mit der Kleinen gemeinsam basteln, Kasperl schauen. Aber du kannst auch kurz deine Flügel anziehen und Christkind spielen gehen.
Simone Koren-Wallis:
An alle, die Christkind spielen wollen jetzt in den nächsten vier Wochen. Oder eben auch einfach die Adventmärkte durchbummeln. Es gibt so, so viel in Graz. Vielleicht noch die Website, wo man reinschauen kann, wo auch alle Informationen dort sind?
Verena Hölzlsauer:
holding-graz.at.
Simone Koren-Wallis:
Sehr gut. Und damit, glaube ich, bleibt nur noch über einen schönen Advent zu wünschen, oder?
Verena Hölzlsauer:
Ebenfalls. Einen schönen Advent an alle.
Simone Koren-Wallis:
Vor allem die Kinder freuen sich schon so sehr auf Weihnachten. Und ein paar von ihnen haben nur einen Wunsch. Und zwar eine Familie zu finden. Und genau das ist das Thema beim nächsten Mal. Pflegeeltern gesucht. Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 31: Ehrenamt in der Stadt Graz
Jeder von uns kann zur guten "Fee" werden. Fee steht für freiwillig, engagiert und ehrenamtlich und ist die Ehrenamtsbörse der Stadt Graz. Hier bringt die Stadt Graz Menschen, die sich in ihrer Freizeit engagieren möchten, mit Organisationen zusammen, die Unterstützung benötigen.
Wie viele Grazer:innen engagieren sich überhaupt freiwillig? Wie wichtig ist das Ehrenamt?
Alle Infos gibt's in dieser Folge mit Wolfgang Rajakovic, Referent Asyl und freiwilliges Engagement der Stadt Graz.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Ein Riesendanke an alle, die sich ehrenamtlich irgendwo engagieren. Und an alle, die es vielleicht noch machen wollen. Wie wichtig ist eigentlich das Ehrenamt? Wo werden gerade Leute gebraucht in Graz? Und wie ihr wirklich zur guten Fee werden könnt. Das gibt es alles in dieser Folge mit Wolfgang Rajakovic.
Wolfgang Rajakovic:
Hallo Wolfgang Rajakovic, mein Name. Ich arbeite in der Abteilung Bildung und Integration im Integrationsreferat. Und dort ist auch die Servicestelle für Engagement angesiedelt. Und ich bin der zuständige Referent dafür.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Es gibt ganz, ganz viele Gründe ehrenamtlich tätig zu sein, sich zu engagieren. Lieber Wolfgang, können wir vielleicht gleich einige aufzählen?
Wolfgang Rajakovic:
Ja natürlich. Es gibt unendlich viele Gründe. Manchmal stolpert man rein. Ich denke an Eltern, die tätig werden. Im Elternverein, in Sportvereinen ihrer Kinder und dergleichen. Es sind Menschen meistens, die sich zu Interessen zusammenschließen. Ob das jetzt nachhaltig ist, gemeinsam garteln. Ob das gemeinsam Chor singen und Theater spielen ist. Es gibt Menschen, die neu nach Graz kommen und einfach Anschluss suchen. Und sich einen Verein suchen, wo sie ihre Interessen ausleben können. Und es gibt Menschen, die eine Zäsur im Leben haben. Zum Beispiel in Pension gehen, die Kinder sind nicht mehr in der Wohnung. Und sich eine neue Aufgabe suchen.
Simone Koren-Wallis:
Wie wichtig ist das Ehrenamt? Ich weiß nicht, ob man es jetzt allgemein für die Stadt Graz machen sollte oder überhaupt allgemein?
Wolfgang Rajakovic:
Es hat in Österreich eine lange Tradition. Ein Ehrenamt ist entstanden aus dem, dass im 19. Jahrhundert der Kaiser erlaubt hat, dass sich Privatmenschen organisieren. Diese Organisationsform, der Verein, der damals geboren wurde, hatte Obmänner, Schriftführer und so weiter. Und diese Tätigkeit wurde ohne Entgelt ausgeübt. Und daraus ist der Begriff, ich habe ein Amt für die Ehre, Ehrenamt, entstanden. Das ist sozusagen, was wir heute unter formellen Ehrenamt verstehen. Wird immer anspruchsvoller in seiner Aufgabe. Wenn du dir vorstellst, im FC Kainbach, wo 100 Kinder Fußball spielen, was kosten von Rasenpflege das, Turnierteilnahmen und so weiter, gleich mal 40.000 bis 50.000 Euro im Jahr. Da musst du einen Obmann finden, der unterschreibt, da musst du einen Kassier finden und so weiter. Das ist ja nicht der SK Sturm, wo Sponsorenschlange stehen, sondern das sind relativ hohe Kosten und so weiter. Das ist dieses formelle Ehrenamt.
Und das Zweite, was wir am besten, aus dem englischen mit diesem Voluntary Work herziehen, ist diese freiwillige Arbeit. Das ist einfach, dass man im Sinne des Gemeinwohls sich Zeit nimmt, um Gemeinwohltätigkeiten zu machen. Ob im Elternverein, ob in einem Lerncafé mit Kindern lernen, ob im Seniorenheim alte, einsame Menschen zu besuchen. Oder es gibt ja auch von der Stadt die Bücherbotinnen, die zu alten Menschen die Bücher tragen von den Stadtbibliotheken. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten mitzutun. Was es ist, es sind 46% der Österreicherinnen, die sich im formellen oder informellen Ehrenamt engagieren. Wir haben ein Land-Stadt-Gefälle, in der Stadt sind es weniger. Aber wir können davon ausgehen, dass wir in Graz 100.000 bis 120.000 Bürgerinnen haben, die in ihrer Freizeit etwas zurückgeben im Sinne von Gemeinwohltätigkeiten.
Simone Koren-Wallis:
Die Zahl ist ein Wahnsinn. Aber würde das gesellschaftliche Leben ohne diesem Ehrenamt vielleicht sogar zusammenbrechen?
Wolfgang Rajakovic:
Zusammenbrechen ist mir schwer gesagt. Aber ich glaube, sagen wir mal, wenn jetzt die Großen, die alle kennen, wenn jetzt Caritas, Rotes Kreuz und freiwillige Feuerwehr, bleiben wir nur bei den Dreien.
Simone Koren-Wallis:
Und die sind extrem wichtig für uns alle.
Wolfgang Rajakovic:
Für einen Monat sagen die Ehrenamtlichen, ich glaube, es gäbe sehr sichtbare Einschnitte im Zusammenleben.
Simone Koren-Wallis:
Du hast jetzt schon einige Sachen aufgezählt, was zum Ehrenamt gehört. Ich muss gestehen, mir waren ein paar Sachen gar nicht bewusst. Ebenso wie du sagst, diese Lesepartien auch von der Stadt zum Beispiel. Was hat die Stadt noch? Bücherbotinnen hast du vorher glaube ich schon erzählt. Die bringen wirklich Bücher?
Wolfgang Rajakovic:
Das ist eine Initiative von den Stadtbibliotheken. Die bringen alten Menschen, die nicht mehr gehen können, Bücher. Wobei auch das, wenn du mit ihnen redest, da gibt es alte Menschen, die jede Woche ein neues Buch bestellen. Da geht es aber viel mehr um den Besuch und eine halbe Stunde zusammensitzen und reden. Ich weiß gar nicht, ob die Bücher dann immer alle gelesen werden. Aber da merkt man, das sind so soziale Funktionen. Ein wenig wärmer ist glaube ich ein gutes Schlagwort in diesen Bereichen, wenn freiwilliges Engagement sozusagen auf Menschen trifft.
Simone Koren-Wallis:
Und da gibt es natürlich auch ganz viele Netzwerktreffen. Also man vernetzt sich untereinander. Aber ich würde gerne eine Geschichte ganz groß herausheben. Das ist der Fee Award. Kannst du den einmal bitte kurz erklären und auch wann er ist?
Wolfgang Rajakovic:
Der Fee Award wird einmal im Jahr verliehen. Gibt es jetzt schon seit sechs oder sieben Jahren. Da geht es um Anerkennung für eine gute Idee oder um eine kleine Anerkennung. Wir suchen immer neue Ideen, neue Initiativen, neue Projekte, die Freiwillige gestartet haben. Und wir haben dann im Sommer ein großes Fest des Integrationsreferats. Das heißt, Graz kommt zusammen. Da waren in den letzten Jahren immer über 2000 Menschen in der Seifenfabrik. Da machen wir einen großen Bazar der Informationen. Da sind zwischen 90 und 100 Vereine dort. Und es ist ein großes Fest. Und da laden wir alle auf Jause ein und dergleichen. Und da wird dann bei herrlichstem Wetter immer, weil gute Produkte haben immer schönes Wetter. Wirklich die letzten zwei Jahre Traumwetter. Aber im Garten zwischen Seifenfabrik und Mur wird dann vor 800 Leuten der Fee Award. Also werden drei Projekte ausgezeichnet. Die drei Siegerprojekte bekommen dann eine Anerkennung in Form von einem Scheck über 700 Euro und den Fee Award. Als wirklich sozusagen Freude oder als Dankeschön der Stadt Graz, dass sich Menschen engagieren und immer wieder neue Ideen haben und was Neues probieren und dergleichen mehr.
Simone Koren-Wallis:
Und wenn man jetzt wirklich was Neues auch gestartet hat und sagt, hey, da bewerbe ich mich. Weil vielleicht mit der Geschichte, die ich ehrenamtlich mache, vielleicht gewinne ich diesen Fee Award. Wo kann man sich da bewerben?
Wolfgang Rajakovic:
Über die Homepage. Wir schreiben das aus auf graz.at/engagiert. Siehst du, dann gibt es verschiedene Artikel und da erscheint dann meistens so kurz nach Ostern, April, Mai herum, weil im Juni ist das Fest, der Aufruf zur Einreichung. Einfach um die Idee zu skizzieren und zu sagen, wer da mitmacht und fertig. Das reicht auch der Jury, um zu beurteilen, wie gut passt das zusammen.
Simone Koren-Wallis:
Wenn wir schon bei den Terminen sind, jetzt ist Ostern noch ein bisschen weiter weg, aber wir haben einen Termin Anfang Dezember, den wir auch gern bewerben möchten.
Wolfgang Rajakovic:
Ja, unbedingt. Am 5. Dezember ist der Internationale Tag der Freiwilligenarbeit. Da ist aber in Österreich Krampus.
Simone Koren-Wallis:
Das ist auch ehrenamtlich unterrichtet.
Wolfgang Rajakovic:
Deswegen ist es natürlich kein optimaler Tag, um das Ehrenamt oder die Freiwilligenarbeit groß ins rechte Licht zu rücken und riesige Veranstaltungen zu machen. Wir machen ein kleines Dankeschön und das machen wir dieses Jahr im KIZ Royale. Wir laden alle engagierten Menschen ein, die Lust und Zeit haben, zu einem Kino für alle. Wir haben dazu doch dem Krampus geschuldet, eine neue Verfilmung von Agatha Christie ausgesucht, „A Haunting in Venice", Morde in Venedig. Das Buch werden wahrscheinlich ganz viele kennen. Und am Dienstag, den 5. Dezember um 18.30 Uhr haben wir da im Kiez Royale die ganze Vorstellung übernommen. Wer Lust und Zeit hat, freuen wir uns, wenn Sie mit uns als kleines Dankeschön gemeinsam einen Film anschauen.
Simone Koren-Wallis:
Alle Infos gibt es sicher auch noch auf gratz.at-engagiert, gell?
Wolfgang Rajakovic:
Selbstverständlich.
Simone Koren-Wallis:
Mir gefällt von euch der Spruch so gut, wir brauchen sie, weil sie gebraucht werden.
Wenn ihr da draußen das jetzt hört und sagt, okay, ich bin noch nicht ehrenamtlich tätig, vielleicht einmal reinschauen, auch auf die Website und so schauen, hey, was gibt es eigentlich alles, wo kann ich mich ehrenamtlich betätigen? Und wenn dieses Gespräch jetzt vielleicht nur einen Grazer oder eine Grazerin dazu bringt, vielleicht mit der Nachbarin, die 90 ist, mit dir auch einkaufen zu gehen zum Beispiel, das ist schon der erste Schritt, oder?
Wolfgang Rajakovic:
Selbstverständlich, und es freuen sich alle Organisationen, wenn sich neue, engagierte Menschen zum Mitmachen melden. Wir haben dafür in Graz eine Plattform, die Plattform ist die FEE, daher kommt auch der Fee Award. FEE hat eine Doppelbedeutung, das heißt, die Plattform bedeutet freiwillig ehrenamtlich engagiert, ist natürlich aber auch in Erinnerung an die gute Fee, die wir alle aus den Märchenbüchern kennen. gratz.at/fee, das ist tatsächlich eine Plattform, die wie andere Suchplattformen, keine Ahnung, wie Willhaben funktioniert, dort inserieren Vereine und Organisationen, die Menschen suchen, die sich engagieren möchten, da kann jeder durchklicken, das ist inhaltlich, ich möchte mit Kinder, Jugendlichen, ich möchte mit Seniorinnen, ich habe Donnerstag, ich habe Freitag, ich habe in Wochenzeit, filtert dann durch. Da sind immer so mit Schwankungen zwischen 150 und 200 Inserate von Vereinen, die Menschen suchen, die mitmachen wollen, einfach durchschauen.
Simone Koren-Wallis:
Und zu guten Fee werden.
Wolfgang Rajakovic:
Genau.
Simone Koren-Wallis:
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt kommt dann wirklich meine Lieblingszeit. Wenn es überall so nach Zimt und Orangen duftet, die Stadt so schön geschmückt ist und beleuchtet ist und die Adventmärkte einladen. Und genau darüber reden wir in der nächsten Folge, über den Advent in Graz. Wir hören uns, ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 30: Equal Pay Day in Graz
Am 9. November ist in Graz Equal Pay Day. Also jener Tag, an dem Vollzeit arbeitende Männer bereits das Jahreseinkommen von Vollzeit arbeitenden Frauen erreicht haben. Wie viel Geld verdienen Grazerinnen durchschnittlich weniger? Was können wir dagegen tun? Und wie lange wird es dauern, bis das Einkommen ausgeglichen ist? Diese und weitere Fragen beantwortet Doris Kirschner aus dem Referat Frauen und Gleichstellung.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Liebe GrazerInnen, wir Frauen arbeiten ab nächsten Donnerstag gratis, im übertragenen Sinn, denn heute in einer Woche ist Equal Pay Day und über den sprechen wir heute schon und eines ist fix, diese Folge ist nicht nur was für Frauen. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation, mein Gast Doris Kirschner.
Doris Kirschner:
Mein Name ist Doris Kirschner, ich bin die Leiterin vom Referat Frauen und Gleichstellung in der Stadt Graz, bin 56 Jahre alt, falls das jemanden interessiert, schon lange bei der Stadt Graz, ganz ganz lange in der Arbeit mit und für Frauen und das war es eigentlich schon.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Stell dir vor, du machst genau den gleichen Job wie dein männlicher Kollege, bekommst dafür aber weniger bezahlt und das ist heute genau unser Thema, denn heute in einer Woche ist in Graz der Equal Pay Day. Vielleicht können wir den aber noch einmal ganz genau erklären was das ist.
Doris Kirschner:
Der Equal Pay Day ist ein statistisch errechneter Tag, an dem die Männer in Graz schon so viel verdient haben, wie die Frauen bis zum Ende des Jahres dann erst verdienen, sprich die Frauen arbeiten ab dem Equal Pay Day quasi gratis.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt sitzen da zwei Frauen, wie geht es uns jetzt damit, dass wir das hören, dass wir sagen, okay Frauen sehen noch immer den Männern so viel hinten nach, was das Gehalt betrifft?
Doris Kirschner:
Eigentlich ist es einfach gemein und es gibt natürlich viele Faktoren, warum das so ist und es ist nicht immer sozusagen direkt eins zu eins vergleichbar. Es ist nicht immer so, dass der Kollege, der neben mir sitzt und das gleiche macht, so viel mehr verdient als ich. Es ist natürlich eine Durchschnittsberechnung, aber trotzdem gibt es einfach Faktoren im Leben von Frauen, die dazu führen, dass die Frauen im Laufe ihres Lebens weniger verdienen als die Männer.
Simone Koren-Wallis:
Was sind das für Faktoren? Also eins liegt auf der Hand, wir bringen die Kinder auf die Welt.
Doris Kirschner:
Genau, das ist ein Faktor, was auch dazu kommt, wobei ich jetzt gleich dazu sagen muss, dass das in der Berechnung vom Equal Pay Day gar nicht drinnen ist, weil es da um Vollzeitequivalente geht. Viele Frauen arbeiten einen Teil ihres Erwerbslebens Teilzeit, damit es sich besser ausgeht mit der Familie oder weil es in Branchen, in denen die Frauen hauptsächlich arbeiten, gar keine Vollzeitjobs gibt. Ein weiterer Faktor ist, dass die sogenannten typischen oder traditionellen Frauenberufe auch niedriger entlohnt werden. Das ist einfach eine geschichtliche Entwicklung. Das heißt, wenn man im Handel oder in der Pflege arbeitet, dann ist das normale Einkommen einfach niedriger, als wenn man irgendwo in einem technischen Beruf arbeitet.
Simone Koren-Wallis:
Warum ist dann nicht schon langsam ein Umdenken da, dass man sagt, okay, dann hebe ich es wenigstens stetig an?
Doris Kirschner:
Das ist die gute Frage. Also wir versuchen seit Jahrzehnten, darauf hinzuweisen, dass es so ist. Ein Faktor wäre einfach, gesellschaftlich über die Wertigkeit von Arbeit zu diskutieren. Was ist uns als Gesellschaft, welche Arbeit wert? Und da gibt es einfach noch immer viel Diskussionsbedarf, viel Aufholbedarf und natürlich braucht es auch die Bereitschaft sozusagen derjenigen, die die Löhne zahlen, die Gehälter anzuheben.
Simone Koren-Wallis:
Was mir noch aufgefallen ist, ich habe letzte Woche schon von dem Equal Pay Day gelesen. Ich glaube österreichweit bilde ich mir ein und steiermarkweit ist wieder was anderes. Das heißt, es gibt Unterschiede, oder? Also österreichweit ist am anderen Tag als steiermarkweit und Graz ist wieder anders.
Doris Kirschner:
Genau. Der österreichweite Equal Pay Day ist am 25. Oktober. Das ist der Durchschnitt über Gesamtösterreich.
Na, Blödsinn, der steiermarkweite Equal Pay Day ist am 25. Oktober und Österreich ist am 31. Oktober. So ist es. Und der Grazer Equal Pay Day ist am 9. November.
Simone Koren-Wallis:
Liegt das jetzt daran, dass man in der Stadt ein bisschen besser verdient?
Doris Kirschner:
Genau. In der Stadt geht es den Frauen, was das Einkommen betrifft, einfach ein bisschen besser. In der gesamten Steiermark geht es den Frauen ein bisschen schlechter als in Gesamtösterreich. Und es gibt eben diese Berechnung, wo die einzelnen Tage auf alle Bezirke in Österreich heruntergebrochen sind. Und da kann man sich auch den Vergleich anschauen.
Simone Koren-Wallis:
Aber können wir vielleicht, ich bin zwar jetzt nicht so ein Zahlenfanatiker, aber haben Sie eine Durchschnittszahl? Also wie viel verdienen wir Frauen durchschnittlich?
Doris Kirschner:
Die Arbeiterkammer Österreich berechnet das immer, sozusagen an den Realeinkommen, die es gibt. Und die Zahlen, das muss man auch dazu sagen, sind immer von vor zwei Jahren. Weil diese Zahlen einfach erst nach und nach erhoben werden können. Und die heurigen Zahlen stammen aus 2021. Mir fällt gerade ein, wir waren am 31. Oktober am Hauptplatz. Und da haben wir unter anderem, außer dem Infomaterial, das wir sowieso zu verteilen haben, auch ein Schätzspiel für die Leute, die vorbeikommen gehabt. Und auf die Frage hin, wie viel das so ungefähr ist, könnte man ja jetzt eigentlich gleich das Schätzspiel ausprobieren. Also es gibt drei Fragen bei diesem Chatspiel. Und es gibt auch immer drei Antworten. Also man kann sich eine aussuchen.
Die erste Frage ist, wie groß ist in Österreich der durchschnittliche Einkommensnachteil, den Frauen gegenüber Männer haben? Beide arbeiten ganzjährig in Vollzeit. Die eine Antwort ist 10,3 Prozent. B ist 16,9 Prozent. Und C ist 24,3 Prozent.
Simone Koren-Wallis:
Die die Männer quasi mehr verdienen als wir Frauen. Ich nehme die goldene Mitte.
Doris Kirschner:
Richtig, 16,9 Prozent. Und jetzt umgerechnet, wie hoch ist dieser Einkommensnachteil im Geld? Da ist A 6.200 Euro, B 9.600 Euro oder C 12.800 Euro.
Simone Koren-Wallis:
Bist du narrisch... Ich hoffe nicht, dass das stimmt, aber ich nehme die höchste Zahl mit die 12.000.
Doris Kirschner:
Das ist auch die Mitte mit 9.600. Genau.
Simone Koren-Wallis:
9.600 Euro verdienen die Männer mehr als die Frauen.
Doris Kirschner:
Genau.
Simone Koren-Wallis:
Was man mit dem Geld alles machen könnte.
Doris Kirschner:
Genau. Und eine dritte Frage haben wir auch noch. In 13 Jahren hat sich der Einkommensunterschied in Österreich um wie viele Tage verringert?
Simone Koren-Wallis:
Ah, weil es besser geworden ist.
Doris Kirschner:
Genau. Um 11 Tage, um 22 Tage oder um 33 Tage.
Simone Koren-Wallis:
Das kann sich nicht so arg verbessert haben. Ich nehme die geringste Zahl.
Doris Kirschner:
In dem Fall ist es die höchste. Es hat sich um 33 Tage verbessert.
Simone Koren-Wallis:
Wirklich?
Doris Kirschner:
Ja, es hat sich doch in den letzten 13 Jahren einiges getan.
Simone Koren-Wallis:
Ja, Gott sei Dank hat sich was getan.
Doris Kirschner:
Ja, also es tut sich schon was, aber es geht natürlich langsam.
Simone Koren-Wallis:
Was kann vielleicht jeder von uns tun, also nicht nur die höhere Ebene, die vielleicht eben die Gehälter ausbezahlt, aber was kann jeder von uns tun, außer dieses Umdenken? Weil ich glaube, ich habe einmal gehört, dass Frauen auch ungeschickt sind bei den Gehaltsverhandlungen. Das stimmt aber so nicht.
Doris Kirschner:
Den Frauen wird das oft auch nachgesagt, dass sie sich da mehr trauen sollen, was eigentlich sozusagen eine Verantwortungsumkehr ist für die Situation. Tatsache ist natürlich auch, dass es für Frauen oft auch schwierig ist, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hätte ich gerne, steht mir zu. Weil Frauen erstens gelernt haben, dass sie eigentlich besser durchs Leben kommen, wenn sie nett sind, wenn sie nicht aufmüpfig sind. Und Männern das oft sehr wohl zugestanden wird, beziehungsweise als Plus zugestanden wird, der traut sich was, der haut am Tisch, das ist ein richtiger Kerl. Und ja, also ich denke mir, natürlich müssen Frauen da auch taffer sein, aber andererseits kann ich es nicht den Frauen umhängen, dass sie eh selber schuld sind.
Simone Koren-Wallis:
Aber es ist ja nicht nur das Gehalt, oder?
Doris Kirschner:
Daheim, im Haushalt, um einfach das eigene private Leben zu organisieren, wird eben als unbezahlte Arbeit bezeichnet und da haben die Frauen auch noch immer die Nase vorne. Das heißt, einen Großteil der unbezahlten oder Care-Arbeit leisten die Frauen und das ist einfach auch mit ein Teil, warum sie oft Teilzeit arbeiten, oder teilweise gar nicht arbeiten, eine Zeit lang in ihrem Erwerbsleben, was dann auch wieder dazu führt, dass nicht nur das Einkommen, sondern später dann auch die Pensionen wesentlich geringer sind.
Simone Koren-Wallis:
Da sind wir dann beim Equal Pension Day?
Doris Kirschner:
Das ist der Equal Pension Day, der bei uns in Graz jedes Jahr so Ende Juli, Anfang August ist. Das heißt, der Equal Pay Day ist am 9. November und der Equal Pension Day ist tatsächlich Ende Juli, Anfang August. Das heißt, da sieht man, wie viel weniger Pension die Frauen bekommen, weil ihr Erwerbsleben auch nicht so durchgängig ist, wie das der Männer.
Simone Koren-Wallis:
Was erhoffen Sie sich für die Zukunft? Man wird es den Equal Pay Day nimmer geben.
Doris Kirschner:
Auch da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Die einen sprechen von ungefähr 500 Jahren, bis die Gleichstellung erreicht ist. Die anderen sagen 70 Jahre oder 100 Jahre. Tatsache ist, dass es wichtig ist, einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Eine mögliche Drehschraube ist sicher die Lohntransparenz, weil gerade bei uns in Österreich ist es ja so, dass man über Geld nicht spricht. Das ist ja eher ein Geheimnis. Und es ist jetzt auch auf europäischer Ebene eine Lohntransparenz-Richtlinie beschlossen worden, die wir in Österreich umsetzen müssen, wo es dann einfach transparenter ist, wie viel Mann, Frau sozusagen verdient. Ich glaube, dass das auch eine Drehschraube ist, wo Frauen dann einfach merken, ich kann auch mehr fordern. Ich muss nicht mit dem zufrieden sein, was ich bekomme, weil andere bekommen offensichtlich mehr.
Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge geht es um Grazerinnen und Grazer, die für ihre Arbeit gar kein Geld verdienen. Dafür umso mehr Respekt und Anerkennung.
Das Thema das Ehrenamt. Wir hören uns, ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 29: Sozialunterstützung
Sehr viele müssen momentan jeden Cent 2x umdrehen.
Aber wie ist es, wenn das Geld hinten und vorne nicht mehr reicht und man Unterstützung braucht?
Sozialamtsleiterin Andrea Fink und Referatsleiter Walter Purkarthofer geben einen Einblick in die Sozialunterstützung mit Antworten auf Fragen wie:
Wie viele Menschen in Graz haben darauf aktuell Anspruch? Wie funktioniert der Antrag? Wie kann ich mich beraten lassen?
Intro/Simone Koren-Wallis:
Ich glaube, sehr, sehr viele von uns müssen momentan jeden Cent zweimal umdrehen. Aber wie ist es, wenn das Geld hinten und vorne nicht mehr reicht und man Unterstützung braucht? Heute geht es eben um diese Sozialunterstützung.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste Andrea Fink und Walter Purkarthofer.
Andrea Fink:
Hallo, mein Name ist Andrea Fink und ich leite das Sozialamt der Stadt Graz. Ich mache das jetzt seit sieben Jahren und nach wie vor mit großer Begeisterung.
Walter Purkarthofer:
Mein Name ist Walter Purkarthofer. Ich leite den Fachbereich im Sozialamt, den Fachbereich für Sozialunterstützung, Sozialhilfe und die Infostelle. Ich bin seit etwas mehr als 20 Jahren im Sozialamt tätig.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema und zwar ist das die Sozialunterstützung. Gleich meine erste Frage, wird es in der heutigen Zeit, in diesen Zeiten von Inflation, Teuerung und Co. immer wichtiger?
Andrea Fink:
Auf jeden Fall. Wir merken das. Das ist natürlich, dass Teuerungen, Wohnungsverlust, die Mieten werden immer höher oder immer teurer, Energiekosten, alles steigt. Und da ist natürlich der Bedarf besonders groß, dass wir Leistungen im Sozialamt anbieten, wie eben die Sozialunterstützung, damit eben wirklich die Menschen hier in ihrer Lebensführung auch gut begleitet und eine gute Hilfestellung bekommen.
Walter Purkarthofer:
Im Moment hat man sowieso das Gefühl, die Welt hebt es aus den Angeln. Wir haben Umweltprobleme, wir haben Krieg, wir haben Wirtschaftsprobleme, wir haben die Inflation. Und umso mehr Probleme, die auf uns zukommen oder auf die Personen, die in Graz waren, desto mehr hat das Sozialamt auch zu tun. Da sehen wir die Aufgabe eben, Armut zu bekämpfen.
Simone Koren-Wallis:
Was bedeutet das überhaupt, Sozialunterstützung? Wer kriegt das? Die Grundlage ist ein Gesetz.
Andrea Fink:
Das heißt, ein Sozialunterstützungsgesetz ist ein Landesgesetz. Und da ist eben genau definiert, wer das kriegt, welche Voraussetzungen sozusagen gegeben sein müssen. Wichtig ist eben, glaube ich, einfach, grundsätzlich sollte man auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Aber natürlich gibt es auch Personen, denen wir gar nicht mehr zur Verfügung stehen können. Dann gibt es natürlich auch da Ausnahmen. Und ich glaube, am einfachsten, also bevor man da jetzt alles aufzählt, glaube ich, würde das etwas sprengen den Rahmen, ist es am einfachsten, wenn man bei uns vorbeikommt im Sozialamt. Dafür gibt es auch die Infostelle im Referat oder bei der Sozialunterstützung in diesem Fachbereich. Weil dort kann man sich genau erkundigen und dann sieht man, hat man überhaupt einen Anspruch oder nicht.
Simone Koren-Wallis:
Ist dieser Weg, genau dieser schwierige Weg, dass wir, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur wir Österreicher sind oder wir Steirer, wir Grazer, sagen, ich traue mich da vielleicht jetzt gar nicht hin, weil ich will nicht arm sein.
Walter Purkarthofer:
Das ist, glaube ich, ein europäisches Problem. In Mitteleuropa wird über Geld nicht gesprochen. Entweder hat man es oder man hat es nicht. Bis man sich traut, ins Sozialamt zu gehen, diese Hürde zu schaffen, die ist sehr groß. Weil man dann wirklich quasi vor fremden Personen sagt, man braucht Hilfe, man braucht Geld, ich kann das selber nicht mehr stemmen. Und es sind eben Personen, die entweder ein geringes Einkommen oder gar kein Einkommen haben oder auch kein Vermögen haben. Und die sind dann auf die Sozialunterstützung angewiesen. Dieser Richtsatz, der immer wieder, oder dieser Höchstsatz, der da besprochen wird, der richtet sich nach den Ausgleichsrichtsatzbezieherinnen. Das sind die Pensionisten mit Ausgleichszulage und ist derzeit etwa 1.053 Euro. Wenn man jetzt weniger verdient, hat man die Möglichkeit aufzustocken. Das heißt immer, das sind Sozialunterstützungsempfänger.
Der Großteil sind Aufstocker. Über 75 Prozent haben ein Einkommen, entweder durch Geringfügigkeit oder durch das Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe. Also die gehen arbeiten oder die sind vorübergehend arbeitslos. Aber dieses Einkommen, was sie da erwirtschaften, ist unter dem Richtsatz und brauchen daher noch etwas dazu von uns. Und das ist 75 Prozent bekommen nur etwas dazu und nur ein kleiner Prozentsatz ist wirklich von der Sozialunterstützung abhängig.
Andrea Fink:
Wir bieten alle Möglichkeiten an, sozusagen mit uns in Kontakt zu treten. Es ist erstens einmal persönlich bei uns vorbeizukommen. Man kann da auch Termine über unsere Website buchen. Man kann uns E-Mail schicken. Wir wollen da möglichst niederschwellig und auf allen Ebenen den Leuten zur Verfügung stehen.
Simone Koren-Wallis:
Nahbar?
Andrea Fink:
Ja, nahbar. Und eben auch, wenn einer das Gefühl hat, naja, ich will einmal einen Antrag schreiben, aber wie mache ich das? Und wenn er uns einmal ein E-Mail schreibt. Wir nehmen da natürlich Kontakt auf, wenn wir noch weitere Unterlagen oder so brauchen. Aber das ist uns wichtig, dass wir wirklich alle Kanäle offen halten.
Walter Purkarthofer:
Natürlich steckt hinter jedem Antrag viel Bürokratie. Es ist Steuergeld, das verwendet wird. Wir müssen bis auf den letzten Cent alles nachweisen, wer was und warum bekommt. Das heißt, wir müssen ein Verfahren durchführen. Gott sei Dank gibt es sehr viele öffentliche Register, auf die wir zugreifen können. Also die Zeiten, wo jeder seine ganze Dokumentenmappe ins Amt mitnehmen muss, damit er alles dabei hat, die sind vorbei. Also wir haben wirklich ein Aktenverfahren. Wir brauchen die Personen eigentlich nicht im Amt. Natürlich wollen wir die Leute kennenlernen. Wir wollen sie auch beraten, dass sie den Weg wieder aus der Sozialunterstützung hinausfinden. Es ist auch Ziel des Gesetzes, die Wiedereingliederung und die berufliche Eingliederung. Das heißt, Sozialunterstützung soll keine Dauerleistung sein, sondern vorübergehend sein. Und mit Hilfe von Beratung und Begleitung wollen wir, dass die Menschen wieder Fuß fassen und von der Sozialunterstützung wieder auf den Weg kommen.
Simone Koren-Wallis:
Vielleicht gehen wir gleich auf diese Unterstützungsangebote auch ein. Kann man jetzt auch zu euch kommen, wenn ich sage, es wird schwer, ich weiß nicht, wie ich das jetzt stemmen soll und ich brauche einfach einen paar Ratschläge. Ich weiß, die Banken machen das auch, aber das Sozialamt macht das auch, oder?
Walter Purkarthofer:
Das Sozialamt macht das auch.
Andrea Fink:
Also wir haben auch jetzt unabhängig von der Sozialunterstützung und der Infostelle eine Erstberatungsstelle. Da kann wirklich jeder zu uns kommen. Da brauche ich keinen Termin und nichts. Mit allen Themen kann ich mal hinkommen. Ob das jetzt Sozialunterstützung ist, ob das jetzt ein Mietenrückstand ist, auch wenn ich jetzt keinen Anspruch auf eine dauerhafte Unterstützung habe. Ob das jetzt eine Frage im Bereich Behindertenunterstützung ist, Pflege, Seniorinnen. Da kann ich einfach einmal hingehen und dann kann ich mein Thema dort sagen, um was es geht. Und die wissen dann, okay, ja, das wäre etwas, da braucht man eine genauere Beratung in Richtung Sozialunterstützung. Das geht ins Thema Pflege, da haben wir die Pflegedrehscheibe. Also wir haben da sehr, sehr viele Angebote, ganz ohne Termin. Da kann ich einfach hinkommen. Das ist jeden Tag sozusagen von 8 Uhr bis 12.30 Uhr habe ich da die Möglichkeit. Und die schauen dann, wer ist dann zuständig. Jetzt haben wir Sozialunterstützung, dann wird sofort ein Termin vereinbart. Also auch wichtig ist, dass da der Anschluss sozusagen gleich sehr schnell und unkompliziert klappt. Und es ist damit auch sichergestellt.
Simone Koren-Wallis:
Ich kann es überhaupt nicht greifen bei uns in Graz. Wie viele Personen bekommen eine Sozialunterstützung? Da gibt es ja sicher Zahlen, oder?
Walter Purkarthofer:
Natürlich gibt es Zahlen.
Andrea Fink:
Da verweise ich an dich, weil du hast die Zahlen besser im Kopf.
Walter Purkarthofer:
Es sind in etwa 9.000 Bezieherinnen und Bezieher. Wobei ein Drittel circa Männer, ein Drittel Frauen und, man glaubt es nicht, aber mehr als ein Drittel sind Kinder. Weil wenn eine Familie den Antrag stellt, oft zwei Erwachsene und drei bis vier Kinder. Das heißt, der Großteil der Sozialhilfebezieherinnen sind Kinder. Das schwankt je nachdem, also zwischen 8.000 und 11.000 Personen. Das sind meistens so um die 5.000 Bedarfsgemeinschaften. Bei uns wird ja der Antrag gestellt für eine Haushaltsgemeinschaft, eine Bedarfsgemeinschaft. Es zählt auch das Haushaltseinkommen. Das heißt, wenn eine Person im Haushalt kein Einkommen hat und der stellt einen Antrag, dann müssen wir den gesamten Haushalt prüfen. Und wenn es Unterhaltsverpflichtungen gibt und eine unterhaltsverpflichtete Person hat ein dementsprechendes Einkommen, hat er ja Unterhaltsverpflichtungen und das müssen wir dann auch gegenrechnen. Da kann sein, dass dann ein verminderter Anspruch oder eben sogar gar kein Anspruch entsteht. Wenn ein 16-Jähriger, das können auch Minderjährige den Antrag stellen auf Sozialunterstützung, für sich einen Antrag stellt, weil er von der Schule geflogen ist, weil er beim AMS nichts kriegt, weil er keine Lehrstelle gefunden hat, dann müssen wir schauen, wohnt er bei seinen Eltern? Ja, die Eltern sind unterhaltsverpflichtet. Was haben die Eltern für Einkommen? Und wenn das Einkommen dementsprechend über dem Richtsatz liegt, dann hat der junge Mann oder diese junge Frau bei uns keinen Anspruch.
Simone Koren-Wallis:
Es hat mir jetzt, muss ich sagen, wirklich kurz Gänsehaut bekommen, wie ich das gehört habe, mit einem Drittel Kinder. Also es hat mich schon sehr geschockt.
Andrea Fink:
Ja, da möchte ich vielleicht eben, wenn man hört 9000, das ist natürlich eine sehr große Anzahl, aber eben man muss wirklich sagen, dass ein großer Anteil davon einfach die Kinder sind, die eben mit diesen Familien oder in diesen Familien aufwachsen. Und da muss man natürlich sagen, Kinderarmut ist ja auch ein großes Thema und das darf man dabei wirklich nicht vergessen. Und daher ist es uns auch besonders wichtig, eben auch gerade diese weiterführende Unterstützung, Betreuung, also nicht nur die finanzielle Leistung, das ist das eine, aber eben auch die Beratung und Betreuung durch die Kolleginnen und Kollegen in der Sozialunterstützung, dann natürlich auch durch unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und natürlich auch der enge Kontakt mit dem Amt für Jugend und Familie, wenn es auch gerade da um Kinder und Jugendliche geht.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt habt ihr im allgemeinen Sozialamt mit teilweise sehr argen und harten Schicksalen zu tun. Nimmt man das mit nach Hause, wie geht ihr damit um? Härtet man da ab?
Andrea Fink:
Nein, ich glaube, man härtet da nie ab. Aber ich glaube, man findet irgendwann einen Weg, sich einmal persönlich abzugrenzen. Und natürlich, es gibt immer wieder Fälle oder Schicksale, die kann man jetzt nicht, da kann man nicht die Bürotür zumachen und sagen, vergessen, vorbei, die nimmt man mit. Aber ich glaube, man darf es nicht so dann wirklich an sich heranlassen, dass es einen selber irgendwie aus der Bahn wirft. Also man muss dann selber auch mit seinen eigenen Mitteln eben zu Hause und was auch immer man dann in der Freizeit macht, dass man sich da ein bisschen abgrenzt. Es ist automatisch auch, dass man auch länger oft an solche Schicksalsschläge dann denkt oder an solche Familien oder gerade wenn es auch um Kinder geht und man einfach versucht, über nachdenken, was gibt es vielleicht für eine Lösung, wo kann man irgendwo noch unterstützen oder auch mit anderen Institutionen, mit anderen Abteilungen.
Walter Purkarthofer:
Schicksale haben wir schon genug erlebt und begleitet, aber mir ist es auch wichtig, diese Schicksale auch Leuten zu erklären, denen es ganz gut geht und die weit weg von diesen Personen sind, dass es so etwas gibt, dass es Leute gibt, die Hilfe brauchen. Wir haben ganz, ganz viele tolle Erlebnisse auch schon gehabt, wo wir eben helfen können und wo wir die Leute aus der Armut hinaus begleitet haben.
Andrea Fink:
Ja, also es gibt auch immer wieder wirklich sehr, sehr schöne Beispiele und es freut mich auch immer ganz besonders, wenn ich dann von unseren Klienten oder von Klienten einfach mein Gott, da habt ihr uns mir jetzt wirklich geholfen oder die Kollegin oder der Kollege, der war so nett und der hat das für mich gemacht und mit mir gemacht. Also da sieht man auch dann, es kommt sehr viel zurück und das gibt einem, dass man da einfach auch immer wieder weitermacht. Das Gespräch ist oft viel wichtiger, als die Geldleistung am Ende zu machen.
Simone Koren-Wallis:
Auch in der nächsten Folge geht es mehr oder weniger ums Geld, nämlich um den Equal Pay Day. Was ist das? Das ist der Tag, an dem vollzeitarbeitende Männer bereits das Jahreseinkommen von vollzeitarbeitenden Frauen erreicht haben. Und der ist bald.
Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 28: Für Sicherheit sorgen, Strafen ausstellen und Menschenleben retten: bei GPS
Wir reden heute mit Alexander Lozinsek und Thomas Lambauer über die wohl aufregendsten und vielfältigsten Jobs in der Stadt Graz, wo man für Sicherheit sorgt, man manchmal auch Strafen ausstellt, deshalb hin und wieder auch angepöbelt wird, aber auch Menschenleben rettet: im Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice!
Intro/Simone Koren-Wallis:
Wir reden heute über die wohl aufregendsten und vielfältigsten Jobs in der Stadt Graz, wo man für Sicherheit sorgt, ja man manchmal auch Strafen ausstellt, deshalb manchmal auch angepöbelt wird, aber auch zum Beispiel Menschenleben rettet. Meine Gäste Alexander Lozinsek und Thomas Lambauer.
Alexander Lozinsek:
Mein Name ist Alexander Losinsek und ich darf das Grazer Parkraum und Sicherheitsservice leiten als Geschäftsführer und Amtsleiter.
Thomas Lambauer:
Mein Name ist Thomas Lambauer und ich darf die beiden Bereiche der Ordnungswache und Verkehrsüberwachung operativ leiten.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
GPS, viele kennen es vielleicht unter GPS und denken sich, was hat das mit der Stadt Graz zu tun? Meine Herren, wer mag von euch erklären, was GPS in der Stadt Graz ist?
Alexander Lozinsek:
GPS in der Stadt Graz steht für das Grazer Parkraum und Sicherheitsservice. Wir sind der Stadteigene Dienstleister in Sicherheitsfragen, also alles was sich um das Thema Sicherheit kümmert, sind wir für die Stadt Graz oder für das Haus Graz zuständig. Nicht hineinfällt dabei IT-Sicherheit, dafür haben wir unsere eigene IT, aber alles was mit Wehrtransport, Objektschutz, Personenschutz betrifft, eben auch die Ordnungswache, Sicherheit im öffentlichen Raum, Parkraumüberwachung, und auch die Garagen, die zwar jetzt nichts mit Sicherheit zu tun haben, aber das ist geschichtlich bedingt auch das ist in unserem Portfolio drinnen.
Simone Koren-Wallis:
Ist es eigentlich ein einfacher Job? Weil jetzt ist es ja meistens so, wenn man was überprüfen, irgendwas überwachen muss. Ja, nicht ganz so einfach, oder?
Thomas Lambauer:
Am Ende des Tages muss man da wirklich sagen, dass wir im Zuge unseres Dienstes viele Strafen auszustellen haben. Es ist auch der Job des Aufsichtsorganes selbst, diverse rechtliche Grundlagen, ortspolizeiliche Verordnungen etc. zu strafen, sofern es im Zuge einer dienstlichen Wahrnehmung auch stattfindet. Dass das für die Allermeisten jetzt nicht angenehm ist, aber nichtsdestotrotz unersetzlich und extrem sinnvoll für städtische Zusammenleben auch ist, im Endeffekt ist die andere Sache.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Leute arbeiten bei euch?
Alexander Lozinsek:
Zurzeit circa 250.
Simone Koren-Wallis:
250 und die schaffen wirklich Tag für Tag, Montag bis Sonntag, die ganze Arbeit?
Alexander Lozinsek:
Ja, die ganze Arbeit, richtig. Also wir haben in der Verkehrsüberwachung wird nur bis Samstag gearbeitet, unter Anführungszeichen, weil dort ist die Gebührenpflicht, aber der Sicherheitsdienst ist rund um die Uhr, auch in der Nacht tätig. Wir haben ja gewisse Objekte zu bewachen und zu kontrollieren, das findet von Montag bis Sonntag rund um die Uhr statt.
Simone Koren-Wallis:
Sucht ihr gerade Leute eigentlich?
Thomas Lambauer:
Also unlängst hat ein neuer Aufsichtsorgankurs begonnen, und zwar für uns erstmalig in einer Variante, in Form einer dualen Ausbildung. Also es werden gleichzeitig Aufsichtsorgane für die Verkehrsüberwachung ausgebildet und Aufsichtsorgane für die Ordnungswache ausgebildet. Dazu muss man noch dazu sagen, dass die Ordnungswache und Aufsichtsorgane auch Jugendschutzaufsichtsorgane sind, nach dem Jugendgesetz, die dann in dreifacher Art und Weise bestellt sind und den Job dann auch ausüben dürfen.
Simone Koren-Wallis:
Was heißt das genau?
Thomas Lambauer:
Also die Ordnungswache selbst und künftig auch aufgrund dieser dualen Ausbildung die Aufsichtsorgane als Sammelbegriff, dürfen, wenn sie Ordnungswache-Dienste ausüben, das Jugendgesetz kontrollieren. Also beispielsweise im Zuge einer Identitätsfeststellung wenn ein Bub oder ein Mädchen beim Rauchen erwischt wird, wenn man das so salopp formulieren darf. Das Mädchen oder der Bub ist erst 17, dann darf man das erst halt ab 18 Jahren, dann würde es unter Umständen, sofern die Aufklärung und so weiter auch nicht fruchtet, eine Anzeige nach dem Jugendgesetz geben und wir sind da sehr umtriebig, wir legen da auch sehr viel Wert auf den Jugendschutz, auf das Jugendgesetz und das ist ein Steckenpferd von uns, auf das wir auch stolz sind.
Simone Koren-Wallis:
Aber das heißt, wenn mich das jetzt interessiert und jemand aus Graz hört gerade den Podcast, dann denkt sie, da könnte ich mir das mal vorstellen, dass ich dieser Arbeit nachgehe. Kann man sich bewerben?
Alexander Lozinsek:
Man kann sich regelmäßig bewerben, es gibt die Möglichkeit der Initiativbewerbung auf unserer Homepage, aber wir haben auch schon einen neuen Kurs für das kommende Jahr ausgeschrieben, also voraussichtlich wird der im Jänner stattfinden. Das heißt, wir suchen auch schon für den Jänner-Termin wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in vielen Bereichen nicht nur als Aufsichtsorgane, sondern auch für den Revierdienst und für die Fahrscheinkontrolle, also fast in fast allen Bereichen haben wir derzeit ein bisschen einen Mitarbeitermangel.
Simone Koren-Wallis:
Wir sind ja da in der Nähe von der Messe, wo wir diesen Podcast auch aufnehmen, also direkt in der GPS-Zentrale. Gerade vorne habe ich auch einige Kolleg:innen getroffen, die wahrscheinlich gerade vom Dienst gekommen sind. Ist es eigentlich so, dass dann am Ende des Tages ganz viele Geschichten ausgetauscht werden und ganz viel erzählt wird? Weil so in der Richtung, das was ich erlebt, das was du erlebt, wie läuft denn das ab?
Thomas Lambauer:
Ich glaube, das ist das Spannende an diesem Job. Also ganz egal, in welcher Art und Weise man diesen dann auch ausübt, sowohl bei der Verkehrswoche als auch bei der Ordnungswache, da erlebt man immer etwas Neues. Da ist wirklich kein Tag wieder wie der andere und das muss man auch ganz klar dazu sagen, man erlebt auch viele positive Dinge, wie wollen wir die, die negativen Dinge natürlich auch nicht verheimlichen darf. Und ja, da ist durchaus das ein oder andere Schmankerl, was die Kolleginnen und Kollegen draußen im Zuge des Außendienstes erleben, mit Sicherheit immer dabei und das tagtäglich.
Simone Koren-Wallis:
Ist euch eines da irgendwie besonders hängen geblieben? Habt ihr eine Geschichte auf Lager.
Thomas Lambauer:
Also im Grunde genommen, Schmankerl treten viele auf im Laufe der Jahre, aber mit Sicherheit keine alltäglichen. Aber dann doch Dinge, die vorkommen, waren beispielsweise ein Auto mit angelaufenen Scheiben, das gerumpelt hat oder auch eine Dame, die mit Paarmantel bekleidet noch vom Fenster runtergerufen hat, ich löse schon einen Parkschein und dann halbnackt hinunter zum Auto läuft, dass es sich dann doch noch ausgegangen ist, dass man keine Strafe bezahlen muss. Also das sind so Dinge, es gibt nichts, was es nicht gibt im Zuge des Außendienstes. Da kommt einfach sehr vieles im Laufe der Zeit halt vor.
Alexander Lozinsek:
Das ist der Alltag, also die Leute, man muss sich eins bedenken, die sind ja permanent unterwegs und jetzt kommen sehr viele negative Erlebnisse und nicht nur negative Erlebnisse im Sinne von einem negativen Bürgerkontakt. Wir haben Mitarbeiter gehabt, die natürlich draußen gerade vorbeigegangen sind, wie die Bank überfallen worden ist und es zu einem Schusswechsel gekommen ist. Wir haben Mitarbeiter gehabt, die die Messerstecherei in den Straßenbahnen mitbeobachtet haben und den dann verfolgt haben, das es dann zur Verhaftung geführt hat. Das sind jetzt auch nicht die lustigen Geschichten, das sind Geschichten, wo wir auch, ich weiß nicht, leider Gottes oder Gott sei Dank, wie man es auch sehen mag, regelmäßig reanimieren müssen auf der Straße. Unsere Leute sind ja alle in der Erste Hilfe auch ausgebildet und machen auch entsprechende Updates, sind ja auch verpflichtet, wie alle anderen Bürger dann sofort zu helfen und das sind die Ersten, die helfen. Wir haben erst vor gar nicht allzu langer Zeit die Rathauswache mit einem Defi(brillator) am Hauptplatz, also beim letzten Mal war es leider zu spät, aber beim vorletzten Mal hat es geholfen und da haben wir einen retten können. Also das sind die Dinge, die wirklich bei uns schon so oft vorkommen unter Anführungszeichen, dass man sagt, das ist, das hat eine gewisse Regelmäßigkeit. Das, was der Thomas erzählt hat mit dem Fahrzeug, das rumpelt und die Scheiben angelaufen sind, das sind dann halt wirklich die wirklich witzigen Schmankerln.
Simone Koren-Wallis:
Kann man, wenn man jetzt vielleicht wirklich gut hinkommt, wenn eine Strafe geschrieben wird, zum Beispiel beim Parken, nehmen wir das Beispiel Parken her, kann man das dann irgendwie umgehen und bitten und betteln und so, bitte nicht und wenn man ganz lieb fragt oder müsste ich ja durchziehen oder ist das eine blöde Frage?
Thomas Lambauer:
Nein, es ist überhaupt keine blöde Frage, das ist sogar, das ist der Wunsch oder unser Auftrag, letzten Endes auch, also wenn ein Lenker oder ein Lenker in Kontakt möglich ist, das ist es ja nicht immer, wenn man Autos kontrolliert, dann immer eine Aufklärung in erster Linie, dass das Ziel ist. Da kommt es durchaus recht häufig vor, dass das Aufsichtsorgan eben sagt, das und das gehört so gemacht, das hat jetzt nicht gepasst, bitte machen Sie das das nächste Mal dementsprechend besser und die Sache ist damit erledigt, ohne dass eine Strafe ausgestellt wird. Das ist immer da der erste Weg, sofern ein Kontakt möglich ist und in der Regel funktioniert das auch. Du musst mir aber auch ganz ehrlich sagen, das funktioniert nicht immer, die Einsicht ist auch nicht immer da, dann wird dann sehr wohl auch die Strafe ausgestellt, aber beim Reden kommt man zu Leuten zusammen, wenn man so schön sagt. Im Regelfall ist es dann so, dass es bei einer Ermahnung belassen wird.
Alexander Lozinsek:
Ich darf vielleicht ergänzen, das ist auch ganz wichtig, wir werden ja dann in dem Fall sehr oft mit der Polizei verglichen, wo man dann uns sagt, die haben dann die Möglichkeit den Zettel zu nehmen und ihn sozusagen wegzuwerfen, die Möglichkeit haben unsere Aufsichtsorgane nicht. Die sind mit einem elektronischen Datenerfassungsgerät unterwegs und in dem Moment, wo dieses Mandat bereits erstellt wurde, ist es im System und das Aufsichtsorgan, selbst wenn es wollte, kann es nicht mehr löschen. Das heißt, selbst dann, wenn man sozusagen zu spät kommt, zwar das Aufsichtsorgan noch antrifft, aber das bereits erstellt ist, ist es unmöglich für das Aufsichtsorgan dieses Mandat zu löschen und daher bitte ich wirklich um Verständnis, dass es dann auch nicht möglich ist, sondern man dann zur Behörde gehen muss und vorstellig werden muss, beziehungsweise wenn man der Meinung ist, dass es jetzt nicht zu Recht ist, gibt es ja ohnedies den Rechtsweg. Ich möchte in dem Zusammenhang schon auch die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass die Organe der öffentlichen Aufsicht sind, Beamte im Dienst sind und all diesen Rechten und Pflichten unterliegen und auch den Rechtsschutzvorschriften. Das heißt, einen Beamten zu beleidigen, kann hohe Strafen mit sich ziehen. Einen Beamten anzugreifen ist, wie wenn man einen Polizisten angreift, das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt. Eine leichte Körperverletzung wird zu einer schweren Körperverletzung. Das ist vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht bewusst, wenn sie sich sozusagen über eine 24- oder 25-Euro-Strafe furchtbar aufregen und dann die Dämme brechen und man den Aufsichtsorgan beschimpft oder gar angreift. Das wird von der Justiz auch verfolgt und wir sind auch dahinter, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zumindest dort, wo es handgreiflich wird, auch zu unterstützen. Verbal müssen sie vieles anhören, das würde zu weit führen.
Simone Koren-Wallis:
Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Alexander Lozinsek:
Ich würde mir schon wünschen, dass generell die Stellung des Aufsichtsorgans in der Bevölkerung so gesehen wird, wie sie wirklich ist. Also das, was man oft zu tun hat mit diesen negativen Einstellungen, dass die bei der Ordnungswache sind nur verhinderte Polizisten, was ja völliger Unsinn ist oder die in der Parkraumüberwachung, das sind irgendwelche Privat-Sheriffs, was völliger Unsinn ist alles. Man sollte diese verantwortungsvolle und sehr herausfordernde Aufgabe so sehen, wie sie ist.
Ich würde mir einen besseren Kollektivvertrag wünschen für meine Mitarbeiter:innen, sage ich auch ganz offen, weil sie leisten sehr, sehr viel. Sie sind bei jedem Wetter draußen, sie haben sehr viele, leider Gottes, auch negative Kontakte, mit denen sie umgehen müssen, können. Das ist zum Teil durchaus belastend und sie müssen richtig agieren.
Also sie verteilen ja keine Prospekte, sondern das sind ja Organmandate und da kann man relativ schnell in der Amtshoffnung sein, wenn man da nicht ordentlich und sorgfältig arbeitet.
Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge erfahren wir alles über die Sozialunterstützung der Stadt Graz.
Wer darf da überhaupt ansuchen und wie funktioniert das überhaupt? Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 27: Seelische Gesundheit Teil 2
Weiter geht's mit dem Thema "Seelische Gesundheit", dieses Mal mit der Psychotherapeutin Ingrid Jagiello und dem Psychologen Detlef Scheiber: Warum braucht es eigentlich einen eigenen Tag dafür und wo gehe ich hin, wenn ich merke, dass es meiner Seele nicht gut geht? Außerdem haben wir noch interessante Veranstaltungstipps.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Weiter geht's mit dem zweiten Teil zur seelischen Gesundheit. Warum braucht es eigentlich einen eigenen Tag dafür? Und wo gehe ich hin, wenn ich merke, dass es meiner Seele nicht gut geht? Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste, Ingrid Jagiello und Detlef Scheiber.
Jingle
Ingrid Jagiello:
Mein Name ist Ingrid Jagiello. Ich bin die Vorsitzende des Steirischen Landesverbandes für Psychotherapie. Und ich freue mich, dass ich mit Ihnen und mit meinem Kollegen, dem Detlef Scheiber, dieses Gespräch führen darf.
Detlef Scheiber:
Mein Name ist Detlef Scheiber. Ich bin im Landesleitungsteam des Berufsverbands der österreichischen Psychologinnen.
Simone Koren-Wallis:
Wir haben in der ersten Folge schon sehr, sehr viel über seelische Gesundheit gehört. Jetzt würde ich von Ihnen beiden gern wissen, wie definieren Sie seelische Gesundheit? Was ist seelische Gesundheit für Sie beide?
Ingrid Jagiello:
Seelische Gesundheit ist dann, wenn ein Wohlbefinden sich breitmacht, wenn ich meinen Alltag bewältigen kann ohne große Probleme, wenn ich gute soziale Kontakte halten kann und wenn ich mit meinem Leben zufrieden bin.
Detlef Scheiber:
Seelische Gesundheit hat sehr viel mit Wohlbefinden zu tun. Und es geht um verschiedene Lebensbereiche. Es geht um Sozialkontakte. Also Sozialkontakte sollten gelungen sein und befriedigend sein. Arbeitsplatz ist wichtig. Also am Arbeitsplatz sollte man einen Sinn sehen in seiner Arbeit. Familie, Sexualität, aber auch die körperliche Gesundheit, weil da gibt es einen ganz engen Zusammenhang zwischen körperlicher und psychischer Gesundheit.
Simone Koren-Wallis:
Der Dr. Zeder hat gesagt, es wäre einmal wichtig, wenn jeder von uns fünf Minuten glücklich wäre am Tag. Das klingt irgendwie so einfach. Ist es das?
Ingrid Jagiello:
Bevor wir in den Zustand des Glücklichsein kommen, wäre ein erstrebenswerter Zustand die Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist gut zu erlangen, wenn wir, wie besprochen, all diese Aspekte in unserem Leben erfahren können. Familie, positive Beziehungen und so weiter und so fort. Daran können wir ganz aktiv arbeiten mit unseren Patientinnen. Und dann darüber hinaus kann sich der Zustand des Glücklichsein einstellen.
Detlef Scheiber:
Ich hätte es nicht schöner sagen können. Für mich ist auch die Zufriedenheit eigentlich das, was man eher erreichen kann. Wenn es dann Glück wird, dann haben wir Glück gehabt.
Simone Koren-Wallis:
Das ist ein schöner Satz, der gefällt mir. Aber jetzt lächeln wir alle drei. Ist das schon der Start? Einfach einmal zu lächeln und jetzt zu sagen, hä? Genau.
Detlef Scheiber:
Das ist ganz sicher der Start. Das weiß man zum Beispiel auch. Diese Gesichtsmimik des Lächelns wirkt sich positiv aus. Das ist neuronal einfach genau so geschaltet bei uns im Gehirn, dass genau diese Mimik, wenn wir die haben, sich schon auf unsere Stimmung positiv auswirkt.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt gibt es ja diesen Tag der psychischen Gesundheit auch. Wieso ist so ein Tag so wichtig?
Ingrid Jagiello:
Noch immer stellen wir fest, dass in unserer Gesellschaft psychische Erkrankungen stigmatisiert werden. Und dieser Tag, der 1992 von der WHO ins Leben gerufen wurde, ist besonders wichtig für Menschen, die psychisch erkrankt sind, weil sie genauso Teil unserer Gesellschaft sind und wir diese Leute nicht ausschließen dürfen, sondern all die Angebote, die wir machen können, um sie zu unterstützen, offensichtlich machen müssen. Und der Tag der seelischen Gesundheit mit all den Werbeeinschaltungen, mit all den Vernetzungen ist extrem wichtig, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir die seelischen Erkrankungen genauso zu behandeln und denen zu begegnen haben, die somatischen, das heißt körperlichen Erkrankungen.
Detlef Scheiber:
Es geht mir aber auch ein bisschen darum, über die Krankheitsbilder und über die Zustände der Personen, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind, zu informieren, weil viele ja genau damit nicht umgehen können. Da gibt es eine Diagnose und die ist dann was Schreckliches. Und das führt dann, weil es ja viele Vorurteile gibt, das führt dann sehr oft dazu, dass das schambehaftend ist, dass die Leute einerseits ausgegrenzt werden, aber sich selber auch ausgrenzen und Angst davor haben, sich zu öffnen. Und dem soll der Tag der seelischen Gesundheit auch ein bisschen entgegenwirken. Psychische Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Und wir können, wenn es die psychische Gesundheit nicht gibt, wenn es eine psychische Erkrankung gibt, können wir was dagegen machen. Und es gibt Krankheitsbilder, wo ganz, ganz gut therapeutisch gearbeitet werden kann, das den Leuten auch zu sagen, es ist eine Erkrankung, wie jede andere auch und sollte auch so behandelt werden.
Ingrid Jagiello:
Ein wichtiger Punkt ist noch die Stigmatisierung in der Schule. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ganz vorzeitig mit präventiven Maßnahmen beginnen. Die Schulpsychologie und die psychotherapeutischen Unterstützungen für die Schule sind hier ganz, ganz wesentlich. Denn psychische Erkrankungen zu erkennen, das ist nicht leicht. Und Patienten, die erkrankt sind, die machen oft ein sogenanntes Doktor-Jogging, gehen von Arzt zu Arzt, bis endlich einmal erkannt wird, dass eine psychische Erkrankung im Hintergrund ist.
Simone Koren-Wallis:
Aber beginnt das schon im Kindesalter in der Schule?
Ingrid Jagiello:
Manchmal, natürlich, manchmal schon. Viele Kinder sind aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen oft schwer traumatisiert. Und es wird leider oft nicht erkannt. Und darum ist es auch ganz, ganz wichtig, diese frühen Hilfen so früh wie möglich zu initiieren.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Menschen brauchen eine Behandlung?
Ingrid Jagiello:
39 Prozent in Österreich.
Detlef Scheiber:
39 Prozent geht man davon aus.
Ingrid Jagiello:
Im Erwachsenenbereich, bei den Kindern ist es noch höher.
Simone Koren-Wallis:
Bei den Kindern ist es höher?
Ingrid Jagiello:
Ja, selbstverständlich.
Detlef Scheiber:
Diese 39 Prozent ist eine Zahl vor Corona. Ja. Diese Erhebung wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Da sind die Effekte, die wir durch Corona gehabt haben, noch gar nicht dabei. Und man geht davon aus, dass zwischen einem Drittel und zwei Drittel aller Berufsunfähigkeitspensionen auf psychische Erkrankungen zurückzuführen sind. Und von den Krankenständen her, Arbeitsunfähigkeit, sind auch psychische Erkrankungen eine der häufigsten Ursachen.
Ingrid Jagiello:
Bei den Jugendlichen haben wir Zahlen. Da gibt es diese Donau-Universität Krems, diese Studie. Die ist aber schon jetzt zwei Jahre alt. Und da haben wir gesehen, dass die Zunahme an Depressionen mehr als die Hälfte gestiegen ist, dass die Angsterkrankungen gestiegen sind.
Detlef Scheiber:
Essstörungen.
Ingrid Jagiello:
Essstörungen, ja. Und nicht nur bei Mädchen, sondern vor allem bei den Burschen, die ja lange nicht erkannt worden sind. Also den Kindern und Jugendlichen geht es wirklich schlecht.
Simone Koren-Wallis:
Aber jetzt ist ja so, jetzt macht die Stadt Graz eben diese Kampagne zur seelischen Gesundheit. Wir haben auch auf Graz.at Seelische Gesundheit ganz, ganz wichtige Anlaufstellen zusammengefasst. Also Selbsthilfegruppen, natürlich auch die Berufsverbände. Nur jetzt denke ich mir, jetzt gehe ich mal hinein in einen, der vielleicht schon verstanden hat, hey, ich bin seelisch vielleicht nicht gesund. Dann sehe ich vielleicht auf Graz.at Seelische Gesundheit diese Anlaufstellen. Wo geh ich als erstes hin?
Ingrid Jagiello:
Also wenn ich wirklich in einer absoluten Krisensituation bin, dann gibt es seit Herbst des vorigen Jahres dieses sogenannte Krisentelefon. Und da kann ich mich hinwenden. Dort sitzen Professionisten, die mir Auskunft geben. Zum Beispiel über klinische psychologische Behandlung, über die Möglichkeit, eine psychotherapeutische Behandlung in Angriff zu nehmen. Oder wenn es niederschwelliger ist, zum Beispiel ein Angebot von der Achterbahn in Anspruch zu nehmen. Es gibt über den Gesundheitsfonds auch eine Broschüre, wo alle Anbieter aufgelistet sind. Und die kann man über die Homepage des Gesundheitsfonds auch abrufen. Und jede Berufsgruppe hat auch, zum Beispiel der Steirische Landesverband für Psychotherapie, wir haben eine Infostelle, wo Patienten sich direkt an uns wenden können und Informationen über Psychotherapie oder auch über freie Psychotherapieplätze erhalten können.
Detlef Scheiber:
Also das eine, was die Kollegin sagt, sind eben Institutionen, wo Leute sich hinwenden können. Und die Berufsverbände, wir vertreten ja die Berufsgruppen und insbesondere Psychologinnen und Psychologen und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die in freier Praxis auch arbeiten. Und da gibt es eben auch bei den Psychotherapeuten und auch bei uns Psychologinnen Anlaufstellen oder bei uns ist es in Wirklichkeit eine Suchmaschine im Internet, Psych.net, wo man dann Kolleginnen und Kollegen finden kann.
Simone Koren-Wallis:
Aber ist trotzdem der erste Schritt, dieser schwere Schritt, ich muss zum Seeleklempner oder ich muss zum Seelendoktor. Ist es wirklich noch so schlimm in unserer Gesellschaft, dass man sich vielleicht sogar schwer tut, Hilfe zu suchen?
Ingrid Jagiello:
Es ist deutlich besser als vor 15 Jahren, kann ich Ihnen sagen. Es ist ganz viel Aufklärungsarbeit und Informationsarbeit geschehen. Und ich kann Ihnen sagen, dass das heute nicht mehr so ist, dass die Leute mit einer großen Scheu in die Praxis kommen, sondern viele stehen dazu, viele geben auch weiter, dass ihnen Psychotherapie gut getan hat, motivieren auch andere, kriegen einen anderen Blickwinkel, wenn sie selbst erfahren haben, dass es tatsächlich Hilfe gegeben hat. Also ich merke eine große Veränderung in unserer Gesellschaft, wenn gleich noch viel an Aufklärungsarbeit zu tun ist.
Detlef Scheiber:
Also ob gleich professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden muss oder nicht, ist eine schwierige Frage, weil es wirklich vom Einzelfall abhängt. Also es gibt sicher Krisen, wo es ausreicht, ein gutes psychosoziales Netz zu haben, wo man mit Freundinnen, wo man mit Verwandten, mit Ehepartnern, mit wem auch immer zuerst ins Gespräch kommt. Und wenn sich aber herausstellt, es ist mehr als einfach eine kurze Verstimmung oder durch ein Lebensereignis ausgelöste Krise, dann ist es sicher sinnvoll, sich professionelle Hilfe zu suchen. Und wie gesagt, auf der Homepage der Stadt Graz findet man die Adressentelefonnummern, Internetseiten, wo man Hilfe findet.
Simone Koren-Wallis:
Abschließend noch eine Einladung, denn die Stadt Graz macht mit Ihnen beiden, mit den Verbänden eine ganz super tolle Geschichte. Aber vielleicht erzählen Sie es kurz selber.
Detlef Scheiber:
Seit einigen Jahren haben wir die Zusammenarbeit schon, also zwischen unseren beiden Berufsgruppen und auch mit der Stadt Graz und machen jährlich zum Tag der seelischen Gesundheit eine Kinoveranstaltung, die für alle offen ist, eine Gratis-Kinoveranstaltung, wo ein Film gezeigt wird, der das Thema psychische Erkrankung oder psychische Gesundheit zum Thema hat. Heuer wird es sein, am 11. Oktober im Kiz Royal, gezeigt wird der Film Empire of Light, ich verrate nicht mehr, mit anschließender Podiumsdiskussion, wo wir in diesem Jahr Leute einladen, die zum Thema psychische Gesundheit und Arbeit etwas zu sagen haben. 11. Oktober, 18.30 Uhr, Kiz Royal.
Ingrid Jagiello:
Und eine weitere Veranstaltung gemeinsam mit der Stadt Graz ist am 24. Oktober, da lädt die Stadt Graz alle Anbieter ein in der Arbeiterkammer, dafür kann jeder seinen Stand aufstellen, die Leute können direkt in Kontakt gehen mit uns, sie können Fragen stellen, wir stellen Folder zur Verfügung, wir vernetzen uns auch untereinander. Es ist eine ganz wichtige Informationsveranstaltung für uns als Berufsgruppen, aber auch direkt für die Menschen, die von der Straße zu uns zu dieser Veranstaltung kommen. Ich lade dazu herzlich ein.
Simone Koren-Wallis:
Du bist nicht allein. Alle Infos gibt es nochmal zusammengefasst auf graz.at/seelischegesundheit.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 26: Seelische Gesundheit Teil 1
Reden wir über unsere seelische Gesundheit. Für manche ist das noch immer ein Tabuthema. Das muss sich ändern. Denn psychische Erkrankungen gehen uns alle an und sie können wirklich jeden treffen. Im 1. Teil gibt Ulf Zeder, Referatsleiter für Sozialmedizin im Gesundheitsamt, interessante Einblicke und auch leicht umsetzbare Tipps, wie wir auch anderen was Gutes tun können.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Ja, es ist ein Tabuthema, aber wir reden heute drüber, nämlich über die seelische Gesundheit. Denn psychische Erkrankungen gehen uns alle an und sie können wirklich jeden treffen. Ich bin Simone Koren-Walis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Ulf Zeder.
Ulf Zeder:
Mein Name ist Ulf Zeder, ich bin Psychologe und Psychotherapeut und arbeite hier im städtischen Gesundheitsamt seit 20 Jahren plus schon.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Wenn man jetzt hört, dass jemand krank ist, denkt man sofort an Fieber, Halsweh, Kopfweh, vielleicht sogar an eine Magen-Darm-Infektion. Aber, und genau das ist der springende Punkt, es gibt noch so, so vieles mehr. Wir reden heute über die seelische Gesundheit, also auch um psychische Erkrankungen.
Lieber Herr Dr. Zeder, warum werden die in unserer Gesellschaft, egal ob es jetzt bei uns in Graz, in der Steiermark, in Österreich, noch immer nicht als Krankheit anerkannt?
Ulf Zeder:
Weil wir ganz schnell darin sind, Krankheiten als körperliche Krankheiten sofort zu begreifen. Und vergessen wir nicht, dass körperliche Krankheiten immer schon da waren, da hat man immer schön jammern können, aber seelische Erkrankungen, psychische Erkrankungen waren es schon ziemlich lange und sind es teilweise noch immer relativ tabuisiert auch. Ich kann mich erinnern, so viele Jahrzehnte ist es nicht her, wenn jemand gesagt hat, ich gehe zu Psychologen, war eigentlich die Reaktion, jemand meinte, er muss einen Tuscher haben.
Dass man das zum Beispiel präventiv machen kann oder weil man auf sich achtet und gut im Gleichgewicht zu bleiben, war völlig unvorstellbar. Sondern entweder hört man Stimmen, dann braucht man einen Psychologen oder man ist gesund, dann braucht man vielleicht einen normalen Arzt, wenn man mal Grippe bekommt. Das hat sich aber deutlich gewandelt in den letzten Jahren auch.
Also die Bereitschaft, über gewisse Sachen zu sprechen, hat zugenommen. Ob das jetzt Depressionen sind oder andere Gemütsverfassungen, man darf darüber reden, es wird darüber reden und es wird auch mehr Hilfe in Anspruch genommen.
Simone Koren-Wallis:
Was gehört alles dazu zur seelischen Gesundheit? Welche psychischen Erkrankungen gibt es eigentlich?
Ulf Zeder:
Es gibt so viele psychische Erkrankungen, dass die Bücher, die die Diagnostik darstellen, sich vervierfacht haben vom Volumen in den letzten Jahrzehnten. Aber um das vielleicht ein bisschen dingfester zu machen, denken wir zum Beispiel an Alkoholkranke. Jetzt kann man darüber reden, ist es jetzt reiner psychische Erkrankung oder eine körperliche? Die meisten sind ja immer sowohl als auch. Denken wir an Angststörungen. Ungefähr 10% der Menschen hier in Österreich, auch hier in Graz, haben eine Angststörung. Wie stark die jetzt ausgeprägt ist, steht da von anderem Blatt Papier. 5% der Menschen sind depressiv. Im Laufe ihres Lebens hat jeder Dritte irgendwann eine eigentlich behandlungswürdige depressive Episode hinter sich gebracht.
Simone Koren-Wallis:
Jeder Dritte?
Ulf Zeder:
Jeder Dritte im Laufe seines Lebens.
Simone Koren-Wallis:
Diese depressiven Phasen, wie erkenne ich die selbst an mir?
Ulf Zeder:
Meistens viel zu spät. Meistens sind es richtige Symptome, wo man sagt, so geht es nicht weiter. Ich fühle mich schlecht. Ich komme kaum aus dem Bett. Ich bin lustlos. Ich mag keinen Sex mehr haben. Mir freut es eigentlich gar nichts. Das ist ja nicht die erste Stufe einer Depression. Dann ist es ja schon meistens relativ fortgeschritten. Weil, was wir in Österreich nicht so gelernt haben, ist, sich seinen eigenen Gefühlen immer wieder auch bewusst zu werden. Sondern wenn etwas Negatives am Horizont erscheint, dann schauen wir lieber schnell weg. Anstatt zu sagen, da taucht vielleicht etwas auf, wo ich rechtzeitig ansetzen könnte, dem entgegenzutreten und auch zu bekämpfen, warten wir immer viel zu lang. Was wir bei anderen körperlichen Krankheiten tendenziell auch machen.
Simone Koren-Wallis:
Dass wir nicht zum Arzt gehen, sozusagen.
Ulf Zeder:
Ja, Männer vor allem sind prädestiniert dafür. Die muss schon die Beulenpest richtig ausbrechen, dass man sich irgendwo hinbewegt. Aber im Allgemeinen ist es bei psychischen Erkrankungen noch langweiliger, bis die Leute einsichtig werden. Hey, da stimmt was nicht. Ich komme nicht zurecht. Ich brauche Hilfe. Und was da am schlechtesten ist natürlich, wenn man aus der Umgebung Ratschläge bekommt, wie reist ihr zusammen. Das geht eh vorbei und tu nicht so.
Simone Koren-Wallis:
Ist es dann oft jemand aus dem Umfeld, der sagt, hey bitte, lass da helfen?
Ulf Zeder:
Bei vielen Sachen sieht man das anders. Bei Suchterkrankungen auch wird ja oft immer noch als moralisches Fehlverhalten angesehen. Ist selber schuld, wenn er zum Saufen angefangen hat. Bei einer körperlichen Erkrankung sagt niemand nur, ist selber schuld, wenn du gerade den Haxen gebrochen hast, sondern tu auch was dagegen, geh zum Arzt. Da wird ja sinnvoll weitergeleitet. Bei anderen Sachen nicht unbedingt, weil man ist ja selber schuld. Oder man soll eben nicht so wehleidig sein im Leben. Und das Leben ist kein Ponyhof, reiß dich zusammen. Da ignorieren wir ja das Seelenleben des Gegenübers. Wir wissen ja gar nicht, wie schlimm es für ihn ist, wie tief er drinsteckt. Sondern tun so als wäre es ist eine leichte Sommergrippe, die bald einmal vorbeigeht und man möge sich nicht so anstellen. Ich glaube, da sind deutliche Unterschiede erkennbar.
Simone Koren-Wallis:
Wie ist da die Dunkelziffer dann?
Ulf Zeder:
Das weiß niemand. Bei Depressionen wissen wir es in etwa. Aber bei vielen Sachen wissen wir es nicht. Je tabuisierter etwas ist, desto eher rückt man nicht damit raus.
Stellen Sie sich so einfach vor, Sie hätten wie an einem Keyboard mehrere Regler, die alle in irgendeinem Bereich am besten aufgehoben werden. Sei es die Stimmung oder den Bewegungsdrang oder wie viel man schläft, welche Gedanken man so hat. Und wenn diese Pegel halbwegs gut eingestellt sind, nennt man das ein normaler Mensch.
Wenn jetzt ein paar Pegel völlig überdreht sind, dann ist man meistens schon in einem psychischen Bereich drin, wo man nicht mehr gesund ist. Es müssen jetzt nicht unbedingt Sachen sein, die immer nur so nach Depression klingen, sondern auch wenn jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat und sich großartig vorkommt und wird man auch bei ihm dann irgendwelche Regler vorfinden können, wenn man ganz genau hinschaut, wo man merkt, die sind außerhalb der Norm. Das heißt, wir haben einen gewissen Bereich, wo Abweichungen absolut möglich sind und einfach menschlich sind. Und gewisse Bereiche, wenn sie zu hoch oder zu wenig ausschlagen, reden wir über psychische Gesundheit. In einem negativen Sinn, nämlich die Leute sind dann erkrankt.
Simone Koren-Wallis:
Aber wie kommt man wieder raus?
Ulf Zeder:
Bei gewissen Sachen gar nicht. Also wenn jetzt jemand, um bei dem Thema zu bleiben, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, wird er es vermutlich sein Leben lang auch haben. Andere Sachen wiederum, die weniger, sag ich mal, unter Anführungszeichen als Charakter gelten, sondern hinzugekommen sind, wie zum Beispiel, ich war früher fröhlich und jetzt bin ich so niedergeschlagen. Diese Sachen sind auch leichter zu beheben, weil es immer schon auch eine andere Normalität irgendwann gegeben hat. Zu dem kann man dann auch zurückkehren. Aber jemand, der von sich nur überzeugt ist, der Größte zu sein, obwohl in Wirklichkeit eigentlich eher ein kleines Scheißerl ist, der wird so bleiben.
Simone Koren-Wallis:
Was macht jetzt die Stadt Graz für Leute, die dann schon erkannt haben oder denen gezeigt worden ist, dass sie vielleicht Hilfe brauchen?
Ulf Zeder:
Also die Stadt Graz kann diese Menschen nicht heilen, aber sie kann sich dafür zuständig fühlen, darauf aufmerksam zu machen, dass es in dem Sinn unter Anführungszeichen normal ist. Sprich, man steht nicht ganz alleine damit und die Leute ermutigen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Stadt Graz kann auch dafür sorgen, dass bei vielen Menschen gewisse psychische Krankheiten gar nicht ausbrechen müssen, zumindest nicht in der Intensität, indem sie zum Beispiel sagt, na, was tut denn ein Mensch eigentlich gut? Ob das jetzt ein Kleinkind ist oder wir in unserem mittleren Alter oder alte Leute, jeder hätte gern Zeit, Zuwendung und Zärtlichkeit von seiner Außenwelt. Sprich, ich bin was wert, man hört mir zu, man nimmt mich in den Arm, wenn es nicht gut geht.
Und eine Stadt kann sich schon auch so aufstellen, dass Anonymität und Isolation nicht gefördert wird, sondern das Gegenteil unternommen wird, Menschen zusammenzubringen. Wir wissen ja auch aus der Glücksforschung, wenn Menschen Zuspruch haben, ein paar Freund haben, dass es unheimlich hilfreich ist, gut durchs Leben zu kommen. Und die Stadt Graz kann auch schauen, dass Sachen, die psychisch sowieso belastend sind, wie Armut beispielsweise oder Obdachlosigkeit, das ist nicht gesund, dass man da irgendwelche Angebote setzt, um das wieder zu lindern. Also die Stadt Graz kann vieles tun, aufs Einzelindividuum bezogen natürlich nicht. Wir sind nicht da angestellte Ärzte, 5.000 Stück im Magistrat, aber die anderen Umgebungsvariablen, die können wir schon auch ein bisschen drehen.
Simone Koren-Wallis:
Aber kann man jetzt im Notfall, wenn ich sage, ich weiß nicht wohin, kann ich jetzt sagen, ich komme ins Gesundheitsamt oder ich rufe einmal an?
Ulf Zeder:
Wir können vermitteln, wir können ermutigen, wir können die Karten austeilen, wir können natürlich auch, wenn jemand bei uns anruft, Tipps geben, wohin man sich wenden kann. Was jetzt zugenommen hat und zwar rasant in den letzten Jahrzehnten, ist ja grundsätzlich der Druck, der auf Menschen lastet, auch das Tempo, wie Sachen erledigt werden sollen, auch die Erwartungshaltungen der Umwelt, die man an sich selbst hat und auch die Isolation und Anonymität. Also es sind viele Faktoren zusammengekommen, die uns eigentlich nicht wirklich gut tun.
Simone Koren-Wallis:
Wie kann man das ändern?
Ulf Zeder:
Wenn jemand sich gesund ernährt, sich bewegt, versucht positiv zu denken, genug Schlaf hat etc., ist einem relativ viel gewonnen. Und wenn es nur eine volle Badewanne ist für eine halbe Stunde, Ruhe- und Erholungsräume sind dringend geboten. Und mit Ruhe und Erholung meine ich nicht, dass man sich vom Fernseher sitzt und Netflix schaut stundenlang. Das mag schon lustig sein, mag schon ablenkend sein, aber es gibt keinen Flow drinnen. Also ich baue meine Seelenstärke nicht auf.
Simone Koren-Wallis:
Wenn es jetzt jemand gehört hat, der sich vielleicht allein durch unser Gespräch ein bisschen ertappt, ist das falsche Wort. Einfach denkt, vielleicht sprechen die über mich. Was würden Sie so einem Menschen raten? Was soll er tun?
Ulf Zeder:
Was er tun soll, kann ich nicht bestimmen. Was anzuraten wäre, wäre ja, fast jeder hat heutzutage ein Handy und weiß, wie das Internet funktioniert. Es gibt schon relativ gute Portale, auch online, wo Diagnostik gut betrieben wird, wo machbare Tipps auch ausgegeben werden, wo es Kontaktadressen gibt. Das heißt, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Das heißt, wenn ich merke, ich schlitte ein eigenes Unwohlsein schon langsam rein oder ich stehe jetzt gerade wo, wo ich sonst nie gestanden bin, dass man das nicht lapidar abtut nach dem Motto, wird schon wieder, weil manche Sachen werden nicht einfach von allein wieder. Und da genauer hinschauen.
Simone Koren-Wallis:
Und es gibt aber auf graz.at/seelischegesundheit auch ganz, ganz viele Anlaufstellen, wo man gleich raufschauen kann, wo das alles gebündelt ist, um zu sagen, hey, aber dann ist natürlich noch die Geschichte, ich muss es tun.
Ulf Zeder:
Ich muss es tun und manche haben dann schon einen Leidensdruck, wenn sie endlich merken, ich muss was tun. Und da ist es natürlich der absolute Antiklimax, wenn es heißt, schön, dass Sie angerufen haben, ich hätte im November dann einen Termin für Sie. Also Hilfe müssen schneller gehen, weil auch im körperlichen Bereich wird ja kaum jemand sagen, ah ja, der Haxen ist gebrochen, humpel halt noch drei Monate herum, dann bekommen Sie einen Liegegips.
Simone Koren-Wallis:
Was wünschen Sie sich von der Menschheit, das sich in Bezug auf die seelische Gesundheit ändert?
Ulf Zeder:
Dass wir es weiter enttabuisieren und dass wir vielleicht überlegen, ob nicht jeder, jede für sich auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass es den Menschen insgesamt besser geht, zum Beispiel einfach eine gewisse Freundlichkeit. Ich sage Ihnen zum Beispiel ein Beispiel. Wenn ich in einem Geschäft bin und jemand bedient mich sehr nett, bin ich erstens mal froh, nett bedient geworden zu sein, aber oft hole ich dann den Geschäftsführer. Zuerst sind dann meistens die Frauen, die mich bedient haben, oder Herren. Ein bisschen aufgeregt, dass da jemand den Geschäftsführer sehen möchte, wenn er dann daher trottet, meistens ein Mann. Da mache ich darauf aufmerksam, dass wir ganz tolle Angestellte haben, die mich wunderbar bedient haben. Der Chef freut sich meistens und tut so, ja, ich weiß ja, was ich an euch habe, aber die genannte Person geht auf erst einmal. Und ich denke mir, so kleine Glücksgefühle zu vermitteln, tut den Menschen gut. Mir kostet es eine halbe Minute, Minuten meines Lebens, und ich tue jemandem etwas Gutes, der vielleicht noch tagelang nachhalten wird.
Simone Koren-Wallis:
Das Thema ist so dermaßen wichtig, dass es gleich noch eine Folge dazu gibt, auch mit sehr, sehr coolen Veranstaltungstipps.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Nach unserer Reise in den Schlossberg sind wir jetzt mit dem Lift raufgefahren und sind unterwegs zum Wahrzeichen der Stadt Graz, zum Uhrturm mit richtig coolen Infos. Mein Name ist Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation und ich bin noch immer unterwegs mit Josef Matzi.
Josef Matzi:
Mein Name ist Josef Matzi, ich bin in der Abteilung für Immobilien beschäftigt. Mein Aufgabenbereich umfasst die Genehmigung von Veranstaltungen im städtischen Park und Grünanlagen und auch den Schlossberg.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Wir stehen jetzt direkt vor dem Uhrturm noch. Was fällt dir zum Uhrturm ein?
Josef Matzi:
Die falschen Zeiger fallen mir immer wieder ein. Hat aber schon Sinn gehabt. Damals war die Zeit ja nicht so schnelllebig. Damals hat es keine Minuten gegeben. Jetzt hat der Große natürlich nur die Stunden angezeigt. Und dann haben sie den Kleinen natürlich raufbauen müssen. Und deswegen ist er halt verkehrt. 1265 ist er erbaut worden. Aber natürlich nicht so, wie er da steht, weil dieser Rundgang der ist erst später dazugekommen. Der ist erst um 1500, 1600 herum dazugekommen.
Simone Koren-Wallis:
Es ist und bleibt das Wahrzeichen der Stadt Graz.
Josef Matzi:
Genau, und wir werfen jetzt einen Blick hinein.
Simone Koren-Wallis:
Das sind alles so Holztreppen. Wir steigen jetzt den Uhrturm hinauf.
Josef Matzi:
Genau, und wir begeben uns zum Uhrwerk. Achtung auf den Kopf. Kopf bitte einziehen.
Simone Koren-Wallis:
Unfassbar. Das ist jetzt mit Zahnrädern. Wie kann man sich das vorstellen?
Josef Matzi:
Mit Zahnrädern, mit Unruhe, mit Minutenfang. Mit den Antriebsstangen hinaus zum Uhrwerk. Mit einer Umlenkung hinauf, damit die Glocken betrieben werden von diesem Uhrwerk.
Simone Koren-Wallis:
Wie alt ist dieses Uhrwerk?
Josef Matzi:
1712. Von Sylvester Funck gebaut.
Simone Koren-Wallis:
Und funktioniert noch immer?
Josef Matzi:
Funktioniert noch immer. Wir haben jetzt den Herrn Reicht, der einer der wenigen ist, der solche Uhrwerke erwartet. Wenn irgendwas passiert, muss alles händisch angefertigt werden. Es gibt ja nichts mehr. Es ist alles, wie gesagt, ziemlich nach dem Originalzustand.
Simone Koren-Wallis:
Ah, was passiert jetzt?
Josef Matzi:
Das ist der Minutenfang. Jede Minute dreht sich das. Und zur Viertel-, Halb-, Dreiviertel- und vollen Stunde gibt es einen Radau, weil da die Glocken schlagen. Das heißt, dann setzt sich das ganze Werk in Bewegung. Zwei Schläge. Hast du gesehen? Einmal, zweimal.
Simone Koren-Wallis:
Ich höre wenigstens.
Josef Matzi:
Da unten hörst du nichts. Und bis dahin ist es auch möglich, das Uhrwerk im Zuge von Führungen zu besichtigen mit den Graz Guides. Der weitere Weg hinauf, den wir aber gehen werden, da darf keiner mehr rauf. Das haben wir vor Jahren geschlossen.
Simone Koren-Wallis:
Ist das gefährlich?
Josef Matzi:
Ja, es ist so, dass es oben verwinkelt ist. Und dann ist dieser Umgang gestützt und gesichert worden. Und da kannst du mit dem Kopf in irgendeine Eisenstange rennen. Und das geht nicht mehr.
Im Uhrturm befinden sich noch drei Glocken. Zwei sind noch in Betrieb. Also die Stunden. Volle Stunde und die Viertel. Dreiviertel. Und dann gibt es noch diese arme Sünderglocke, die ist dann geschlagen worden. Das war ja auch ein Gefängnis, der Schlossberg. Das muss man auch sagen. Das war ja auch ein Gefängnis. Und wenn jemand hingerichtet worden ist, hat diese arme Sünderglocke geschlagen. Ist sie geschlagen worden.
Simone Koren-Wallis:
Und das ist ja oben passiert am Schlossberg.
Josef Matzi:
Ja, teilweise auch.
Simone Koren-Wallis:
Wann war das mit den Hinrichtungen?
Josef Matzi:
Das war alles vor den Franzosenkriegen. Vor den Franzosenkriegen war das ja auch ein Gefängnis.
Simone Koren-Wallis:
Was jetzt genau heroben am Schlossberg. Gibt es oben da?
Josef Matzi:
Ja, der Kasemattenbereich zum Beispiel. Oder auch im Glockenturm, da waren die besseren Herrschaften untergebracht.
Simone Koren-Wallis:
Also die besseren Eingesperrten, oder was?
Josef Matzi:
Ja, genau. Aber damals schon differenziert. Hat man schon unterschieden.
Und das ist ja, wenn man rauf geht über die Weldenstraße, gibt es unten das sogenannte Franzosenkreuz. Auf der rechten Seite. Und bis dorthin, wenn zum Beispiel jemand auf den Schlossberg überstellt worden ist, weil er seine Strafe abbüßen hat müssen, bis dorthin haben ihm die Angehörigen begleiten dürfen.
Simone Koren-Wallis:
Warum aber der Schlossberg? Warum war der Schlossberg das Gefängnis?
Josef Matzi:
Platz genug. Wir haben oben eine richtige Festung gehabt. Die Kasematte war ja, wo jetzt die ganzen Spielstätten ihre Veranstaltungen drin haben, das war ja ein richtiger Bau. Das heißt, das ist ja nur der Keller übergeblieben. Das war ja ein richtiges, wie sagt man, ein riesengroßes Gebäude.
Simone Koren-Wallis:
Aber jetzt hat man da herum die schönste Aussicht. Warum baut man das auf der schönsten Aussicht damals?
Josef Matzi:
Damals hat man das mit der schönsten Aussicht ja nicht so gehabt. Man hat dorthin was gebaut, das schwer einnehmbar war, nachdem das ein Berg ist, hat man den natürlich rundherum befestigt. Das hat keinen, wie gesagt, keinen Wald gegeben. Sicht nach allen Seiten. Und die Franzosen sind vergeblich gegen diese Festung, die von Major Hackher verteidigt wurde, angerannt. Und nur im Zuge des Friedensabkommens wurde dann die Festung übergeben. Aber sie wurde nie eingenommen. Jetzt haben wir den Uhrturm da stehen, die Kanonenbastei. Aber da, wo der Uhrturm steht beim Aufgang, da war das Mannschaftsgebäude, da war ein riesiges Tor. Das war eine Festung halt. Die Bürgerbastei ist verteidigt worden da drüben. Da hat man runtergeschossen nach Graz. Heißt ja deswegen Bürgerbastei, weil die Bürger von Graz diese Bastei auch verteidigt haben im Zuge der Franzosenkriege.
Ja, rundherum, das war ein komplettes, wie Hohensalzburg eigentlich vergleichbar. Es gibt ein Modell natürlich im Graz Museum. Das ist interessant, kann sich jeder Grazer anschauen, das sieht man dann. Das hat der Kanonier Sigl, der war damals Kanonier, und der hat dieses Modell nachher angefertigt. Und da sieht man wieder Schlossberg, wie es früher wirklich war. Kein Vergleich zu jetzt. Jetzt ist es eine Parkanlage eigentlich.
Simone Koren-Wallis:
Ja, genau. Und ein Ausflugsziel. Und essen kann man gut. Und natürlich Konzerte.
Mit den Kasematten schon ziemlich cool. So, wir gehen jetzt eine ganz steile Stiege ganz hinauf.
Josef Matzi:
In die ehemalige Türmerwohnung. Da hat wer gewohnt, ja. Bis in die späten 60er oder frühen 60er Jahre hat es einen Turmwärter gegeben, der gleichzeitig beim Stadtgartenamt angestellt war. Und da geschaut hat, hat die Uhr betreut.
Simone Koren-Wallis:
Ist ja arg.
Josef Matzi:
Bitte auf den Kopf aufpassen.
Simone Koren-Wallis:
Jawohl. Mein Gott, wir stehen ganz heroben im Uhrturm.
Josef Matzi:
Im hölzernen Rundgang, der 1560 errichtet wurde. Da sieht man noch den Originalputz.
Simone Koren-Wallis:
Da hat man rausgeschaut, die Soldaten haben dort rausgeschaut.
Josef Matzi:
Oder auch, ob irgendwo ein Feuer passiert, da hat es den Feuerwächter gegeben. Für das war ja das prädestiniert.
Simone Koren-Wallis:
Du hast ja ganz gerade gesehen.
Josef Matzi:
Genau, fast. Interessant ist, dass ihr gleich seht, eins, zwei, drei Ecker. Nur drei, nicht vier. Weil der vierte würde genau in den Berg hineingehen. Da hättest du nichts gesehen, da hättest du nur in den Berg hineingeschaut. Und deswegen haben sie ihn ausgelassen.
Da bitte wiederum ein bisschen aufpassen mit dem Kopf. Ich mache jetzt nur auf, damit da Licht reinkommt.
So, da sind wir. Und da ist die, die ist leider nicht mehr in Betrieb.
Simone Koren-Wallis:
Das ist die, wie hast du gesagt?
Josef Matzi:
Die arme Sünderklocke. Und das funktioniert, siehst du, wird mit Seilzug betätigt. Von unten, was wir kriegen bei der Uhr. Weißt du, das verkippt. Ja, ja, ja. Jetzt ziehst du es nach unten an. (läutet Glocke)
Simone Koren-Wallis:
Hat man das damals auch betätigt, eben mit Feuer, hat man damit auch die Feuerwehr animiert.
Josef Matzi:
Genau, das war die Feuerglocke unter anderem. Und schau her, das sind die ... Der Seilzug.
Das sind mit Steinen gefüllt, exakt ausgewogen, um die Genauigkeit der Uhr zu garantieren. Wirklich.
Simone Koren-Wallis:
Das muss man jetzt beschreiben, weil die Leute sehen das ja nicht.
Josef Matzi:
Das sind drei Unruhen, Gegengewichter.
Simone Koren-Wallis:
Gegengewichter vom ganzen Uhrwerk.
Josef Matzi:
Vom ganzen Uhrwerk. Man muss sich das vorstellen wie eine Kuckucksuhr. Die ziehst du auch auf. Genauso funktioniert das auch. Nur werden die jetzt elektronisch aufgezogen. Wenn sie dann wieder eine gewisse Tiefe erreicht haben, wird sie wieder aufgezogen. Aber in dem Moment, wo sie oben sind, steuern sie die Uhr. Also wie eine Kuckucksuhr. Die hat man früher auch so aufgezogen, wenn du dich erinnern kannst.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, die Uhrturmuhr ist wie eine Kuckucksuhr.
Josef Matzi:
Das möchte ich jetzt nicht sagen. Das möchte ich jetzt nicht so stehen lassen.
Simone Koren-Wallis:
Für den Vergleich entschuldige ich mich ganz hochoffiziell.
Falls sich jetzt aber jemand denkt, das würde ich irgendwie gern sehen, wie es da drin ausschaut. Einfach auf die Instagram oder Facebookseite der Stadt Graz klicken. Wir haben nämlich ein Video für euch.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Was muss man eigentlich über den Grazer Schlossberg wissen? Und wie schaut es im Schlossberg aus? Ich nehme euch in dieser Folge mit, und zwar in den Stollen. Mein Name ist Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Und ich bin quasi Gast bei Josef Matzi.
Josef Matzi:
Mein Name ist Josef Matzi, bin in der Abteilung für Immobilien beschäftigt. Ich habe das Veranstaltungsreferat aus allen städtischen Park- und Grünanlagen und natürlich auch den Schlossberg, den schon etwas länger. Und mein Aufgabenbereich umfasst die Genehmigung von Veranstaltungen in städtischen Park- und Grünanlagen und auch den Schlossberg.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Das ist heute ein bisschen ein anderer Stadt Graz Podcast, Graz Geflüster. Und zwar, man hört es vielleicht schon, denn wir sind mittendrin im Schlossberg. Josef, bitte, wo sind wir da jetzt genau?
Josef Matzi:
Wir sind in einem Teilbereich des Schlossbergstollens. Und zwar im ehemaligen Kulturgüterschutzstollen. Der Schlossberg verfügt über ein Stollensystem, das circa 6,5 Kilometer lang ist.
Simone Koren-Wallis:
6,5 Kilometer?
Josef Matzi:
6,5 Kilometer wurde Ende des Zweiten Weltkrieges mit dem Bau begonnen, um der Grazer Bevölkerung einen Schutz zu geben vor den Luftangriffen. Es hat damals 21 Eingänge gegeben, die haben wir dann mit der Zeit alle zugemacht. Es ist klar, es ist ein geschlossenes System. Und eigentlich sind nur einige Teile öffentlich zugänglich, so wie die Märchengrottenbahn.
Simone Koren-Wallis:
Ja, die kennt man vor allem, wenn man Kinder hat oder beziehungsweise auch von früher, wo man selbst noch Kind war.
Josef Matzi:
Genau, dann dieser Durchgang vom Schlossbergplatz hinauf zum Karmeliterplatz.
Simone Koren-Wallis:
Ja.
Josef Matzi:
Diese Längsachse, die wurde im Zuge der Kulturhauptstadt Graz gemacht.
Simone Koren-Wallis:
2003?
Josef Matzi:
2003, gleich wie mit dem Dom im Berg. Und dann gibt es noch etwas ganz Interessantes, ein Montan-Museum, das aber privat geführt wird. Leider Gottes gibt es dort keine öffentlichen Führungen, wir kennen das. Und eben noch ein paar Teilbereiche des Schlossbergs, der halt im Dunkeln liegt, weil es dort keinen Zutritt gibt.
Simone Koren-Wallis:
Okay, das heißt, wir sind jetzt quasi in dem Bereich, wo eigentlich keiner rein darf, aber wir es den Grazerinnen und Grazern eigentlich einmal akustisch zugänglich machen. Vielleicht können wir es einmal beschreiben. Es schaut eigentlich aus wie in der Märchenbahn, oder?
Josef Matzi:
Ja, der ist natürlich ein bisschen gesichert, weil es ja ein Kulturgüterschutzstollen hätte werden sollen.
Simone Koren-Wallis:
Zweiter Weltkrieg, Bombenangriff. Hat man einfach schnell alles da rein verbrachtet oder hat man das auch herein verbrachtet?
Josef Matzi:
Nein, das ist eigentlich erst viel, viel später ist man auf die Idee gekommen, dass man in diesen Stollenbereichen eventuell Kulturgüter lagern könnte. Aber! Und das große Aber? Ihr merkt es, ihr spürt es, es ist...
Simone Koren-Wallis:
Huschi!
Josef Matzi:
Das macht ja nichts, aber es ist wahnsinnig feucht.
Simone Koren-Wallis:
Ja, stimmt.
Josef Matzi:
Und damit ist das Ganze verworfen worden, aber der Name ist geblieben. Wir sagen nur immer Kulturgüterschutzstollen.
Simone Koren-Wallis:
Ah, ...Schutzstollen. Okay. Was ist das? Das schaut jetzt aus fast so wie ein unterirdischer Eingang von einem Häuschen, schaut das jetzt ein bisschen aus, wenn wir da jetzt durchgehen.
Josef Matzi:
Wenn wir da jetzt weiter reingehen...
Simone Koren-Wallis:
Okay, da muss man sich ja bücken, waren die Leute früher kleiner.
Josef Matzi:
Das ist natürlich schon eine neue Tür, aber das ist noch eine Originaltür aus dem zweiten, oder vor dem zweiten Weltkrieg. Und jetzt sieht man natürlich nicht, was finster ist, aber da oben hat es einen Ausgang gegeben, oder einen Eingang von der Sackstraße her. Ja. Und das haben wir halt alles dann zugemacht. Damit eben, das hat so diese alten Häuser haben wir Zugang gehabt, teilweise vom Keller aus in die Stollenbereiche. Und das haben wir dann alles zugemacht, weil immer wieder dann natürlich Leute reinkommen.
Simone Koren-Wallis:
Ja, sicher. Und muss das jetzt noch irgendwie gewartet werden, oder macht die Stadt Graz da drinnen jetzt irgendwas noch, oder ist das gar nichts?
Josef Matzi:
Einmal im Jahr geht der Geologe durch, schaut sich die Veränderungen an, die es eventuell im Gesteinssystem gibt. Aber man muss offen und ehrlich sagen, die Stadt Graz lässt das Brach liegen. Es hat immer Ideen gegeben, dass man Pilze und Schinken lagert, das ist aber alles irgendwie verworfen worden. Aber wie haben wir jetzt da seit heuer haben wir oben in ehemaligen Sanitätsstollen eine Sektkellerei drinnen.
Simone Koren-Wallis:
Nicht schlecht, aber man merkt schon bei den ganzen, es tropft von oben. Also du merkst richtig, dass es sehr, sehr feucht ist.
Josef Matzi:
Der Schlossberg ist ja ein Dolomitgestein. Und natürlich, durch heuer ist es extrem, durch diese starken Regenfälle. Mit der Zeit lassst er dann durch. Und im alten Stollenbereich haben wir dann schon so Wassereinschlüsse halt.
Simone Koren-Wallis:
Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Fakten, die man über den Schlossberg kennen muss?
Josef Matzi:
Ganz wichtig, dass es einmal eine uneinnehmbare Festung war. Das war ja wirklich eine Festung, eine Burg. Und dass jetzt vom Schlossberg jetzt ja nicht mehr viel übrig geblieben ist. Das hat ja auch früher, was ja ganz interessant ist, es hat ja keinen einzigen Baum am Schlossberg gegeben. Das war ja eine Festung. Und jeder Baum wäre dem Feind entgegengekommen.
Der war kahl. Also das sind zum Beispiel so Sachen, die ja fast niemand mehr weiß. Und erst nach den Franzosenkriegen, wie sich der Freiherr von Welden ergeben hat müssen und die Festung geschleift worden ist, hat der Major Hackher, nicht der Freiherr von Welden, hat der Freiherr von Welden das in eine Gartenanlage umgewandelt. Und seitdem haben wir auch die vielen Bäume am Schlossberg. Und dass halt leider Gottes oder Gott sei Dank nicht mehr der Uhrturm übrig geblieben ist, den haben ja die Grazer den Franzosen abgekauft. Der wäre ja auch bei der Sprengung mitgekommen gewesen.
Das sind einmal so wichtige Dinge. Und natürlich das Stollensystem. Welche Stadt hat so ein Stollensystem? Leider Gottes ziemlich ungenützt. Bis auf die Märchengrottenbahn, okay.
Simone Koren-Wallis:
Da stehen wir jetzt eh davor. Links geht es in die Märchengrottenbahn und rechts geht es in den Dom im Berg, der für viele Veranstaltungen genutzt wird. Und da gehen wir jetzt hinein. Das heißt, seit wann gibt es jetzt den Dom im Berg? Also diese Veranstaltungsräumlichkeiten?
Josef Matzi:
2003, Kulturhauptstadt.
Simone Koren-Wallis:
Direkt der Kulturhauptstadt. Weil da sind wir jetzt wirklich in dem, wo man wirklich durch raufgehen kann.
Josef Matzi:
Dieser öffentliche Verbindungsweg zwischen Schlossbergplatz und Karmeliterplatz. Und links und rechts geht es los mit den Stollensystemen. Wir gehen direkt daran vorbei. Südseitig geht es rüber zur Sackstraße. Das ist eines der verfallensten Systeme.
Simone Koren-Wallis:
Aber wenn wir da jetzt reingehen, da ist einem so ein Glas vor. Und wenn wir da jetzt reingehen würden, würden wir in der Sackstraße rauskommen. Schau, dass das ein richtiges Stollensystem ist.
Josef Matzi:
Ja, es ist wahnsinnig viel Querverbindungen. Schau, da links jetzt. Das ist der Zugang zum Jahnstollen.
Simone Koren-Wallis:
Jahnstollen?
Josef Matzi:
Jahnstollen heißt er deswegen, weil wir oben bei der Jahngasse beim Landessportzentrum rauskommen würden.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt sind wir eigentlich schon fast ganz oben und dort gehen wir jetzt rein.
Josef Matzi:
Und jetzt gehen wir in den ehemaligen Sanitätsstollen. Der heißt deswegen so, weil das der Sanitätsbereich war für die Kranken und alten Leute. Total befestigt.
Simone Koren-Wallis:
Ah ja. Schau, da tropft es schon wieder. Das heißt, mit was haben sie das befestigt?
Josef Matzi:
Mit Beton.
Simone Koren-Wallis:
Mit Beton? Direkt Beton?
Josef Matzi:
Genau. Da sieht man, wie es geschäumt und so weiter geworden ist. So war es ursprünglich geplant, den ganzen Stollen. Nur es ist keine Zeit geblieben mehr. Also Teile sind befestigt...
Simone Koren-Wallis:
Und Teile unbefestigt.
Josef Matzi:
Aber die größten Teile sind unbefestigt. Dieser ganze Bereich, der schließt sich da noch hinten weiter, ist relativ groß. Der schaut genauso wie da, wie du das da siehst, schaut aus.
Simone Koren-Wallis:
Kommt man dann da schon Richtung Märchenbahn rüber?
Josef Matzi:
Ja, da müsste man so schräg runtergehen.
Simone Koren-Wallis:
Waren das früher Klos?
Josef Matzi:
Ja, das sind Sanitätsstollen, wo alles verfließt. Bereiche für die Waschbecken. Ja, also eine richtige Sanitätsstation.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt geht's raus aus dem Stollen und rauf auf den Schlossberg. Und zwar geht's weiter mit unserer akustischen Reise in den Uhrturm. Am besten gleich weiterhören.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Wird Graz Europas grüne Hauptstadt 2025? Darum geht es in dieser Folge, denn Graz ist im Finale um den Green Capital Award. Aber was heißt das eigentlich? Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste, Natascha Maili und Christian Nußmüller.
Jingle
Natascha Maili:
Ich bin Natascha Maili und arbeite im Umweltamt im Bereich Projektmanagement und darf da eine Vielzahl an unterschiedlichen schönen Umweltprojekten betreuen.
Christian Nußmüller:
Hallo, ich bin der Christian Nußmüller. Ich arbeite seit 18 Jahren in der Stadtbaudirektion und darf das Referat für Klimaschutzkoordination und Förderprojekte leiten.
Simone Koren-Wallis:
Wir sind im Finale, also Finale oh, und zwar beim European Green Capital Award 2025. Das klingt total super. Graz ist im Finale. Was ist Green Capital Award?
Christian Nußmüller:
Und wir haben es jeder für uns in seinen eigenen Worten.
Natascha Maili:
Das ist ein guter Plan.
Christian Nußmüller:
Der European Green Capital Award ist eine renommierte Auszeichnung der EU-Kommission für Städte, die sich langfristig schon dem Klimaschutz und dem Umweltschutz verschrieben haben. Die also lange hier in unterschiedlichen Bereichen versuchen, die Lebensqualität in den Städten durch verstärkte Klimaschutzmaßnahmen zu steigern.
Natascha Maili:
Ja, eine Auszeichnung für Städte im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit. Und es geht, was ich immer wichtig zu betone, es geht vor allem darum zu zeigen, dass es auch in der Stadt möglich ist, etwas zu machen. Und dass Städte Vorbildwirkung einnehmen können, eben in diesen eben genannten Bereichen.
Simone Koren-Wallis:
Wie läuft das Ganze jetzt ab? Wie viele Städte sind dann nominiert? Und wann weiß man, wer gewonnen hat?
Natascha Maili:
Also es sind drei Städte jetzt für den Green Capital Award nominiert. Der Green Capital Award bezieht sich eben auf Städte über 100.000 Einwohnern. Und entschieden wird es am 5. Oktober in Tallinn.
Simone Koren-Wallis:
Wer sind die anderen zwei?
Christian Nußmüller:
Ja, das wären Vilnius, also die Nachbarstadt von Tallinn, und Guimares in Portugal. Und ursprünglich haben sich zehn Städte beworben in der Phase 1. Da hat man ein technisches Dokument abgeben müssen, wo man gezeigt hat, was man in der Vergangenheit im Umweltbereich geleistet hat als Stadt, wo man aktuell steht, auch unterlegt mit Kennzahlen und Indikatoren, und welche Visionen und Pläne man für die Zukunft hat. Und das war die Phase 1. Und da sind wir neben den zwei anderen genannten Städten eben als Finalisten vorgegangen.
Simone Koren-Wallis:
Das ist ja eigentlich großartig, wenn man das so sagen darf. Nur, wie hat man das geschafft?
Natascha Maili:
Also wir haben versucht, dem ein möglichst realistisches Bild zu geben. Wir haben nicht nur beschrieben, was wir gut gemacht haben oder gut können, sondern auch die Bereiche, die einfach nicht so leicht zu bewältigen sind. Und haben vor allem versucht, so ein ganz breites Potpourri zu geben. In Graz gibt es ganz viele tolle Menschen, die ganz viele Projekte umsetzen. Und wir haben uns bemüht, möglichst viel von diesen Aktivitäten da schon hineinzuschreiben.
Christian Nußmüller:
Ganz konkret waren das die Bereiche eben Luftqualität, Wasser, also wie schaut es mit Trinkwasserqualität, mit Abwassermanagement aus, Hochwasserschutz beispielsweise. Dann Biodiversität, grüne Infrastruktur. Wie schaut es mit der Abfall- und Kreislaufwirtschaft bei uns in der Stadt aus? Wie schaut es mit dem Lärm aus? Welche Maßnahmen setzt die Stadt Graz bei Klimawandelanpassung, aber auch bei Klimaschutz generell? Und dann hat man noch die Möglichkeit gehabt, vier Best- oder Good-Practice-Beispiele aus Graz vorzustellen aus diesen Bereichen. Und das haben wir offensichtlich nicht so schlecht hingekriegt.
Simone Koren-Wallis:
Schaut so aus, gell? Wie stehen jetzt die Chancen für uns?
Natascha Maili:
Rein geografisch schaut es für uns recht gut aus, weil die Städte in der ähnlichen Lage haben wie die Stadt 2023 und 2024. Aber ich glaube, wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie die Bewertung war, vom technischen Bericht. Weil das Ganze wird mit einem Punktesystem bewertet. Und es wird eine Überraschung werden. Aber die Chance lebt.
Christian Nußmüller:
Ich sehe es auch so. Die einzige Stadt in unserem Nahbereich, die in den letzten Jahren diesen Titel einheimsen konnte, war Laibach, vor sechs Jahren, glaube ich, oder so. Und es geht in der EU auch immer wieder, wie du richtig gesagt hast, Natascha, um die geografische Verteilung. Du kannst nicht sozusagen nur auf eine Ecke der EU konzentrieren, sondern man muss schon einen Ausgleich auch schaffen. Da haben wir, glaube ich, den Vorteil, dass wir als Stadt Graz doch traditionell immer schon das Tor nach Südosteuropa waren. Und es geht auch darum, ein Role-Model zu sein für andere Städte, die dann mehr oder weniger hier diese Wege einschlagen. Strategisch auch, aber in der Umsetzung, in den Umweltbereichen, wie die Stadt Graz. Und da könnten wir viel Gutes herzeigen sozusagen.
Simone Koren-Wallis:
Als Vorbild, oder? Als Vorbild, ja. Was bedeutet es jetzt allein für die Stadt Graz, dass Graz im Finale ist und vielleicht dann sogar gewinnt? Was bedeutet das?
Christian Nußmüller:
Ich glaube, wir können jetzt schon sehr stolz sein, dass wir es soweit geschafft haben, von allen Städten in Europa quasi unter die ersten drei gerankt zu werden.
Wenn wir wirklich den Sieg einheimsen würden, bedeutet es, dass der Gewinner, wer auch immer das sein wird, für 2025 - und wir bewerben uns jetzt zwei Jahre im Voraus - 600.000 Euro von der EU-Kommission zur Verfügung gestellt wird für Maßnahmen, vor allem vor Ort, um die Bevölkerung sozusagen noch stärker mitzunehmen in den Umweltschutzbestrebungen der Kommune, der Stadt Graz. Und in unserem Fall ist es so, dass wir das sehr eng vernetzen mit dem existierenden Klimaschutzplan Graz, wo in den nächsten Monaten auch sehr stark eine Bürgerbeteiligung starten wird. Und das heißt, der Plan ist eigentlich schon da. Wir kriegen zusätzliche Mittel, um da sozusagen noch mehr zu machen im 25er-Jahr. Und natürlich werden wir hier auch internationale Veranstaltungen ausrichten können. Die EU wird Veranstaltungen hier in Graz stattfinden lassen. Auf uns wird gesehen, weltweit sozusagen. Und natürlich hat das auch letztendlich eine Umweltrentabilität für die Stadt Graz. Also vielleicht kurz erklärt.
Simone Koren-Wallis:
Wer hat da bis jetzt sonst noch gewonnen?
Natascha Maili:
Sie sind schön verteilt eigentlich über ganz Europa. Derzeit ist Tallinn Grüne Hauptstadt. Aha, das heißt, wir, wenn wir gewinnen sollten, werden wir dann auch Austräger für 2026.
Christian Nußmüller:
Das heißt, dass alle Bewerber für 2027 sich in Graz dann treffen würden, alle Finalisten, und dann die Jurypräsentation in Graz stattfindet, so wie heuer in Tallinn. Und dann in Graz auch bekannt gegeben wird, wer dann das European Capital of Europe 2027 sein wird.
Simone Koren-Wallis:
Allein das ist ja cool. Also Tallinn, Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Tallinn, wer war sonst noch?
Natascha Maili:
Nächstes Jahr wird Valencia sein. Dann war im letzten Jahr Grenoble, Laibach.
Christian Nußmüller:
Also wenn man sich so anschaut, die Gewinnerliste, sind das eher Mittelstädte. Es sind keine Metropolen, keine Hauptstädte der Mitgliedstaaten. Also das ist ein Format, glaube ich, das speziell auf Mittelstädte abzielt, die natürlich auch eigene Rahmenbedingungen haben im Umweltbereich.
Simone Koren-Wallis:
Das Finale ist im Oktober Tallinn, 1.500 Kilometer Luftlinie. Wie kommt man dann dorthin?
Christian Nußmüller:
Das ist die Gretchenfrage. Wir sind natürlich angehalten, möglichst klimaschonend zu reisen. Wir sind natürlich jetzt gerade bei der Reiseplanung, logischerweise unter anderem. Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir mit einem Bus von Graz nach Tallinn fahren werden.
Simone Koren-Wallis:
Sehr cool. Es ist ja übersetzt die grünste Stadt Europas. Es gibt ja ganz viele, die da sagen, weiß wie, nein, das kann ja nicht sein. Wie grün ist Graz für euch?
Christian Nußmüller:
Na ja, da müsst ihr jetzt schnell auf Wikipedia schauen. Nein, also die Stadt Graz, und das vergisst man oft, besteht ja nicht nur aus dem zentralen Stadtgebiet, wo man durchaus verstehen kann, dass die Leute zu wenig grün haben. Beziehungsweise viel mehr grün gern hätten. Sie besteht natürlich auch aus einem Ring, mehr oder weniger zumindest in drei Himmelsrichtungen, im Westen, im Norden und im Osten von einem Grüngürtel, wo mehr oder weniger Bauungsverbot herrscht.
Das zählt natürlich auch mit, weil es auf Grazer Stadtgebiet liegt und weil es eine grüne Lunge ist, die sozusagen hier durch Luftströmungen, mikroklimatische Verhältnisse auch dafür sorgt, dass es erträglich ist im Sommer beispielsweise in der Stadt. Klar ist aber auch, dass wir noch viel mehr grün brauchen werden. Es läuft ja schon eine Begrünungsoffensive, es werden Bäume im Straßenraum gepflanzt.
Auch beim neuen Tummelplatz-Konzept wird verstärkt darauf geschaut, dass mehr Bäume quasi in der bebauten Stadt sind, um eben auch hitzemildernd dann vor allem in den heißen Tropentagen und Tropennächten im Sommer zu wirken.
Natascha Maili:
Auf jeden Fall geht grün für mich über Bäume und Pflanzen hinaus und ich bin inzwischen schon 17 Jahre bei der Stadt Graz und im Umweltamt und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die sich eben für Nachhaltigkeit einsetzen, in unterschiedlichsten Bereichen. Und das ist eigentlich meine Definition von grüner Hauptstadt, sind diese vielen handelnden Personen im Wirtschaftsbereich, auf den Universitäten, dann ganz viele Leute, die Geschäfte aufbauen und ähnliches.
Also wir haben ganz viel Grün eigentlich in der Stadt, das vielleicht jetzt nicht direkt mit Bäumen so assoziiert werden kann.
Christian Nußmüller:
Und letztendlich muss ja auch jeder persönlich seinen Beitrag leisten. Das muss auch jedem bewusst werden, immer stärker, wenn wir von Klimaschutz reden, nimmt das nicht irgendwer anderer, ein Dritter uns ab, sondern jeder muss in seinem eigenen Privatbereich Handlungen setzen, die dazu führen, dass weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt.
Simone Koren-Wallis:
Da kann ich auch ganz viele Folgen vom Stadt Graz Podcast schon empfehlen, die wir schon aufgenommen haben dazu. Am Ende von so einer Podcast-Folge frage ich eigentlich ganz, ganz oft, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Und ich glaube, die Antwort ist da ziemlich eindeutig, oder? Dass wir im Oktober als Gewinner zurückkommen, oder?
Natascha Maili:
Ja, und dass dieser Spirit quasi dann übergreift, dass die Leute wieder so motiviert sind, weil es ist kein einfaches Thema. Man stößt oft an Grenzen, und das einfach wieder so mit Motivation, und dass wir so Flammen entzünden können.
Christian Nußmüller:
Graz steht oft besser da, als die Menschen es wahrnehmen, in manchen Bereichen, wie beispielsweise im Umweltbereich. Vieles ist selbstverständlich, dass wir sauberes Trinkwasser haben, dass ein Kanal funktioniert, und nicht bei einem Starkregen das wieder in die Mauer schwemmt, etc., etc. Da gibt es viele Beispiele.
Nur wir in der Verwaltung sind ressourcenmäßig natürlich so aufgestellt, dass wir relativ wenig Möglichkeiten haben, das hier an die Öffentlichkeit zu tragen.
Simone Koren-Wallis:
Und ich glaube, es ist für alle Grazerinnen und Grazer auch zu sehen, das macht die Stadt. Die grünste Stadt Europas, zumindest unter den drei Finalisten.
Ich glaube, allein das hat schon sehr viel bewirkt, oder?
Christian Nußmüller:
Man könnte erwarten, dass mit diesem Gewinn, den wir uns erhoffen, das Thema natürlich noch mehr Drive bekommt und noch mehr in die Köpfe der Leute kommt. Also es ist sehr stark, glaube ich, mit dem Thema Bewusstseinsbildung verbunden.
Ich glaube, das Gute an dem Preis ist, das Positive zu zeigen. Weil über die Probleme, gerade wir Österreicher reden sehr gerne über die Probleme und meistens nur über die Probleme, aber wir zeigen jetzt einfach mal das, was gut funktioniert und was positiv läuft. Und das ist einmal wirklich eine schöne Sache.
Simone Koren-Wallis:
Nächstes Mal machen wir eine akustische Reise. Und zwar in den Schlossberg und in den Uhrturm hinein. Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Egal ob bei einem Brand, bei einem Unfall, bei Hochwasser, Sie sind Lebensretter. Aber wie kommt man eigentlich zur Feuerwehr? Wie schaut so eine 24-Stunden-Schicht aus? Das und vieles mehr hören wir heute von der Grazer Berufsfeuerwehr.
Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Philipp Huber.
Philipp Huber:
Ich bin der Philipp Huber, ich bin Bereitschaftsoffizier bei der Berufsfeuerwehr Graz und wir sind angesiedelt in der Abteilung Katastrophenschutz und Feuerwehr.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Ich muss gestehen, es ist ein bisschen aufregend in der Feuerwehr zu sein, wie ich reingegangen bin und dann siehst du die ganzen Autos. Also wir sind da direkt am Lendplatz bei der Berufsfeuerwehr Graz. Philipp, wieso bist du Feuerwehrmann geworden?
Philipp Huber:
Das ist relativ schnell beantwortet. Ich bin seit meinem 12. Jahr schon bei einer freiwilligen Feuerwehr dabei und es hat eine Ausschreibung gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, Berufsfeuerwehr Graz, das hört sich sehr interessant an. Und wann hat man schon die Möglichkeit, seine größte Leidenschaft mit dem Beruflichen verbinden zu können? Und ja, jetzt sitze ich da, habe die Offiziersausbildung erfolgreich abgeschlossen und darf als Einsatzoffizier im 24-Stunden-Dienst bei der Berufsfeuerwehr Graz ausfahren.
Simone Koren-Wallis:
Wie ist es, Feuerwehrmann zu sein?
Philipp Huber:
Es ist sehr interessant, weil jeder Tag ist anders als der andere. Das heißt, man weiß, wenn man den Dienst antritt, nicht, was bringt der Tag. Das heißt, einsatzmäßig weiß man nicht, dass kann von einem Verkehrsunfall bis zu einem Zimmerbrand, bis zu einem Gebäudebrand, alles dabei sein. Das macht es einfach so spannend und interessant, dass man es nicht voraussagen kann, was bringt wirklich der Schichtdienst so mit sich.
Simone Koren-Wallis:
Kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal in einem Feuerwehrauto drinnen gesessen bist und so im Einsatz mit Blaulicht gefahren bist. Wie ist denn da so das Gefühl?
Philipp Huber:
Also, ich kann mich sogar sehr gut erinnern. Man ist schon aufgeregt. Ja, es war ein Brandmeldeanlagenalarm, das war mein erster Alarm auf der Löschgruppe. Und ja, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Es war dann im Endeffekt ein Enttäuschungsalarm, aber man ist schon beim ersten Mal...
Simone Koren-Wallis:
Ist schon, gell?
Philipp Huber:
Es ist schon aufregend, der Ablauf. Es ist einfach, sage ich einmal, cool.
Simone Koren-Wallis:
Die ganz Jungen werden wahrscheinlich Grisu den kleinen Drachen nehmen können, oder weiß ich nicht, ob das vielleicht schon wieder modern ist, keine Ahnung. Aber der Grisu hat ja immer gesagt, ich will mal Feuerwehrmann werden und so weiter und so fort. Wie ist das, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte zur Feuerwehr? Wie funktioniert das überhaupt?
Philipp Huber:
Ja, wenn man zur Feuerwehr möchte, ist es das Allerwichtigste immer, dass man auf eine Ausschreibung wartet. Wenn wir Personal suchen bzw. ausschreiben, dann gibt es immer eine öffentliche Ausschreibung der Stadt Graz. Auf dessen bewirbt man sich. Es gibt da von unserer Seite aus auf der Homepage stehen alle notwendigen Informationen, d.h. was muss man erfüllen, dass man im Branddienst der Berufsfeuerwehr Graz aufgenommen werden kann. D.h. das Allerwichtigste ist, dass man dementsprechend körperlich die Tauglichkeit hat bzw. natürlich auch sportlich sehr gut drauf ist.
Das nächste ist der neues Ausfallverfahren. Ist eh genau beschrieben auf der Homepage, aber es ist ein theoretischer Teil und ein sportlicher Teil. Und natürlich die Grundvoraussetzungen, die körperlichen, die müssen natürlich auch stimmen. Es gibt ein Maximalalter von 28 Jahren, eine maximale Körpergröße, was man erfüllen muss. Da geht es einfach darum, die Schutzanzüge, welche wir bei der Berufsfeuerwehr haben, da gibt es gewisse Vorgaben und in denen muss man sich bewegen. Deswegen gibt es auch diese Mindestgröße.
Wenn man sich dann bewirbt auf die jeweilige ausgeschriebene Stelle und man erfüllt die Voraussetzungen, dann wird man natürlich zum Aufnahmetest eingeladen und dann liegt es an jeder oder jedem selbst, dass man den auch so gut wie möglich absolviert und schafft.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt bist du seit drei Jahren dabei. Hast du mir auch vorab schon erzählt. Was ist in den drei Jahren so alles passiert, wo du sagst, das werde ich sicher mein ganzes Leben nie vergessen?
Philipp Huber:
Das größte Ereignis, wo ich mich sehr gut erinnern kann, das war heute der Großbrand der Rösselmühle in Graz. Da bin ich am zweiten Kommandofahrzeug oben gesessen und wie wir angefangen sind, man hat die Rauchsäule ja schon kilometerweit gesehen und man weiß ja dann auch nicht, was erwartet jetzt dann im ersten Moment dort. Und ich muss auch gestehen, so einen großen Brand habe ich noch nie wirklich live miterlebt. Man sieht ja Videos und dergleichen, aber wirklich in live so einen großen Brand mitzuerleben, das war dann schon sehr aufregend und natürlich, man muss dann auch schauen, es ist sehr hektisch, sehr viele Schaulustige bzw. sehr viele Personen waren da in der Umgebung und man muss dann auch dementsprechend schauen, dass man den kühlen Kopf bewahrt und dementsprechend einfach ein gewisses Schema abarbeitet.
Simone Koren-Wallis:
Wie lange hat das Löschen dann gedauert?
Philipp Huber:
Brand aus war dann im Endeffekt erst am nächsten Tag, weil es waren einzelne Glutnester auch dergleichen, also es haben doch Entdeckungen geöffnet werden müssen und es war nicht in einem Tag erledigt.
Die Dienstmannschaft vom nächsten Tag hat da auch noch weitergearbeitet, bis wirklich dann die letzten Glutnester auch bekämpft wurden. Weil es natürlich die Schwierigkeit war, es war massiv einsturzgefährdet, gewisse Bereiche, man kommt dann auch nicht direkt hin, dass man die Glutnester auch direkt bekämpfen kann.
Simone Koren-Wallis:
Und nach so einem schweren Brand, könnt ihr euch jetzt aber nicht ausrasten oder so, weil es kann ja sein, dass gleich wieder was kommt?
Philipp Huber:
Ja genau, also auch so wie es bei der Rösselmühle gewesen ist, es war dort auch eine ziemliche Personal- und Materialschlacht, aber wie die Brandwache dann natürlich überschaut, es waren dann nur mehr ein paar Fahrzeuge dort für die Brandwache und ich bin dann selbst um, ich glaube es war halb fünf in der Früh, zu einem ausgedehnten Zimmerbrand alarmiert worden und es war dort wirklich kurz auf knapp, wir haben da im letzten Moment noch durch Zuhilfenahme der Drehleiter und sicherheitshalber an Sprungpolster aufgeblasen.
Fünf Personen noch retten können aus wirklich einem sehr ausgedehnten Brandereignis und einer massiven Verrauchung, also es sind wieder die 24 Stunden, also es kann jederzeit so weit sein und man hat nicht oft, sage ich mal, eine Verschnaufpause.
Simone Koren-Wallis:
Nimmt man sowas dann auch mit nach Hause, weil man vielleicht das auch verarbeitet und so weiter? Vielleicht auch, wenn es zu einem Verkehrsunfall gerufen wird, ihr seht ja sicher auch Sachen, die jetzt nicht so einfach zum Verarbeiten sind.
Philipp Huber:
Ich kann relativ gut abschalten, derzeit muss ich sagen, habe ich noch keine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht abschalten oder ich brauche da dementsprechend eine Betreuung, aber wie gesagt, man kann das nie im Vorfeld sagen, welches Ereignis wirklich mal kommen sollte und natürlich, man sieht leider sehr viele Sachen, man sieht aber natürlich auch sehr viele schöne Sachen, auch wenn man jetzt zum Beispiel wirklich jemandem geholfen hat oder ein Kind gerettet hat und die Dankbarkeit sieht man in den Augen. Also das lässt dann einen auch wieder, sage ich mal, aufleben und es überwiegen dann die guten Sachen doch den schlechten.
Simone Koren-Wallis:
Man merkt es nämlich auch, du bist so richtig euphorisch, wenn du über den Beruf Feuerwehrmann erzählst. Also da merkt man schon, du bist mit Herz und Seele ein Feuerwehrmann.
Philipp Huber:
Das auf jeden Fall, ja.
Simone Koren-Wallis:
Wie ist das mit Frauen eigentlich? Können Frauen auch zu euch kommen oder geht das noch nicht?
Philipp Huber:
Natürlich, also wir wären sehr froh, wenn eine Frau bei uns im Branddienst tätig wäre. Es hat leider noch keine Frau das Auswahlverfahren geschafft, weil es gibt ein österreichweites Auswahlverfahren für die Aufnahme im Branddienst bei Berufsfeuerwehren und da gibt es jetzt nicht, so wie bei anderen Einsatzorganisationen, jetzt Abstufungen. Also es gilt das Körperliche als auch das theoretische für Frauen und Männer gleich und es sind die Anforderungen, ja, sehr hoch, aber wie gesagt, mit Training ist alles möglich, ich sage das immer so dazu.
Simone Koren-Wallis:
Man sieht es dir zwar nicht an, aber du kommst aus einem 24-Stunden-Dienst, das heißt, man ist wirklich immer 24 Stunden lang im Dienst, dann hat man frei und dann gibt es wieder einmal einen 24er.
Philipp Huber:
Genau, also bei uns ist, wir sind im 24-Stunden-Wechseldienst, das heißt, unser Dienstbeginn ist um 7.30 Uhr zum Beispiel heute und endet um 7.30 Uhr morgen. In den 24 Stunden, ja, kann man rund um die Uhr ausfahren, aber bei den rund 6.000 Einsätzen, was wir im Jahr haben, ist dann natürlich nicht, dass man jetzt rund um die Uhr ausfährt. Also man kann sagen, im Schnitt sind es circa 16 Mal pro Tag, wo wirklich auf allen drei Wochen in Graz ein Einsatz passiert.
Simone Koren-Wallis:
Ich finde das jetzt aber gar nicht wenig, muss ich sagen. Aber da ist wirklich alles dabei, von der Katzenrettung, oder?
Philipp Huber:
Genau, da ist wirklich alles dabei, vom Verkehrsunfall bis zur Tierrettung, bis zum Brandmeldeanlagenalarm, bis zum Zimmerbrand, Gebäudebrände, also wirklich jeder Einsatz, was bei uns alarmiert wird.
Simone Koren-Wallis:
Eine letzte Frage habe ich noch. Ich muss schon lachen, weil es ist irgendwie so ein bisschen aus dem Film. Habt ihr so eine Feuerrutsche zum runterrutschen?
Philipp Huber:
Also ja, definitiv. Wir haben Rutschschächte, dass man einfach wirklich relativ schnell in der Fahrzeughalle ist.
Simone Koren-Wallis:
Das ist wie im Film?
Philipp Huber:
Das ist wie im Film, wirklich, ja.
Simone Koren-Wallis:
Finale, oh oh, Finale, oh oh. Graz ist im Finale.
Was, wann, warum, wieso, weshalb und überhaupt und sowieso, das gibt's in der nächsten Folge.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Kinder und Jugendliche müssen wirklich schon sehr früh so viele Entscheidungen treffen, in Sachen Schule, Weiterbildung und dann mit 18 auch, gehe ich studieren oder doch nicht? Auch da kann das IBOBB-Café helfen. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation, mein Gast zum Thema Studium Elisabeth Wiesler.
Elisabeth Wiesler:
Mein Name ist Elisabeth Wiesler, ich bin auch im IBOBB-Café eben tätig und nebenbei, das ist auch so mein Zugang zu dem Ganzen, dass ich nebenbei bei der Alphanova in der Berufsausbildungsassistenz Nachhilfelehrerin für Lehrlinge bin.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Ich sitze noch immer im IBOBB-Café, wir haben schon sehr, sehr viel gehört über Lehre, Lehre mit Matura, über die ganzen Weiterbildungsmöglichkeiten und jetzt ist das große Thema mit der Elli, das Studium. Elli, du hast mir vorab schon erzählt, wenn du damals ins IBOBB-Café gekommen wärst, hätte sich vielleicht bei dir ein bisschen was anders ergeben. Bitte erzähl einmal ganz kurz, du hast nach der Matura glaube ich nicht so gewusst, gell?
Elisabeth Wiesler:
Nein. Was mache ich? Das war eine Aneinanderreihung von Zufällen, muss man dazu sagen, weil eigentlich habe ich auch noch nicht so gewusst, wo bringt mich das Leben hin, wo sind wirklich meine Interessen, weil man einfach in dem Alter, es gibt so viel und wie soll ich jetzt wirklich herausfinden, was mich interessiert. Und durch Zufälle habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das jetzt einfach einmal in das Marketing und Sales Studium, hat sich ja eh als gut bewährt, aber ich muss sagen, ich glaube zum heutigen Stand, nach der ganzen Zeit hätte mir das IBOBB-Café sicher geholfen, weil ich einfach andere Grundinteressen habe und ich da gar nicht gewusst hätte, inwiefern ich mich dort weiterbilden könnte und da hätten sie mir im IBOBB-Café sicher geholfen, weil ich kenne die Arbeit ja, die wir hier machen und die schauen so auf einen selbst, auf den Charakter, auf die Persönlichkeit und nehmen sich einfach wirklich so viel Zeit für dich, bis du wirklich mit einem guten Gewissen dort eigentlich rausgehen könntest.
Also kann ich es eigentlich nur jedem empfehlen, der meint es, um es in der Jugendsprache zu sagen, der absolut lost ist von dieser ganzen Ausbildungslandschaft, die einfach geboten wird. Also das kann ich wirklich sagen, hätte mir sicher geholfen und hätte vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen. Ich bereue meinen Weg zwar nicht, aber hätte hätte Fahrradkette.
Simone Koren-Wallis:
Genau und vor allen Dingen, es gibt so viel in Graz, oder?
Elisabeth Wiesler:
Ja, das ist einfach eine komplette Reizüberflutung. Es gibt fünf Universitäten, von der Karl-Franzens-Universität angefangen, über die Medizinische Universität oder die Technische Universität oder vielleicht doch eine Kunstuniversität oder auch nach Leoben zur Montanuni oder möchte ich eben weiter an einer Fachhochschule, dieses Schulsystem und auch eher praxisorientiert anstatt forschungsorientiert, wie es die Universitäten sind und wie soll man sich da zurechtfinden, vor allem in dem Alter, wo man eben noch gar nicht weiß, okay, was möchte ich eigentlich machen, außer vielleicht nur mit meinen Freunden chillen oder sonst was. Und daher ist das IBOBB-Café einfach super, wenn man da Abhilfe schaffen kann und ein bisschen einen Wegweiser bekommt, welche Richtungen man einschlagen könnte und ja, entdeckt eine Möglichkeit mit uns.
Simone Koren-Wallis:
Ihr ebnet nicht nur den Weg Richtung Studium, sollte es dann ein Studium werden sollen, sondern ihr habt andere Tipps und Tricks dann auch für das Studentenleben auf Lager, gell?
Elisabeth Wiesler:
Genau, ja, also eben dadurch, dass ich auch selber Studentin bin, war. Es gibt aber coole Sachen jetzt neben den Veranstaltungen, die man so kennt, gibt es auch, wenn man jetzt sagt, so Lernmotivation. Die Karl-Franzens-Universität hat ja wirklich eine schöne neue Bibliothek gebaut. Wenn man dort wirklich hineingeht, dieses Feeling, wenn dort sehr viele sitzen, konzentriert auf ihren Computer schauen oder auf ihre Lernunterlagen, das ist schon was anderes. Da holt man sich einen Kaffee oder einen Tee, wie man möchte, setzt sich da dazu und fühlt sich irgendwie, ah, ich schaffe das auch. Da sitzen so viele Leute, ich schaffe das, ich mache das jetzt einfach.
Das ist wie ein bisschen vielleicht so in einem Hollywood-Film, wo es halt sitzt, in der Bibliothek das zusammen und dann hat man schon ein ganz anderes Feeling, wenn man sagt, man schafft es daheim nicht. Oder auch, wenn man sich draußen hinsetzt, in der Zinsendorfgasse, also eh auch in der Nähe alles. Wenn man sich dort in ein Café setzt, da sitzen auch viele und da kommt dann einfach schon die Motivation ein bisschen anders her.
Und ja, so das Studienleben kann man eigentlich auch ziemlich gut genießen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich lerne vielleicht keine Leute kennen, es gibt ja auch Apps, wie beispielsweise die Studo-App, wo nicht nur deine Lernpläne drin sind, sondern auch Chats, wo man mit anderen Studierenden schreiben kann, die vielleicht auch von der gleichen Universität oder Fachhochschule sind. Und man kann sich dort dann vernetzen und so lernt man dann auch neue Leute kennen, wenn man es möchte. Und deswegen, ja, auch ein bisschen das Studienleben genießen und nicht nur so, es ist nur mit Lernen verbunden.
Simone Koren-Wallis:
Da war, weil du gesagt hast, ich schaffe das nicht in dieser Bibliothek. Ist das sowieso, bevor sich jemand für ein Studium entscheidet, dass dann vielleicht wirklich jemand sagt, ja, das schaffe ich ja nicht. Oder, gibt es oft diesen Selbstzweifel bei SchülerInnen, dass die oft sagen, ach, für das Studium, nein, das...
Elisabeth Wiesler:
Definitiv, vor allem, wenn man sich den Lehrplan und die Lehrinhalte anschaut, denkt man sich so, okay, man wird mit Informationen erschlagen, gefühlt. Aber im Endeffekt wäre, wenn nicht du selbst, kannst du dir sagen, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Ich probiere das einfach und wenn es mich interessiert, dann schaffe ich das auch irgendwie. Und ich sage es auch ehrlich, es ist egal, wie lange man das macht. Hauptsache, man bleibt dabei und verliert auch nicht die Freude daran. Also jeder kann das irgendwie schaffen, wenn man einfach nur möchte. Man muss halt herausfinden, und das ist am besten bei uns, ob es wirklich mein Interesse trifft.
Simone Koren-Wallis:
Und wenn nicht und wenn ich sage, okay, das ist gar nichts für mich, auch dann kann ich zu euch kommen und sagen, hey, was mache ich jetzt, oder? Auch wenn ich vielleicht schon 20 bin und zwei Jahre Studium hinter mir habe oder vielleicht ein Jahr mit Bundesheer und allem wie pipapo, zu sagen, hey, wie kann ich umsteigen, was kann ich machen, kann ich jetzt nur Lehre mit Matura machen, kann ich allgemeine Lehre machen, oder gibt es ja dann so viel bei euch?
Elisabeth Wiesler:
Genau, da kommt man dann einfach zu uns und man braucht sich dann auch nicht schlecht zu finden. Eben wie du gesagt hast, da habe ich jetzt schon studiert. Einfach durchprobieren, es ist dein Leben und du möchtest ja für dich herausfinden, was dich interessiert, oder? Und wenn es eben nicht dieses Studium war, du kannst wenigstens sagen, okay, ich habe es probiert, aber bereue das auch dann nicht, sondern such dir einfach einen neuen Weg.
Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge in zwei Wochen wird es heiß. Da rede ich nämlich mit jemandem, der auch durchs Feuer geht. Wir hören uns, ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 20: IBOBB-Café: 14 - was nun? Schule oder Lehre?
Das IBOBB-Café der Stadt Graz bietet eine individuelle Beratung und Orientierungshilfe für den beruflichen Werdegang. Wie dort Potentiale erforscht und neue Möglichkeiten und Horizonte für die Karriere entdeckt werden, gibt's in dieser Folge von Grazgeflüster mit Katja Traussnig.
Folge 18: Eine Folge für alle Wirtschaftstreibenden in Graz und die, die es mal werden wollen
Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut. Aber: wie geht's der Wirtschaft in Graz?
Und wie unterstützt die Stadt Graz die Wirtschaft? Zum Beispiel mit Förderungen und welche gibt es da? Oder was mach ich, wenn ich vor einer Firmengründung stehe und nicht mehr durchblicke? Das und vieles mehr gibt's heute beim Einblick in die Wirtschaftsabteilung mit der Abteilungsleiterin Andrea Keimel.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Macht mein Kind die Matura und bleibt bis 18 in der Schule? Oder beginnt's doch eine Lehre? Wie entscheide ich mich da richtig? Wie entscheidet sich das Kind richtig? Und wer kann mich dabei unterstützen? Die Antworten, die gibt's aus dem IBOBB-Café. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Katja Traussnig.
Katja Traussnig:
Hallo, mein Name ist Katja Traussnig und ich bin Mitarbeiterin im IBOBB-Café.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Was das IBOBB-Café ist, das hat uns die Monika schon erklärt. Katja, für was bist du jetzt genau zuständig im IBOBB-Café?
Katja Traussnig:
Meine Tätigkeit ist zum Beispiel auch hauptsächlich die Beratung für jegliche Fragen rund um Bildung und Beruf. Wenn man nicht weiter weiß, wenn man nicht weiß, welche Schulen man besuchen möchte, welche Schulen gibt's überhaupt, welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt's überhaupt, dann kann man gerne zu uns kommen, zu mir kommen und wir setzen uns gemeinsam zusammen und schauen uns einmal an, was es denn da so für Möglichkeiten gibt. Von den Schulen her, es gibt doch so viele.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Schulen haben wir insgesamt in Graz?
Katja Traussnig:
Ich weiß es tatsächlich in Summe jetzt nicht auswendig, aber es sind viele. Es sind Volksschulen, wir haben Mittelschulen, wir haben die Gymnasien, die AHSen. Es gibt die Poly und dann gibt es noch zahlreiche andere Ausbildungsmöglichkeiten wie die BMS und die BHS. Da gibt es ganz tolle Abkürzungen. Die HAK, die HASCH, die HTL...
Simone Koren-Wallis:
Gut, und wenn du das jetzt so rüberschmeißt, dann denke ich mir, aha, ja und jetzt habe ich vielleicht ein Kind und wo ich sage, wo will dieses Kind hin? Wie schaust du dann so in diese Richtung, gehen wir zwecks Schule, wie macht ihr das?
Katja Traussnig:
Das Thema Schule ist natürlich ein großes Thema, vor allem also Schnittstelle zum Beruf. Das heißt, nach der Mittelschule zum Beispiel ist oft ein großes Thema, wie soll es weitergehen. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man sich da schon ein bisschen Gedanken macht. Da kommen wir zu dem Schlagwort Berufsorientierung. Was heißt das Berufsorientierung, wann beginnt das? Das ist auch so die Frage, was mache ich überhaupt, was kann ich machen, was gibt es für Angebote? Natürlich kann man da auch ganz genau hinschauen, welche Möglichkeiten habe ich da? Berufsorientierung beginnt zum Beispiel auch teilweise schon in der Volksschule.
Wir vom IBOBB-Café haben eine ganz tolle Veranstaltung für Volksschulen schon. Die große Berufsrallye für die Kleinen, wo man wirklich schon einmal gut in Berufe hineinschnuppern kann. Und so kann das Ganze schon einmal beginnen und ins Rollen kommen, sich ein bisschen auch damit auseinanderzusetzen. Was gibt es für Berufe, wie schaut das aus, was wird da gemacht, was sind da für Tätigkeiten, was wird da auf mich zukommen? Bei den Kleinen natürlich sehr spielerisch, bei den Größeren kommen da natürlich schon andere Dinge, die man vielleicht ein bisschen mit hinein nimmt.
Simone Koren-Wallis:
Dann versuchst du herauszufinden, wohin gehen die Interessen oder wie macht ihr das?
Katja Traussnig:
Genau, so ist es. Wir setzen uns dann gemeinsam hin und dann schauen wir einmal, was war bis jetzt der Ausbildungsweg? Wie schauen die Noten aus? Was sind so die Interessen? Ein bisschen auch zu schauen auf die Hobbys. Was mache ich gerne? Was tue ich gerne? Worin bin ich gut? Was macht mich aus? Auch ein bisschen so aufzuklären, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt. Soll ich weiter in die Schule gehen oder ab in die Arbeitswelt? Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit nach einer Lehrausbildung, wo man natürlich auch das neunte Schuljahr dazu braucht, also den Pflichtschulabschluss. Da gibt es dann zum Übergang eine Klasse, Poly zum Beispiel, nach der Mittelschule. Dann auch ein bisschen so hinzuschauen, in welchen Schulfächern bin ich gut? Bin ich eher sprachlich begabt? Bin ich eher mathematisch begabt? Wo sind da meine Fähigkeiten? All diese Dinge erleichtern das ein bisschen, um herauszufinden, welcher Beruf wäre für mich geeignet. Ja, ein Beispiel ist auch, ich sage das oft so, man kann an Autos interessiert sein. Das heißt aber nicht, dass ich ein Mechaniker werden muss. Man soll ein bisschen darauf schauen. Ich kann an Autos interessiert sein, bin aber vielleicht jetzt nicht der Typ, herumzuschrauben, an kleinen Schrauben, die Feinarbeit zu machen. Dann ist der Mechanikerberuf vielleicht nicht der geeignetere für mich. Autos interessieren mich dennoch. Dann bin aber vielleicht eher der kommunikative Typ, gehe gerne in Verhandlungen, beschäftige mich gerne mit Zahlen. Dann werde ich mich im Verkauf wahrscheinlich wohl erfüllen und da mein Potenzial ausschöpfen können. Bei diesen Dingen gilt es einfach ein bisschen hinzuschauen und das versuchen wir natürlich auch in unseren Beratungsgesprächen.
Simone Koren-Wallis:
Passiert es eigentlich oft, dass die Eltern vielleicht schon einen gewissen Plan für das Kind haben? Na, du wirst das oder du musst mein Geschäft übernehmen und deswegen musst du in diese Richtung gehen. Und vielleicht eben das Ganze ein bisschen außen vorgehalten wird und nichts schon.
Katja Traussnig:
Genau, genau. Auch das ist ab und an der Fall. Wie du mich vorher schon gefragt hast, ist es auch so, dass manchmal auch Eltern alleine kommen, die gewisse Vorstellungen vielleicht haben. Wir klären dann auf, welche Möglichkeiten gibt es. Dann ist es manchmal ein Aha-Erlebnis. Die Lehre als Ausbildung auch wirklich ein bisschen zu bewerben, sage ich jetzt, auch lukrativ zu machen. Das ist in den Köpfen oft noch so, dass die vielleicht ein bisschen nachrangig ist und nur ein Gymnasium, eine Matura, ein Studium ist die oberste Priorität. Aber es gibt viele Wege und unser Bildungssystem ist sehr durchlässig und auch bei einer Lehrausbildung kann man die Matura dazu machen.
Simone Koren-Wallis:
Wie funktioniert das genau?
Katja Traussnig:
Es gibt die Möglichkeit, eine Lehre mit Matura zu machen. Das heißt, die Matura neben der Lehre, neben der Lehrzeit dazu zu machen. Das erfordert natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Da muss man sich schon bewusst sein, dass man neben der Lehrausbildung, die ja mit 40 Stunden, mit Berufsschule, mit dem ganzen Arbeiten natürlich direkt in Betrieb verbunden ist, dann noch was lernen muss für die Matura.
Da gibt es Module dazu in Deutsch, Mathematik, Englisch und den Fachbereichen. Da muss man sich auch anmelden bei der WIFI zum Beispiel, wo man dann auch Basismodule absolvieren muss und hat dann nebenbei die Module in den einzelnen Fachrichtungen.
Simone Koren-Wallis:
Und was kostet das?
Katja Traussnig:
Das kostet eigentlich gar nichts. Man kann später Ausbildungen noch dazu machen. Selbst die Matura, die Berufsreifeprüfung kann man nachmachen. Es bringt nichts, die Kinder dann zu quälen, zu Leistungen zu quälen, die Vorstellungen überzustülpen. Sie werden dann nicht glücklich und das vielleicht dann irgendwann einmal tatsächlich auch abbrechen oder nicht fertig führen, die Ausbildung fertig führen. Natürlich braucht es da manchmal auch von uns ein bisschen Feingefühl, bei den Eltern genauer hinzuhören, aber natürlich eben auch bei den Kindern, bei den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen, da auch einmal hinzuschauen, wo ist denn dann das Feuer, das brennt für die Ausbildung oder für den Beruf, der es dann werden soll.
Simone Koren-Wallis:
Und gibt es überall ein Feuer oder muss man das manchmal erst ein bisschen anzünden?
Katja Traussnig:
Ja, da sprichst du auch ganz was Wichtiges an. Ja, es ist oft gar nicht so einfach. Es ist nicht einfach, Fähigkeiten zu benennen. Es ist nicht einfach, Interessen zu benennen. Und da geben wir manchmal ein bisschen einen Anstoß. Wir haben ein paar Skills, wir haben ein paar Tools, so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, den Dingen einen Namen zu geben. Viele Begriffe sind einfach, man spricht von, ja, ich kann gut rechnen, ich kann gut schreiben.
Aber es ist oft dann viel mehr, was es ausmacht. Also was heißt allein, ich bin kommunikativ? Da steckt auch so viel drinnen. Und diese Dinge versuchen wir dann auch wirklich anzugehen und herauszufinden, um da eben ein bisschen in die Richtung zu kommen.
Simone Koren-Wallis:
Und wir hoffen, dass es uns hin und wieder gelingt, dem einen oder anderen da ein bisschen so weiterzuhelfen. Was soll es werden und wo soll es hingehen?
Katja Traussnig:
Dass das Feuer dann brennt...
Katja Traussnig:
Dass das Feuer dann brennt, genau.
Simone Koren-Wallis:
Und wenn das Feuer dann so richtig brennt, dass man auch studieren gehen möchte, gibt's gleich einige Tipps zum Thema Studium, auch aus dem IBOBB-Café.
Und zwar in der nächsten Folge.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 17: Wie funktioniert Inklusion in Graz?
Nicht gehen zu können, auf den Rollstuhl angewiesen zu sein - wie geht's einem da in der Stadt Graz? Und: Was bedeutet Inklusion? Darüber sprechen wir heute mit dem Behindertenbeauftragten Wolfgang Palle und Thomas Grabner vom Verein Wegweiser, der mit Krücken und Rollstuhl unterwegs ist und haben gleich alle Infos über die Woche der Inklusion von 3. - 9. Juli für euch.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Heute gibt es alle Infos zum IBOBB-Café der Stadt Graz. Da werden nämlich ganz, ganz wichtige Informationen serviert, die für Kinder, aber auch Eltern zukunftsweisend sein können. Und es gibt noch dazu alle Infos zum Tag der Lehrberufe im Oktober. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Monika Zechner.
Monika Zechner:
Ich bin die Monika Zechner, ich bin Mitarbeiterin im IBOBB-Café. Das erkläre ich später, was das ist. Das ist in der Abteilung für Bildung und Integration, also ein Teil der Stadt Graz.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Jetzt sind wir mittendrin im Sommer, in den Sommerferien und wir reden über Schule, über Weiterbildung, über Studium. Ich bin nämlich heute im IBOBB-Café. Liebe Monika, ich glaube, es ist meine erste Frage. Ich glaube nämlich, dass es nicht jeder kennt. Was ist das IBOBB-Café?
Monika Zechner:
Also das IBOBB-Café ist eine Erst-Informationsstelle und das heißt einem für sich immer, wenn man eine Frage hat, was Bildung und Beruf betrifft, kann man einfach zu uns ins IBOBB-Café kommen. IBOBB steht für Information, Beratung, Orientierung für Bildung und Beruf.
Simone Koren-Wallis:
Muss ich da vorher anrufen? Komme ich einfach her zu euch? Wie funktioniert das?
Monika Zechner:
Ja, das ist wirklich ein Vorteil. Wir sind wirklich mitten in der Stadt, also ganz in der Nähe vom Jakominiplatz und grundsätzlich ist es so, dass man bei uns einfach vorbeikommen kann. Wir heißen ja auch IBOBB-Café.
Das heißt, man kann zu uns kommen, man kann auch einen Kaffee trinken und man kann einfach seine Fragen stellen, was man hat. Will man was über Schulen wissen? Will man irgendwie was wissen über Lehrausbildung? Was auch immer. Grundsätzlich gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man einen Termin vereinbart. Da hat man dann den Vorteil, dass man einfach wirklich eine halbe Stunde mindestens Zeit hat, wo dann ein:e Berater:in vor Ort ist und wo man dann dann für sich sein Thema ganz genau und intensiv besprechen kann.
Simone Koren-Wallis:
Aber wie ist das? Kommen da hauptsächlich die Eltern oder kommen da auch Schüler, Kinder oder auch Erwachsene, die sich weiterbilden wollen? Wie ist euer Klientel?
Monika Zechner:
Also grundsätzlich ist es so, dass der IBOBB-Café für alle Grazer und Grazerinnen und wir sagen es ein bisschen übertrieben natürlich, von 0 bis 100. Das heißt, es kann sich darum handeln, um einen Kindergartenplatz, aber es kann auch sein, dass man einfach einen Deutschkurs machen möchte oder sich überlegt, vielleicht im zweiten Bildungsweg noch einmal ein Studium zu absolvieren.
Also wir haben eine ziemliche Bandbreite. Wichtig zu sagen ist einfach, wir sind eine Erstinformationsstelle und wenn wir merken, okay, da gibt es ganz viele konkrete Fragen, dann kann es auch für sich sein, dass wir einfach weitervermitteln. Und es gibt ja ganz viele andere Bildungsberatungsstellen auch noch, da sind wir gut im Austausch und dann vermitteln wir zum Beispiel auch weiter.
Simone Koren-Wallis:
Warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, sich auch da ein bisschen mehr zu informieren und vielleicht auch zu euch zu kommen und nicht nur vielleicht vom Hören sagen, sich Informationen zu holen oder vielleicht nur im Internet? Warum sagst du, „hey kommt, kommt ins IBOBB-Café"?
Monika Zechner:
Grundsätzlich ist es natürlich so, wir leben in dieser digitalen Welt und man findet ganz viele Informationen im Internet. Es kommt immer auf die persönliche Situation auch drauf an. Und wie schaut das aus, wenn es jetzt um die Schulen geht? Welche Schulen sind im Umfeld? Wie schaut es aus? Was haben die für sich wirklich für Schwerpunkte? Und wie passt das dann zum Beispiel auch zum Kind? Wie passt das zur Familiensituation? Oder wenn es eben für Erwachsene ist, da gibt es ja auch ganz viele Parameter. Ist man im Berufsfeld? Ist man unzufrieden und möchte man sich verändern? Oder ist es einfach so, dass man zum Beispiel den Job verloren hat, weil der Betrieb insolvent geworden ist oder so? Dann schaut die Situation ganz anders aus. Und das heißt, es gibt immer verschiedenste Möglichkeiten, und das muss man einfach auch so ein bisschen abwägen und schauen, welche Variante passt dann wirklich? Welche Möglichkeiten gibt es?
Simone Koren-Wallis:
Ich kann mich noch erinnern, ich bin im BRG Kepler in die Schule gegangen und irgendwann hat mich jemand gefragt, was willst denn du einmal werden? Ja eh, vielleicht studieren, weiß ich nicht. Und ich habe dann aber Glück gehabt, dass ich eine Deutschprofessorin gehabt habe, die gesagt hat, hey, du musst irgendwas mit Schreiben, mit deiner Stimme, irgendwas in diese Richtung machen. Und die war dann ausschlaggebend dafür, dass ich ein Publizistikstudium gemacht habe und schlussendlich beim Radio gelandet bin und jetzt in der Stadt Graz bin und diesen Podcast machen kann. Ich glaube aber manchmal kriegt man diesen Schubs nicht. Und diese Berufswahl, die ist, glaube ich, gar nicht einfach, oder Monika?
Monika Zechner:
Ja, es ist an und für sich ein Prozess. Das heißt, Berufsorientierung ist eine Lebensorientierung, sagt man. Und es kann nicht früh genug beginnen. Das heißt aber an und für sich, es passiert oft in den Kindergärten schon ganz viel, wo eben die Kinder die Berufe zum Beispiel der Eltern kennenlernen.
Und so geht es dann an und für sich auch in der Schule weiter. Oder es geht an und für sich auch darum, was wir vorher schon angesprochen haben, es gibt heutzutage so eine Fülle von Informationen. Aber da dann auch zu werten und zu schauen, was ist jetzt passende Information, wo komme ich an und für sich auch weiter. Und dass ich dann an und für sich auch ein Ziel formuliere und dass ich einfach schaue, wo ich da hinkomme. Und wenn man das, sage ich mal, in der Schule schon gelernt hat, dann hat man das an und für sich auch so im Erwachsenenleben. Weil inzwischen ist es ja so, dass man nicht einen Beruf einmal erlernt und den übt man dann sein ganzes Leben lang aus. Sondern man hat wahrscheinlich, vielleicht macht man ein Studium, vielleicht macht man später mal ein Studium. Oder man macht eine Lehrausbildung und merkt nach zehn Jahren zum Beispiel, dass man sich in einem anderen Bereich spezialisieren möchte. Das heißt, einerseits ist es wichtig, dass man diesen Druck wegnimmt. Es ist ein Prozess. Und wie gesagt, es ist an und für sich wichtig, dass man sich gut vorbereitet. Aber dass man dann ein Ziel anpeilt und diesen Weg dann an und für sich auch geht. Es gibt eine Zeit, wo man sich vielleicht auch wieder verändern möchte.
Simone Koren-Wallis:
Und da ist es eben so, dass ihr immer die Türen offen habt. Und wenn irgendwer sagt, okay, vielleicht mein Kind weiß gerade nicht, was es werden würde. Dann schauen wir hin ins IBOBB-Café.
Monika Zechner:
Genau. Es ist bei uns auch ganz unterschiedlich. Es ist manchmal das Eltern kommen und sagen, sie möchten sich gerne informieren, weil ihr Kind gerade in diesem Alter ist, wo es eine Berufswahlentscheidung zu treffen hat. Und manchmal kommen sie auch mit den Jugendlichen mit, wo man dann einfach auch die ganze Familie berät. Oder manchmal kommen auch die Jugendlichen allein und sagen, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Was kann ich tun? Was für Ideen gibt es da dazu?
Simone Koren-Wallis:
Man kann aber nicht nur zu euch hier in die Kiesgasse kommen. Es gibt auch immer wieder verschiedenste Veranstaltungen.
Monika Zechner:
Ja, genau. Das heißt, wir haben dann für sich wirklich verschiedene Zielgruppen. Bei den 14-Jährigen ist es so, da ist die Veranstaltung kein Plan. Da geht es darum, dass man einen Überblick hat. Was kann man alles tun? Besucht man eine weitere führende Schule oder besucht man eine Lehrausbildung?
Und dann haben wir eine ganz spannende Veranstaltung. Die findet auch wieder im Herbst statt, und zwar am 6. Oktober. Das ist der Tag der Lehrberufe. Der findet am Hauptplatz statt, also wirklich ganz zentral. Und hier haben vorrangig natürlich Jugendliche die Möglichkeit, verschiedene Berufe auszuprobieren. Also das sage ich jetzt am Vormittag. Aber nachdem wir am Hauptplatz stehen, gibt es natürlich auch den ganzen Tag die Möglichkeit, das heißt auch am Nachmittag, wo auch jeder Erwachsene eingeladen ist, einfach zu schauen, welche Berufe gibt es? Was macht man da? Welche Talente sind dann für sich erforderlich? Und welche Perspektiven gibt es dann für sich? Wie schaut die Ausbildung genau aus? Was macht man? Oder was kann man dann zum Beispiel auch danach noch machen?
Simone Koren-Wallis:
Und da gibt es auch, was ich total interessant finde, so Boxen, Berufsboxen, dass man selber einfach einmal in diesen Beruf wirklich mit den Händen reinschnuppern kann.
Monika Zechner:
Genau, ausprobieren. Es geht um ausprobieren.
Was tut man jetzt wirklich? Und das heißt, wenn man jetzt nicht richtig schweißen, aber so ein Stückchen weiter Gefühl kriegt, was tut man da? Gastronomie und Tourismus ist an uns für sich vertreten. Das heißt, auch hier kann man eine Hand anlegen. Oder eine Gärtnerei ist da, wo man einfach auch Blumen bindet und so weiter.
Und das ist wirklich, dass man sagt, okay, wie fühlt sich das an? Was tut man da wirklich? Das ist einfach ein ganz anderer Eindruck, als wenn man halt wirklich nur vor einem Computer sitzt und einfach liest, was man da tut.
Simone Koren-Wallis:
Deswegen bitte ganz, ganz groß im Kalender eintragen. Tag der Lehrberufe am 6. Oktober an Grazer Hauptplatz.
Und es geht gleich weiter mit Folge 2 aus dem IBOBB-Café zum Thema Schule oder Lehrausbildung und Berufsorientierung.
Am besten gleich weiterhören.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 16: Richtige Ernährung bei Kindern: Tipps von der Ernährungsberaterin
Welche Lebensmittel mögen Babys im Bauch gar nicht? Was mache ich, wenn mein Kind das Essen verweigert? Oder nur naschen will? Die Stadt Graz kann auch hier unterstützten, die Infos bekommen Sie in dieser Folge von Grazgeflüster mit der Leiterin des Ärztlichen Dienstes Ines Pamperl! Und die ist nicht nur was für Mamas und Papas und die es noch werden wollen, sondern auch für das Umfeld, das gern mal Ratschläge gibt.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Ich glaube, jeder von uns kennt den Satz, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut. Aber wie geht's der Wirtschaft? Wie unterstützt eigentlich die Stadt Graz, also welche Förderungen gibt's? Oder was mache ich, wenn ich vor einer Firmengründung stehe und einfach nicht mehr durchblicke? Heute gibt's einen Einblick in die Wirtschaftsabteilung. Ich bin Simone Koren-Wallis, mein Gast Andrea Keimel.
Andrea Keimel:
Ich bin Andrea Keimel, ich leite seit 1998 die städtische Wirtschaftsabteilung. Eine der schönsten Aufgaben für mich in der Stadt.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Ohne Wirtschaft geht gar nichts, natürlich auch nicht in der Stadt Graz. Liebe Andrea, kannst du vielleicht kurz beschreiben, was für dich an der Wirtschaft so wichtig und auch so interessant ist?
Andrea Keimel:
Wir sagen in der Abteilung immer, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut. Für mich so interessant ist, dass die Wirtschaft so vielfältig ist. Und das spiegelt auch unseren Aufgabenbereich wider. Wir sind, und das weiß wahrscheinlich kaum jemand, sowohl zuständig für den kleinen Landwirt oder für die kleine Landwirtin. Wir haben ganz viele landwirtschaftliche Betriebe an den Randbezirken in Graz, als auch für den großen Industriebetrieb. Wenn man bedenkt, wir haben Magna, Siemens, Andritz AG, wir haben mitten in der Stadt die Marienhütte, was kaum jemand weiß, dass Stahl produziert wird in Graz. Das heißt, wir haben so eine große Vielfalt in Graz. Und daher ist auch der Aufgabenbereich der Abteilung so spannend und fast täglich anders.
Simone Koren-Wallis:
Geht aber auch bis zu dem Ein-Mann-Betrieb. Wenn irgendwer einen Shop mit einem Mann hat, eine Frau, ist das genauso euer Verantwortungsbereich?
Andrea Keimel:
Genau, das ist hauptsächlich unser Verantwortungsbereich, weil wirklich große Förderprogramme meistens auf Bundes- oder Landesebene abgewickelt werden. Und wir seitens der städtischen Wirtschaftsförderung ergänzen diese Förderungen, speziell für Kleinstbetriebe, speziell für Kleinunternehmen. Da haben wir eine breite Palette an Förderungen, das ist eine große Säule unserer Aufgaben, Förderungen anzubieten für Kleinst- und Kleinunternehmen, um sie bei der Bewältigung der Herausforderungen, die sie jetzt treffen, gut zu unterstützen. Wir haben eine Mietförderung, wir haben eine Crowdfunding-Förderung, wenn man versucht, über neue Finanzierungsmodelle ein Projekt sozusagen zu entwickeln und umzusetzen. Wir haben eine eigene Förderung für junge Menschen, die in einen Co-working-Space gehen und dort arbeiten wollen. Und das ist das Hauptspektrum unserer Förderungen, wirklich für Klein- und Kleinstunternehmen hier Angebote zu schaffen.
Und daneben, die zweite große Säule, die auch speziell für Kleinst- und Kleinunternehmen angeboten wird, ist unsere Servicerolle. Es vergeht kein Tag, wo wir nicht für irgendeine Unternehmerin oder einen Unternehmer einen runden Tisch organisieren mit vielen Abteilungen, weil manche Verfahren schon so komplex sind, dass eine Unternehmerin gar nicht mehr weiß, wo muss sie jetzt hin mit einem speziellen Anliegen. Und da kommt jetzt die Wirtschaftsabteilung ins Spiel, oft mit Information, Kommunikation, teilweise ist es Mediation, wo wir versuchen zu dolmetschen, was heißt der Bescheid jetzt wirklich für die Unternehmerin und für den Unternehmer. Wir können natürlich Gesetze nicht ändern, aber wir können helfen, Lösungen zu finden, die der Unternehmer oder die Unternehmerin dann auch versteht. Und dieses Miteinander zwischen unternehmerischen Anliegen und städtischer Verwaltung, das ist so auch eine sehr, sehr große Säule in unserem Aufgabenbereich. Wir haben eine eigene Service-Hotline, wo wir sozusagen tagsüber erreichbar sind und eben gerade bei Verfahrensangelegenheiten oder jeglicher Sorge, die ein Unternehmer oder eine Unternehmerin gegenüber der städtischen Verwaltung hat, können diese Menschen zu uns kommen, was speziell jetzt in Corona-Zeiten zum Beispiel auch der Fall ist.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt aber zum Beispiel, jetzt sage ich, ich möchte eine Firma gründen. Es ist soweit, ich gehe in die Selbstständigkeit, habe aber ganz viele Fragen, weil ich mich da in diesem ganzen Dschungel an Informationen nicht auskenne. Da kann ich wirklich bei euch anrufen oder vielleicht auch sogar zu euch hinkommen, einen Termin ausmachen und ihr helft mir da auch ein bisschen so durch.
Andrea Keimel:
Genau, genau. Das ist gerade in der Anfangsphase die große Herausforderung für Menschen, dass sie nicht wissen, wo docke ich an. Und wir haben sozusagen verschiedene Referenten, die dann schauen, wo musst du mit welchem Anliegen hingehen.
Also wir bündeln die Information, gerade in der Gründungsphase ist natürlich das Gewerbereferat oder ist auch die Wirtschaftskammer dann eine wichtige Stelle. Aber wir schauen uns einfach an, in welcher Phase befindet sich das Unternehmen und wo können wir die Leute dann wirklich gut weiter begleiten und auch die jeweiligen Kontakte herstellen.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt habt ihr so ein großes Arbeitsspektrum. Wie riesig ist die Abteilung? Weil das klingt ja danach, als müsste es ihr weiß nicht wie viel sein.
Andrea Keimel:
Wir sind gewachsen, also wir sind mittlerweile ein 30-köpfiges Team, haben in den letzten Jahren zwei Bereiche dazubekommen und zwar der ganze Bereich Filmförderung. Die Filmcommission ist jetzt auch ein Referat der Wirtschaftsabteilung und der ganze auch sehr spannende Bereich City of Design, wo es darum geht, wir sind ja City of Design und wie können wir Design im öffentlichen Bereich mehr sichtbar machen. Das ist dazugekommen und wie du sagst quasi der Aufgabenbereich dadurch, dass wir von der Landwirtschaft über die Kreativwirtschaft, über die Sorgen der Startups und der Gründer und Gründerinnen bis zum Gewerbeunternehmen, der Händlerin und dem Händler und letztlich dann auch die große Industrie alles abdecken mit unterschiedlichen Förderformaten, Veranstaltungsformaten ist natürlich auch die dementsprechende Qualifikation und ein dementsprechend starkes Team notwendig.
Simone Koren-Wallis:
Ihr wart jetzt auch erst vor kurzem in den Medien, weil es ist eine neue Wirtschaftsstrategie verabschiedet worden. Es war jetzt groß im Gemeinderat, man hat es überall gelesen. Was heißt das Andrea? Kann man das kurz erklären?
Andrea Keimel:
Strategie ist immer so ein sperriges Wort und man hat sofort im Kopf viel Papier, sehr theoretisch ist manchmal auch notwendig, wobei ich glaube es ist in jedem Arbeitsbereich notwendig, sich eine Strategie vorzunehmen und zu schauen, wie kann ich meine Ziele gut erreichen und wie kann ich auch schauen, dass ich dann wirksam werde und diese Ziele auch gut erfüllen kann. Wir haben den politischen Auftrag bekommen, einen Strategieprozess zu entwickeln, das heißt gerade, wie gesagt, in dieser Zeit, wo so viele neue Herausforderungen auf uns zukommen, gemeinsam für Graz diese Ziele außer Streit zu stellen. Und der Prozess war so ausgerichtet, dass wir viele Unternehmerinnen, viele Unternehmer aus allen Branchen, viele Organisationen, Institutionen, ganz stark auch die Grazer Politik eingebunden haben, damit es uns eben gelingt, diese Ziele gemeinsam außer Streit zu stellen. Weil es keinen Sinn hat, wenn jetzt die Wirtschaftsabteilung allein sich Ziele für den Wirtschaftsstandort vornimmt und wenn wir keine Menschen finden, die dann bei der Projektumsetzung diese Ziele miterfüllen. Das war der Prozess und wir haben im April dieses Jahres dann einen einstimmigen Beschluss erlangt im Gemeinderat. Das hat uns besonders gefreut, weil das ganze Team mitgearbeitet hat bei der Prozessausstellung. Es war viel Arbeit und wir haben dadurch, und davon bin ich wirklich überzeugt, die Chance bekommen und die Kraft jetzt gemeinsam Projekte umzusetzen. Und da ist jetzt schon ganz viel entstanden in den vielen Terminen, in den vielen Interviews mit unterschiedlichen Menschen und wir sind jetzt gerade in der Phase, diese ersten Projekte weiterzuentwickeln und umzusetzen.
Simone Koren-Wallis:
Hast du ein Beispiel?
Andrea Keimel:
Ein Thema, das uns im Moment ganz besonders beschäftigt, ist jetzt kein unmittelbares Zuständigkeitsthema der Wirtschaftsabteilung, aber ein Thema, das die Wirtschaft insgesamt betrifft, ist das Thema Kinderbetreuung.
Das ist fast in jedem Termin zur Wirtschaftsstrategie thematisiert worden mit dem dringenden Wunsch, neue Projekte zu überlegen, damit die Kinderbetreuung so gestaltet ist, dass beide Elternteile auch gut arbeiten gehen können, weil das eine Rahmenbedingung sein wird für die Zukunft, die die Unternehmen auch brauchen, damit sie überhaupt Menschen kriegen, die in die Arbeit kommen, damit sie die richtigen Menschen kriegen. Das kann die Wirtschaftsabteilung allein nicht leisten, weil wir werden jetzt mit vielen Ressorts gemeinsam versuchen, hier einfach neue Wege aufzuzeigen. Es sind viele Projekte an der Schnittstelle zwischen unseren Unternehmen und der Wissenschaft. Das ist eine große Stärke von Graz, das sind unsere Hochschulen, die Universitäten, die Fachhochschulen, die Forschungsebene, wo man gar nicht weiß, wie gut der Ruf unserer Universitäten international ist, also beneiden uns andere Städte darum. Und was in Graz super funktioniert, ist die Verbindung zwischen der Wirtschaft und dieser Wissenschaftsebene. Und an dieser Schnittstelle arbeiten wir als Abteilung.
Da gibt es einige Projekte, wo wir einfach die Unternehmen mit den Wissenschaftsvertretern zusammenholen, die Wissenschaftsvertreter wieder für die Unternehmen schauen, was kann man in den Unternehmen über die Angebote der Universitäten mit Diplomarbeiten, Dissertationen weiterentwickeln und so wieder den Unternehmen helfen. Also wir sind ganz oft an der Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Branchen und an der Schnittstelle zwischen zum Beispiel Wissenschaft und Wirtschaft tätig.
Simone Koren-Wallis:
Es geht also nicht nur um die Wirtschaft an und für sich, sondern es ist ein ganz großes Paket.
Andrea Keimel:
Es ist ein ganz großes Paket, auch zum Beispiel das Thema Innenstadt, das im Moment in jeder Stadt an der Prioritätenliste nach oben steigt, weil die Händlerinnen und Händler durch ein völlig anderes Konsumentenverhalten, das im Moment zu spüren ist, vor ganz großen Herausforderungen stehen. Also Online-Shopping ist ein Stichwort. Es kauft ein junger Mensch anders ein als ein alter Mensch. Und ein Händler muss einfach vor Ort agieren, muss aber gleichzeitig einen Online-Shop gut abwickeln können. Und da kommen auf Betriebe ganz große oder sind schon da, die großen Herausforderungen sind schon da, wo unsere Rolle es auch wieder jetzt ist, die Unternehmen am Weg dieser Digitalisierungsprozesse gut zu unterstützen.
Simone Koren-Wallis:
Also ihr macht wirklich alles. Also wenn ich jetzt wirklich sage, wie kann ich einen Webshop machen, dann kann man bei euch nachfragen. Und ihr habt vielleicht Ideen, ihr habt Kontakte auch, um das Ganze ein bisschen besser zu vernetzen.
Andrea Keimel:
Und vernetzen ist ein gutes Stichwort, weil auch dieser Netzwerkknoten bei uns auch durch viele Veranstaltungsformate wahrgenommen wird. Weil gerade bei jungen Unternehmen geht es ja darum, dass er vielleicht auch andere Branchen kennenlernt. Das heißt, ein Startup profitiert davon, wenn er über uns, über unser Netzwerk Industriebetriebe kennenlernen kann. Und umgekehrt, ein Industriebetrieb profitiert davon, dass er durch unsere Veranstaltungsformate die Ideen von jungen Unternehmen spürt und vielleicht mit einem jungen Unternehmen irgendwas gemeinsam machen kann. Also die Arbeit der Wirtschaftsförderung endet sich im Moment ganz, ganz stark.
Simone Koren-Wallis:
Wie komme ich zu den Veranstaltungen?
Andrea Keimel:
Wir haben Newsletter, die wir ausschicken. Wir haben eine ganz große Datenbank und wir kommunizieren über die Website, über Social Media. Wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Das heißt, wenn es Veranstaltungen gibt, erfahren die Unternehmerinnen und Unternehmer, dass die Wirtschaftsverteilung wieder ein neues Format hat, das wir vor allem in unserem Lendhafen machen.
Simone Koren-Wallis:
Was wünschst du dir für die Wirtschaft in Graz?
Andrea Keimel:
Dass dieses Miteinander, das wir jetzt auch im Strategieprozess begonnen haben und wo wir gesehen haben, dass alle mitmachen. Also sowohl die Unternehmer als auch Vertreter aus dem Haus Graz, die verschiedensten Organisationen, dass dieses Miteinander weiter funktionieren kann. Das haben wir uns auch vorgenommen aus dem Prozess jetzt zu verstärken, weil ich davon überzeugt bin, dass nur in diesem Miteinander der Standort wirklich gestärkt werden kann und wir auch wirklich die passenden Unterstützungsangebote und Formate jetzt für die Grazer Wirtschaft weiterentwickeln können. Und wenn wir das jetzt schaffen, dass wir einige Projekte gemeinsam umsetzen, mit dem Willen für Graz etwas zu tun, ja, dann wäre mein Wunsch erfüllt.
Simone Koren-Wallis:
In der nächsten Folge setzen wir uns ins IBOBB-Café. Da reden wir über Schule. Ja, das geht auch in den Ferien. Es geht um Schularten, um Weiterbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel auch für Erwachsene, ums Studium und vieles, vieles mehr.
Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Graz Geflüster, der Stadt Graz Podcast. Nicht gehen zu können, auf den Rollstuhl angewiesen zu sein. Wie geht es einem da in Graz? Und was bedeutet eigentlich Inklusion? Darüber sprechen wir heute und haben gleich alle Infos über die Woche der Inklusion für euch. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste Wolfgang Palle und Thomas Grabner.
Wolfgang Palle:
Mein Name ist Wolfgang Palle. Ich bin der Beauftragte der Stadt Graz für die Anliegen von Menschen mit Behinderung. Und meine Aufgaben sind einerseits, ich bin eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, für die Angehörigen, aber auch wirklich für alle, die Fragen zu diesem Thema haben. Damit kann man sich an mich wenden. Ich leite den Grazer Beirat für Menschen mit Behinderung. Das ist ein Gremium in der Stadt Graz, wo vor allem Selbstvertretungsvereine, also Menschen mit Behinderung, Trägervereine und die Abteilungen der Stadt Graz und die Politik der Stadt Graz drinnen sitzen. Und wo man sehr schnell sagen kann, was gebraucht wird und das kann dann schnell bearbeitet werden. Und drittens bin ich auch eine Stelle, die hinschauen muss in der Stadt Graz. Wo gibt es Barrieren? Wo gibt es Diskriminierungen? Und dann gemeinsam mit Selbstvertreter:innen Lösungen zu suchen, mit der Stadt Graz gemeinsam das zu verbessern.
Grabner Thomas:
Mein Name ist Grabner Thomas. Ich bin selbst ein Mensch mit Behinderung, nütze Krücken und bin vorwiegend im Rollstuhl unterwegs. Und meine Aufgabe ist im Verein Wegweiser als akademischer Peerberater das Thema Persönliches Budget. Und es geht um die Antragstellung, um die Assistenzsuche und um die Organisation. Mein großer Wunsch ist, dass Menschen mit Behinderung mehr ins Leben eingebunden werden. Sprich, dass Inklusion gelebt wird.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Was ist eigentlich Inklusion? Inklusion heißt, dass Menschen mit Behinderung ihr Leben nicht mehr an vorhandene Strukturen anpassen müssen. Und wir alle sind dazu aufgefordert, Strukturen zu schaffen, die es jedem Menschen ermöglicht, von Anfang an ein wertvoller Teil der Gesellschaft zu sein. Jetzt findet von 3. bis 9. Juli wieder die Woche der Inklusion in der Stadt Graz statt. Lieber Wolfgang, warum braucht man das überhaupt?
Wolfgang Palle:
Es ist so, dass in Graz ganz, ganz viele Menschen 365 Tage im Jahr für Inklusion kämpfen. Das sind einmal in erster Linie die Selbstvertretungsvereine, also Menschen mit Behinderung selbst, die wirklich Tag für Tag beraten, Tag für Tag auch politisch die Sache der Barrierefreiheit, der Antidiskriminierung weiterbringen. Es gibt die Trägervereine, wo Menschen für Menschen mit Behinderung arbeiten. Es gibt die Abteilungen der Stadt Graz zum Beispiel, aber auch viele andere Institutionen, wo Tag für Tag für Inklusion gearbeitet wird. Und einmal im Jahr darf es auch eine Woche geben, wo diese ganzen Bemühungen der Selbstvertreter, der Träger und von allen anderen stolz hergezeigt werden dürfen. Das ist eine der großen Aufgaben der Woche der Inklusion. Eine weitere Zielsetzung für mich ist einfach die Information. Menschen mit Behinderung und Angehörige sollen einmal auch die Angebote wieder einmal deutlich kennenlernen. Viele Menschen wissen gar nicht, was es eigentlich alles gibt an Angeboten, wo kann man sich anschließen etc. Es ist ein wirklich groß angelegtes Sensibilisierungsprojekt, wo wirklich einmal wieder die gesamte Bevölkerung sehen kann, Menschen mit Behinderung gehören einfach dazu, das ist gar keine Frage. Die sind genauso wertvolle Mitglieder wie alle anderen in unserer Gesellschaft. Und das soll einmal wieder deutlich werden. Menschen mit Behinderung mit ihren Problemen, aber natürlich auch mit ihren Stärken und Möglichkeiten. Und dann gibt es noch die Woche der Inklusion soll Spaß machen, man soll etwas lernen können, man soll andere Menschen treffen können, man soll sich auch wieder gut als Community spüren können. Das alles sind Zielsetzungen.
Simone Koren-Wallis:
Das sind alles Zielsetzungen. Thomas, darf ich dich fragen, wie weit stimmt die Inklusion schon?
Grabner Thomas:
Ja, ich persönlich finde, dass in Graz selbst sehr viel getan wird. Inklusion heißt ja jetzt nicht nur eine Verbesserung für Rollstuhlfahrer, sondern grundsätzlich für alle Menschen und Gruppen. Egal ob ich jetzt im Rollstuhl sitze oder ob ich nichts sehe, nichts höre, ob ich vielleicht nur vorwiegend einmal einen Gips habe und da eine Gangerschwernis habe oder was auch immer. Es gibt in Graz verschiedenste Lösungen schon. Sprich, wenn ich jetzt als Rollstuhlfahrer die Geschichte hernehme, dann habe ich abgeflachte Gehsteigkanten. Wenn ich jetzt nichts höre, habe ich bei den Ampeln ein Signal kommt oder was auch immer. Oder eben, wenn ich jetzt nichts sehe, die akustischen Ampeln. Und auch bei der BIM ist es so, dass ja auch die Fahrer sehr hilfsbereit sind. Es gibt ja auch das Notenfeld in Graz, wo man sich hinstellen kann als Mensch mit Behinderung. Dass der Fahrer oder die Fahrerinnen sehen, okay, da ist jemand, der Hilfe braucht. Inklusion ist ja auch so, dass es jetzt nicht nur für Menschen mit Behinderung ist, sondern auch für alle. Sprich, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund ein Problem habe, dann kann ich das nutzen. Und das ist das Tolle.
Simone Koren-Wallis:
Da reden wir jetzt hauptsächlich über diese baulichen Geschichten oder bei der Straßenbahn, was es alles gibt. Wie weit ist denn die Inklusion schon in den Köpfen der Menschen? Wolfgang, was sagst du?
Wolfgang Palle:
Ja, Inklusion in Graz ist schon sehr weit fortgeschritten, muss man sagen, im Vergleich zu anderen Städten. Es ist, sagen wir mal so, als Behindertenbeauftragter in Graz sicherlich lustiger als in manchen anderen Landeshauptstädten. Also der Beirat und auch ich als Beauftragter wären von der Politik schon sehr gehört. Das Thema wird ernst genommen. Es ist kein Nebenthema, das muss man sagen. Also hier sind wir in Graz durchaus weit.
Grabner Thomas:
Wie schon gesagt, in Graz sind die Menschen sehr, sehr hilfsbereit. Es ist, glaube ich, nur oft die große Angst, ob ich jetzt den Menschen irgendwie falsch anspreche. Das ist ein Problem, dass man nicht sagt, ich habe die Person diskriminiert, weil ich jetzt da helfen wollte. Ich glaube, es ist nur oft die große Angst, darf ich das fragen, darf ich das machen? Und ich glaube, wenn man die Angst da abbaut, dass das dann weniger ein Problem ist. Ich finde, dass die Menschen grundsätzlich hilfsbereit sind.
Simone Koren-Wallis:
Aber darf ich fragen? Wie gehst du persönlich damit um?
Grabner Thomas:
Grundsätzlich darf man immer fragen, weil es ist ja doch schön, wenn man Menschen hilft oder was auch immer. Ob ich das jetzt so an nehme oder ob ich sage, danke für das Angebot, aber das funktioniert, das geht. Das ist dann auch in Ordnung, das passt schon. Und das meine ich jetzt aber nicht als Zurückweisung. Du hast jetzt gefragt und lass mich in Ruhe, sondern eher Dankeschön, dass du gefragt hast, aber das schaffe ich alleine. Man darf fragen, sicher.
Simone Koren-Wallis:
Man darf eigentlich jeden Menschen fragen, warum nicht auch jemanden, der vielleicht im Rollstuhl sitzt oder der schlecht sieht. Wolfgang, vielleicht ganz kurz auch zur Woche der Inklusion selbst. Also alle Veranstaltungen werden wir jetzt in dieser Podcast-Folge nicht aufzählen können, weil es gibt ganz, ganz viele. Alles zu sehen auf graz.at//info-behinderung. Magst du vielleicht ein, zwei Veranstaltungen besonders rausnehmen, vielleicht auch den Tag im Rathaus?
Wolfgang Palle:
Ja, wir haben am 3. Juli einen Aktionstag im Rathaus. Das wird eine sehr große Veranstaltung. Da sind von 9 bis 11 Uhr Schulklassen eingeladen. Und im Rathaus sind verschiedene Trägervereine und vor allem Selbstvertretungsvereine anwesend, die für dieses Thema sensibilisieren, die ihre Arbeit herzeigen. Der Blindenverband ist da. Wie ist es blind zu sein? Was brauchen blinde Menschen? Man wird herzeigen, Geräte, um sich gut zu verständigen. Es ist da ein Rollstuhlparcours. Blindendennis wird gezeigt. Unterstützte Kommunikation wird gezeigt. Und verschiedenste andere Stationen, immer zum Thema Behinderung, immer zum Thema Inklusion. Um 11 Uhr wird es die große Eröffnung geben am Hauptplatz unten. Und dort wird auch ein Flashmob stattfinden mit der Tanzschule Coni und Tado, wo alle teilnehmen können. Ab 11.30 Uhr ist das Rathaus geöffnet für alle, die kommen wollen und sich das anschauen mögen und mit den Behindertenvertreterinnen und Trägervereinen in Kontakt treten möchten. Neben dem Rathaustag gibt es dann, ich habe da jetzt gerade die Liste, mittlerweile 26 Veranstaltungen wird es geben in dieser Woche. Und da kommen laufend noch neue dazu. Straßenfeste zum Beispiel haben wir dabei. Gartenfest, eine inklusive Theateraufführung von Kindern mit und ohne Behinderungen. Angebote für unterstützte Kommunikation. Es gibt Angebote in den Museen. Also es ist ein reichhaltiges Angebot.
Simone Koren-Wallis:
Nachdem ja auch ganz viele Schulklassen kommen, wie du schon gesagt hast, Wolfgang, gehen Kinder mit diesem Thema eigentlich ganz anders um? Was hast denn du da schon für Erfahrungen gemacht?
Grabner Thomas:
Kinder sind da sehr locker. Die sind neugierig und auch sehr süß. Die gehen nämlich her und sagen, was hast du? Hast du Fußweh oder was ist los? Und dann kann man das erklären. Und die sind dann zufrieden. Die wollen nur wissen, warum sitzt man da? Warum hupfe ich nicht so rum und um wie sie? Aber es ist lustig, es ist süß.
Simone Koren-Wallis:
Würdest du dir das auch von den Erwachsenen wünschen? Oft, dass die auch ein bisschen kindlicher an diese ganze Sache rangehen?
Grabner Thomas:
Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, dass da auch die Eltern von den Kleinen lernen können. Was wünscht ihr euch? Ich meine, ihr habt es jetzt beide gesagt. Es ist schon so viel getan oder es wird auch immer mehr getan. Aber was wünscht ihr euch zum Thema Inklusion?
Wolfgang Palle:
Ich werde immer gefragt, wie ist die Situation in Graz in Bezug auf Inklusion? Da muss man sagen, einerseits natürlich sehr gut. Im Vergleich zu den meisten Städten in Österreich sehr gut. Im Vergleich auch zu internationalen Städten sehr gut. Ich war in Brüssel. Brüssel kann bei weitem nicht mithalten mit Graz. Auf der anderen Seite sage ich immer, man muss sich halt nur einmal in den Rollstuhl setzen selber und einmal eine kleine Runde durch Graz fahren. Dann sieht man sehr schnell, was alles noch zu tun ist. Also Raum nach oben gibt es immer. Und man darf ja nicht nur denken an Personen im Rollstuhl, sondern man muss eben denken an das ganze Spektrum an Personen mit psychischer Erkrankung, an Personen mit Epilepsie, an Personen, die gehörlos sind, die schwerhörig sind und, und, und. Hier begeben wir uns gerade auf ein neues Niveau, wo wir schauen müssen, okay, da gibt es natürlich noch viel zu tun.
Simone Koren-Wallis:
Aber es sind ja so quasi diese Grundgeschichten, die du da auch ansprichst. Und wir haben ja auch die Wirtschaft mit ins Boot geholt. Die ist ja auch dabei bei der Woche der Inklusion, um einfach einmal aufzuzeigen, jeder von uns würde gerne einmal einkaufen gehen, aber ich komme nicht in jedes Geschäft.
Wolfgang Palle:
Ja genau, im Rahmen der Woche der Inklusion gibt es auch die Schaufensteraktionen der Herrengasse. Also Geschäfte in der Herrengasse und rund um die Herrengasse gestalten ihre Schaufenster mit Schaufensterpuppen im Rollstuhl oder mit zum Beispiel Blindenstock. Es soll vor allem einmal die Botschaft gezeigt werden, Menschen mit Behinderung sind genauso eine zahlungskräftige Kundengruppe, die genauso das Recht hat einzukaufen und genauso den Wunsch hat einzukaufen. Und es braucht halt noch viel, dass das einfach auch wirksam wird. Ich finde, diese Schaufensteraktion ist eben ein erster Schritt in diese Richtung, eine erste Sensibilisierung.
Simone Koren-Wallis:
Aber ich glaube, du hast jetzt eh gerade schon richtig gesagt, es geht darum, diese Inklusion das ganze Jahr stattfinden zu lassen. Also ich glaube, das ist von allen, auch von den Trägervereinen ein großer Wunsch sozusagen, quasi ein Jahr der Inklusion, oder kann man das so sagen?
Grabner Thomas:
Ein Jahr der Inklusion oder ein Leben mit Inklusion. Und ich glaube, dass das irgendwann vielleicht möglich ist, mit Full-Sensibilisierungsarbeit, aber auch jetzt nicht nur das auszulagern an ein paar Menschen und zu sagen, hey, kämpft's darum. Ich finde, dass jeder Mensch sich bemühen sollte, das zu zeigen, dass das normal ist und dass das eigentlich kein Problem ist. Und ich glaube, erst dann wird es leichter.
Simone Koren-Wallis:
Kennen Sie ja das Sprichwort, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut. Das ist das Thema in der nächsten Folge von Graz Geflüster. Wir hören uns, ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 14: Stadtarchäologie: Fundstücke (und Schätze) aus dem Grazer Boden
Wusstet Sie eigentlich, dass der Grazer Hauptplatz mal viel mehr bebaut war?
Oder dass man in Grazer Bombentrichtern schon wahre Schätze gefunden hat und auch noch weiter finden wird?
Und dass es eine eigene Stadtarchäologie in der Stadt Graz gibt?
Das gibt's alles in dieser Folge von Grazgeflüster mit der Stadtarchäologin Susanne Lamm.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Graz Geflüster, der Stadt Graz Podcast. Das ist eine Folge für alle Mamas und Papas und die es noch werden wollen zum Thema Ernährung bei Kindern. Wobei es ist auch was für alle anderen, die, wie sage ich das jetzt schön, die gern anderen Tipps geben, wie ihre Erziehung besser funktionieren würde. Ich bin Simone Korren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation, mein Gast Ines Pamperl.
Ines Pamperl:
Ja hallo, ich heiße Ines Pamperl, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin, ich leite den ärztlichen Dienst, der gehört zum Amt für Jugend und Familie. Und seit 2007 bin ich Ärztin dort, seit 2017 darf ich den ärztlichen Dienst auch leiten.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Essen und Kinder ist oft ganz spannend. Ines, da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt, oder?
Ines Pamperl:
Ja, also da kann man schon seine lieben Überraschungen erleben, von Kindern, die Oliven lieben, bis zu denjenigen, wo man glaubt, sie verhungern lieber, bevor sie essen. Also da kann Essen durchaus einmal eine Herausforderung werden. Also Essen ist nicht immer easy cheesy, sondern auch manchmal Stress und Herausforderung.
Simone Koren-Wallis:
Was gibt es jetzt in der Stadt Graz, wenn man als Mama oder Papa wirklich sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, mein Kind isst nichts, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Gibt es da auch Beratungen bei euch, weil ich glaube, du bist ja spezialisiert auf das auch.
Ines Pamperl:
Ja, ich habe mich schon sehr früh während des Studiums und während des Turnus auch für Ernährung interessiert und in diese Richtung auch immer weitergebildet. Ich habe auch das Diplom für Ernährungsmedizin und im Rahmen meiner Tätigkeit von Beginn an, also seit 2007, gibt es die sogenannte Ernährungsmedizinische Beratung im ärztlichen Dienst. Das heißt, es ist eine kostenlose Möglichkeit für Eltern mit ihren Kindern zu allen Themen der Ernährung. Ich kann mich einfach gut beraten, glaube ich. Man darf sich nicht erwarten, dass man jetzt einen Diätplan bekommt, sondern es ist einmal ein erster Blick auf die Esssituation. Und es kann sein, dass es ein Problem gibt mit der Beikost, es kann sein, dass Kinder vielleicht zu leicht sind oder sehr häufig natürlich im schulischen Kontext, dass ein bisschen zu viele Kilos bereits am Körper sind.
Simone Koren-Wallis:
Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen und da hat mir eine Aussage von dir, also die ist mir extrem hängen geblieben und zwar, bei Kleinkindern hat die Ernährung auch mit Macht zu tun. Kannst du das bitte noch einmal erläutern? Das war sehr, sehr spannend.
Ines Pamperl:
Also Kinder finden sehr schnell heraus, wie sie Eltern auch beeinflussen können und mit Essen geht das sehr gut. Also entweder positiv oder negativ kann die Reaktion darauf sein. Ein Kind, das nicht isst, macht Stress bei Eltern. Ein Kind, das ständig das Essen runterschmeißt, macht Stress bei Eltern. Ein Kind, das nur Süßigkeiten isst und das Gemüse nicht anrührt, macht Stress bei Eltern. Und natürlich reagieren wir als Eltern dann auch wieder gestresst und so kann sich manchmal ein Teufelskreis aufbauen. Kinder haben in dem Fall sehr schnell Macht über ihre Ernährer.
Simone Koren-Wallis:
Das klingt gut. Ich meine, es gibt jetzt wahrscheinlich keinen Satz, wo du sagen kannst, probier uns das oder probier uns das. Es ist wahrscheinlich wirklich von Familie zu Familie unterschiedlich.
Ines Pamperl:
Also sehr wichtig ist, dass der Zugang, den ich gewählt habe, sehr individuell ist. Also bei mir kann man sich nicht erwarten, wie ich schon gesagt habe, einen Dateplan zu erhalten. Für mich ist einmal wichtig zu wissen, wie schaut der Tagesablauf aus? Wann wird gemeinsam gegessen? Wird überhaupt gemeinsam gegessen? Wo wird gegessen? Was wird gekocht? Wie wird gekocht? Wer kocht? Wer ist noch in der Familie? Zum Beispiel ist es natürlich sehr häufig, wenn ein Elternteil oder beide Elternteile auch sehr wählerisch sind, was Gemüse anbelangt, wäre ich wahrscheinlich nicht einen Gemüsetiger oder ein Gemüsekätzchen heranziehen. Das wird wahrscheinlich eher schwierig sein.
Simone Koren-Wallis:
Was ist denn eigentlich da dran, wenn man, das habe ich schon ein paar Mal gehört, wenn man in der Schwangerschaft besonders viel Gemüse isst, dann mag das das Kind dann auch. Stimmt das?
Ines Pamperl:
Ja, also die Forschungsergebnisse weisen alle darauf hin, dass gewisse Geschmacksstoffe bereits über das Fruchtwasser aufgenommen werden. Das heißt, das Kind lernt schon im Mutterleib quasi mit gewissen Geruchs- und Geschmacksstoffen umzugehen. Und ganz interessant, du lachst jetzt, aber ich muss jetzt diese lustige Geschichte erzählen von einer relativ aktuellen Studie, wo geschaut wurde, wie ungeborene Kinder darauf reagieren, wenn Mütter sehr viel Kohl essen. Und das war so, dass sie das Gesicht sehr stark verziehen, weil es nicht besonders geschmeckt hat. Das heißt aber jetzt nicht, dass das Kind das dann nicht mag, wenn es auf der Welt ist. Das heißt nur, dass es vielleicht nicht so viele süßliche Komponenten hat wie vielleicht Erdbeeren. Kohl hat sehr viel Bitterstoffe und die dürften dann in die Plazenta übergehen. Und dann macht das Kind halt so einen Gesichtsausdruck, der darauf hinweist, dass es jetzt nicht gerade so der Burner ist.
Simone Koren-Wallis:
Ich habe der Essling gerade so gelacht, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist das der Grund, dass meine kleine Tochter so gern Schokolade mag, nachdem in der Schwangerschaft vielleicht doch die Anderen Schokolade gegessen haben.
Ines Pamperl:
Nein, also nicht nur im Fruchtwasser sind Geruchs- und Geschmacksstoffe, sondern natürlich auch in der Muttermilch. Das heißt, je ausgewogener oder noch besser, je vielfältiger sich die Mama in der Schwangerschaft und während der Stillzeit ernährt, umso eher ist das Kind bereit, Neues auszuprobieren. Das dürfte wirklich stimmen.
Simone Koren-Wallis:
Aber gibt es sowas, also ich gebe zu, ich mache das manchmal auch, wenn du aufisst, dann bekommst du ein Eis. Okay, das ist nicht so gut.
Ines Pamperl:
Nicht unbedingt so gut. Also Essen soll in jeder Hinsicht stressfrei sein, gleichzeitig soll es auch keine Belohnung sein. Essen gehört dazu, so wie Atmen und Schlafen zum Leben gehört Essen auch dazu. Natürlich, ich habe auch zwei Kinder und na klar, auch ich habe immer wieder mit Eis belohnt. Kommt natürlich vor, grundsätzlich sollte Essen einfach was Normales sein. Man sollte nach Möglichkeit im Familienverband gleichzeitig mindestens einmal am Tag gemeinsam essen, das sogenannte Familienessen, und als Belohnung oder als Drohung sollte Essen nicht eingesetzt werden. Belohnung ist besser mit dem Kind Radfahren gehen, Fangenspielen, Versteckenspielen, Bewegung ist die beste Belohnung für ein Kind. Rausgehen, aber Essen als Belohnung wird nicht empfohlen.
Simone Koren-Wallis:
Das habe ich schon an deinem Gesichtsausdruck gemerkt. Aber manchmal merke ich es ja selber, wo ich mir denke, diese Wenn-Dann-Sätze sind ja sowieso...
Ines Pamperl:
Und auch das Aufessen-Müssen ist so ein Thema. Wichtig ist mir, dass Kinder lernen, dass man kostet. Also wo ich versuche, die Eltern zu beraten ist, dass es nicht zu akzeptieren ist, wenn das Kind sagt, das schmeckt mir nicht. Je nach Alter des Kindes frage ich zum Beispiel in der Beratung, gut, es schmeckt dir nicht, wie schmeckt es denn? Dann kommt sehr häufig, keine Ahnung, sage ich, naja, warum kannst du sagen, es schmeckt nicht? Wann hast du es das letzte Mal gegessen, zum Beispiel Gurke? noch nie. Oder ja, vielleicht, ja, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Das heißt, ich versuche dann Eltern und auch Kinder, Jugendliche in diese Richtung zu führen, dass ich nicht einfach sagen kann, es schmeckt nicht, wenn ich nicht einmal weiß, wie es schmeckt. Wenn ich vielleicht vor zwei, drei, vier, fünf Jahren vielleicht einmal schlechte Erfahrungen gemacht habe mit einem Lebensmittel, heißt das nicht, dass es mir nicht schmeckt, sondern dass in diesem Zusammenhang mit dem Lebensmittel vielleicht etwas war, was mich gestresst hat. Vielleicht war gerade Streiterei vorher oder ich musste als kleines Kind vielleicht irgendwas aufessen und habe deswegen eine negative Erfahrung mit dem Lebensmittel gemacht. Also wichtig ist, ich muss 10, 12, 15 Mal ein Lebensmittel kosten in unterschiedlichen Varianten. Wenn man bei der Karotte bleibt, es gibt die Frühkarotte, es gibt die Lagerkarotte, es gibt sie gerieben, gepresst als Suppe, als Salat, im Kuchen, im Smoothie. Ich kann sie in eine Sauce hineinverarbeiten. Wenn ich weiterreden könnte und mehr Zeit hätte, fangen wir da auf 50 Möglichkeiten an, wie ich Karotte zubereiten kann. Also zu sagen, mir schmeckt Karotte nicht, akzeptiere ich nicht.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt habe ich aber in meiner Familie so einen Fall, und zwar ist das meine Nichter, bald drei. Die ist so ein sturer Bock und die nimmt auch wirklich das Becherl her und sagt, nein, schmeckt nicht. Und du Zweig, was macht man in diesem Fall?
Ines Pamperl:
Einmal schauen, was genau schmeckt nicht. Manche Kinder mögen nicht, wenn was vermischt ist. Also die mögen vielleicht lieber die Nudeln extra und die bleiben bei der Karotte, die Karottensauce extra. Aber einmal schauen, vielleicht ist es das. Wenn man bei der Karotte bleibt, weil ich vorher gesagt habe, ich akzeptiere, das schmeckt nicht. Nicht. Natürlich, wenn dann alle Varianten durchgekostet sind und es ist noch immer so, dass es nicht schmeckt, dann ist halt die Karotte ein Lebensmittel, das nicht schmeckt. Aber bevor ich nicht alle Varianten gekostet habe, möchte ich es nicht so gerne akzeptieren. Und in dem Fall von dem dreijährigen Mädchen würde ich einmal weiterfragen, was ist sie, wann ist sie, wie war die Phase, wie die Beikost eingeführt wurde, war das stressfrei, wo ist sie vielleicht besser als zu Hause oder bei der Verwandtschaft, was mag sie gerne. Und mit einem dreijährigen Kind kann ich natürlich noch nicht so sprechen wie mit einem Sechsjährigen, aber ich kann versuchen, da konsequent zu sein zumindest. Also ich kann sagen, gut, es schmeckt dir nicht, aber ich möchte nicht haben, dass du das Essen durch die Gegend schmeißt oder sagst, weh, das mag ich nicht. Sondern sagen, gut, schmeckt dir das, ja, nein, aber ein weh oder ein grausliches, das würde ich nicht akzeptieren. Das geht auch beim dreijährigen Kind schon.
Simone Koren-Wallis:
Ich höre auch schon wieder meine Mama, die sagt, man macht sich ja viel verdammt Damm ums Essen mit den Kindern. Aber das muss man schon sagen, es hat sich sehr viel geändert, oder, von dem, wo wir noch Kinder waren und jetzt, oder?
Ines Pamperl:
Ich glaube, es ist einfach, dass man als Elternteil alles richtig machen möchte. Und es gibt sehr viele Informationen, die man sich holt aus dem Internet, von Freunden, aus den sozialen Medien und man möchte einfach alles perfekt und toll machen und oft übersieht man dabei, dass es vielleicht zu kompliziert ist. Und dass das Kind vielleicht lieber einen Apfelmus möchte, als jetzt, weiß ich nicht, Ananas, Superfood mit Chia oder sonst irgendwas.
Simone Koren-Wallis:
Wichtig ist, glaube ich, wenn man zum Beispiel dann auch zu einer Beratung geht und sagt, ok, man traut sich jetzt, wobei, trauen, ja, man muss einmal sagen, ok, ich schaue mir das jetzt einfach an, ich rede mit einem Profi, so wie mit dir und schaue, ob ich mich da irgendwie helfen lassen kann, damit man einfach besser gemeinsam isst, oder?
Ines Pamperl:
Ja, das finde ich einen guten Schlusssatz. Gemeinsam ist immer gut.
Simone Koren-Wallis:
Alle Infos findet ihr übrigens auch gesammelt auf graz.at-familie. Wie ist es eigentlich, mit einem Rollstuhl zu fahren? Wie ist es, blind zu sein? Wie geht es einem Menschen mit Behinderung in Graz? Das hören wir in der nächsten Folge. Da geht es nämlich um Inklusion und die Woche der Inklusion im Juli in Graz.
Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 13: Für den Fall des (Not-)Falles: wie gut ist Graz vorbereitet?
Was macht die Stadt Graz, um auf alle möglichen Krisen vorbereitet zu sein? Was kann jeder von uns machen, um für den Notfall gewappnet zu sein und wo und wozu gibt es Leuchttürme in der steirischen Landeshauptstadt? Eine Grazgeflüster-Folge mit dem Sicherheitsmanager der Stadt Graz Gilbert Sandner.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Graz Geflüster, der Stadt Graz Podcast. Heute erfahren wir alles über die Grazer Leuchttürme. Ja, die gibt's. Außerdem, was machen wir bei einem Blackout? Wie wahrscheinlich ist sowas überhaupt? Und wie sorge ich einfach sicherheitshalber vor? Das gibt's heute in unserer Folge mit dem Sicherheitsmanager der Stadt Graz. Ich bin Simone Korenwallis aus der Abteilung für Kommunikation, mein Gast Gilbert Sandner.
Gilbert Sandner:
Mein Name ist Gilbert Sandner, Sicherheitsmanager der Stadt Graz seit mittlerweile zwei Jahren und darf alle Belangen rund um das Thema Sicherheit innerhalb der Stadt Graz mit meinem Referat bearbeiten.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Mein Mann hat vor ein paar Jahren ein Kurbelradio mit LED-Lampe gekauft. Lieber Gilbert, brauchst du also ein Kurbelradio zu Hause?
Gilbert Sandner:
Also ich glaube, als Sicherheitsmanager zu Hause vorzubereitet sein, ist das einmal eins eines Sicherheitsmanagers, ja.
Simone Koren-Wallis:
Erklär mal kurz, was ist so ein Kurbelradio?
Gilbert Sandner:
Ja, ein Kurbelradio ist ein Radio mit einem eingebauten Akku, den man entsprechend mit der Kurbel wieder aufladen kann und somit auch im Fall eines Stromausfalls Radio hören kann. Meistens sind sie so eierlegende Wollmilchsäue unter Anführungszeichen, die nicht nur Radio hören können, sondern auch Taschenlampen in einem sind oder wo man wieder Handys aufladen kann. Also so ein Allzweckinstrument für Krisenmanager.
Simone Koren-Wallis:
Wir sind jetzt schon mittendrin im Thema Krise, Notfall. Wie sehr bereitet sich die Stadt Graz für einen etwaigen Notfall vor? Ich meine, wir haben es jetzt eh alle gehabt. Corona war da sicher auch ein großes Thema dahinter. Man hört jetzt überall Blackout oder auch Brownout. Vielleicht kommen wir da später auch noch dazu, für die, die das noch nicht gehört haben. Was macht die Stadt, um die Stadt krisensicher zu machen?
Gilbert Sandner:
Ja, also das Referat Sicherheitsmanagement und Bevölkerungsschutz in der Magistratsdirektion der Stadt Graz in Zusammenarbeit mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im behördlichen Führungsstab, aber auch generell als Querschnittsmanager in der Stadt Graz, im Haus Graz, bereiten sie für unterschiedlichste Szenarien, Krisenszenarien, Katastrophenszenarien vor. Und das nicht erst seit Corona oder jetzt seit Brownout, Blackout, sondern schon viel, viel länger. Dahinter liegen gibt es bei uns einen Katastrophenschutzplan, der um die 15 Szenarien beinhaltet, die sie die Stadt Graz entsprechend im Detail anschaut, mit allen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Querschnitte schafft und damit versucht, ja, möglichst, das neue Wort resilient, aber möglichst gut für solche Szenarien und Vorfälle vorbereitet zu sein.
Simone Koren-Wallis:
Ich glaube, die Ausdrücke kennt wirklich fast ein jeder, weil vielleicht können wir es trotzdem kurz erklären. Blackout ist?
Gilbert Sandner:
Blackout ist ein überregionaler, länger andauernder Stromausfall. Er ist nicht nur auf Graz begrenzt, sondern wirklich auf die Steiermark, Österreich oder europaweit.
Simone Koren-Wallis:
Brownout?
Gilbert Sandner:
Brownout wird definiert für eine Energiemangellage eigentlich, so wie sie im Winter eben gedroht hat. Das ist dann, wenn wir mehr Stromnachfrage haben, als Stromangebot am Markt haben.
Simone Koren-Wallis:
Und das dann wirklich zielgerichtet ausgeschalten wird für gewisse Zeit.
Gilbert Sandner:
Genau, um diese Balance in der Waage wieder zu erreichen und eigentlich damit einen Blackout zu verhindern.
Simone Koren-Wallis:
Wie wahrscheinlich ist sowas? Also gibt es ja die ganzen Wahrscheinlichkeitstheorien. Du lachst schon, weil es ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten, oder?
Gilbert Sandner:
Ja, genau. Also wirkliche Evidenz dahinter, wie wahrscheinlich so ein Szenario Blackout ist, ist sehr schwierig zu sagen. Die Sicherheitspolitische Jahresforschung des Österreichischen Bundesheeres schließt oder teilt Blackout als wahrscheinliches Szenario mit ein. Wenn man mit den Netzbetreibern spricht, können sie natürlich wieder aus technischer Sicht solche Szenarien wie ein Blackout möglichst gut ausschließen. Also es ist sehr, sehr schwierig und vage für uns auch. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Blackout ist eines der schwierigsten Szenarien. Warum? Weil für uns immer wieder Kommunikationsschienen damit ausfallen. In anderen Krisenfällen oder Katastrophenfällen, wo wir miteinander reden können und kommunizieren können, tun wir uns natürlich wesentlich leichter.
Simone Koren-Wallis:
Da gibt es sicher einige, die sagen, dass sie nur Panik machen. Aber ich denke mir doch, lieber vorbereitet zu sein, oder? Und es kommt nichts daher, als es kommt etwas daher. Und man steht dann da und denkt sich, super, und was machen wir jetzt?
Gilbert Sandner:
Ich vergleiche es immer vorher, wie ich zu Hause einen Feuerlöscher habe. Ich hoffe auch nicht, dass zu Hause bei mir irgendwo ein Brand ausbricht. Aber ich habe deswegen genauso einen Feuerlöscher daheim. Und wenn ich darauf vorbereitet bin und das Feuer löschen kann, dann ist mir hoffentlich nicht mehr passiert, als wie der kurze Schrecken eigentlich.
Simone Koren-Wallis:
Wie vorbereitet ist man jetzt? Was macht die Stadt Graz? Hast du zum Beispiel Beispiele? Vielleicht auch das Thema Leuchtturm, weil ich glaube, das weiß auch nicht jeder. Was hat das mit den Leuchttürmen auf sich?
Gilbert Sandner:
Wenn wir davon ausgehen, dass es zu einem Blackout kommt, dann gehen wir auch davon aus, dass binnen 30 Minuten die Telekommunikationsinfrastruktur ausfällt. Das heißt, es geht kein Internet, es geht kein Telefon, es geht kein Festnetztelefon und dergleichen. Und dann ist es natürlich auch schwierig, in Notfällen Hilfe zu rufen. Deshalb gibt es in der Stadt Graz über das Stadtgebiet verteilt sogenannte 11 Leuchttürme in der Kooperation mit der Diözese Graz-Seckau und auch der Evangelischen Kirche, wo wir Anlaufpunkte zur Verfügung stehen, um einerseits dort Hilfe, Gesuche abgeben zu können und andererseits dann wir über diese sogenannten Leuchttürme entsprechend auch ein Hilfsangebot oder Unterstützungsangebot liefern können in Zusammenarbeit.
Simone Koren-Wallis:
Das klingt irgendwie alles so utopisch. Und auf der anderen Seite kriege ich dann fast Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil beim letzten großen Sturm hatten wir, glaube ich, acht Stunden kein Strom zu Hause. Das war Wahnsinn. Wirklich, ich wollte kochen gehen, also ich habe meinen Herd versucht einzuschalten, das Licht sowieso ist ja immer ein- und ausgeschalten. Das heißt, wir können das ja gar nicht greifen, oder? Uns ist das ja gar nicht bewusst, was das bedeutet. Sollte der Strom weg sein oder auch, wenn das Handy nimmer geht, oder? Ist das schon in den Köpfen drin?
Gilbert Sandner:
Nein, ich glaube, so weit ist es in den Köpfen noch nicht drinnen. Und da ist es auch entsprechend wichtig, dass man Aufklärungsarbeit schafft. Wir im Referat haben auch angesiedelt die Bezirksstelle des Zivilschutzverbandes für Graz Stadt und versuchen gemeinsam auch mit dem Zivilschutzverband und über eigene Initiativen immer wieder rauszugehen in die Stadt, das Thema der Eigenvorsorge da entsprechend an die Bürgerinnen und Bürger zu bekommen und somit in der Summe das Sicherheitslevel unter Anführungszeichen zu erhöhen.
Simone Koren-Wallis:
Vielleicht ist es genau schon das Thema Eigenvorsorge. Was kann ich als Grazerin, als Grazer machen, damit ich zumindest vorgesorgt habe?
Gilbert Sandner:
Wichtig ist, glaube ich, in der Eigenvorsorge für sich selbst unter Anführungszeichen ein sicheres Zuhause zu schaffen. Dass ich zuhause entsprechend Lebensmittel vorgesorgt habe, dass ich zuhause natürlich auch Trinkwasser vorgesorgt habe. Auch wenn wir dahinter liegen als Stadt Graz und als Haus Graz und daran arbeiten, die Dinge wie Wasserversorgung und Co. auch im Falle eines Blackouts sicherzustellen, ist es natürlich ein wesentlicher Part und Säule generell im Katastrophenmanagement die Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger. Das heißt aber auch, wenn ich nicht mehr kommunizieren kann, dass ich mit meinen Liebsten, meinen Angehörigen, möglicherweise auch zu betreuenden Angehörigen ausgemacht habe, wie wir in so einem Falle vorgehen, wo treffen wir uns, dass ich mir weiß, wo sind meine wichtigsten Dokumente in diesem Fall, habe ich meine wichtigen Apotheken, also meine Medikamente zuhause und kann ich so ein paar Tage über die Runden kommen im Endeffekt. Wir hoffen alle, dass es, wenn es zu einem Fall eintritt, nicht zu lange dauert, wissen aber auch, dass durch einen Stromausfall natürlich Lieferketten, Logistikketten sehr gestört sind, kennen wir auch aus der Corona-Pandemie in diesem Fall und dass es bis zum Wiederanlaufen etwas dauern kann und deswegen auch unsere Empfehlung, diese 10-14 Tage vorzusorgen zuhause und für sich ein persönliches Sicherheitskonzept zurechtzulegen.
Simone Koren-Wallis:
Weil man kann ja auch keinen Schalter dann umlegen und sagen, so, der Strom ist wieder da, es läuft alles wieder, das muss man dann auch langsam angehen.
Gilbert Sandner:
Genau, also da braucht es wirklich von der Wirtschaft, von Logistikunternehmen und Co. einen strukturierten Wiederanlaufplan eigentlich, dass das Ganze große und die Zahnräder wieder aneinandergreifen.
Simone Koren-Wallis:
Es gibt ja eigene Folder auch von der Stadt Graz, einen Bevorratungsfolder, gibt es auch auf graz.at zum Download natürlich. Vielleicht kannst du da kurz auch einmal vorlesen, was sollte man wirklich alles daheim haben?
Gilbert Sandner:
Ja, also wir haben unter dem Motto Vorratshaltung leicht gemacht, einen Vorrat für eine Person für zwei Wochen zusammengestellt, in Zusammenarbeit unter Anlehnung auch an den Empfehlungen des Zivilschutzverbandes. Warum? Wir wollen da mit einer Sprache sprechen und entsprechend die Vorratshaltung wirklich leicht machen. Da geht es von Getränken, 4,5 Kilo Getreideprodukte, Fleisch, Fisch, Obstprodukte, aber auch Milchprodukte und dann je nach Haushalt, unterschiedlich sollte man denken, habe ich für meine Tiere, meine Haustiere entsprechendes Tierfutter zu Hause, habe ich meine Medikamenten zu Hause, die ich brauche, selbst als Jungpapa kann ich meine Liebsten, meine Tochter versorgen in dem Bereich, ist das alles zu Hause und komme ich da ein paar Tage oder im schlimmsten Fall jetzt 14 Tage über die Runden. Was ich aber auch mitgeben möchte, es wird sehr viel über Vorratshaltung gesprochen, wichtig ist, dass man das zu Hause haben sollte, was einem schmeckt, weil es bringt nichts, die Müsliriegel vorzuhalten, die ich dann nicht mag und ich glaube, man sollte schon mit einem gesunden Hausverstand an diese Sache rangehen.
Simone Koren-Wallis:
Einfach beim nächsten Einkauf ein paar Dosen oder Konservendosen, einfach ein bisschen was, dass man einfach sagen kann, man kommt da mal ein bisschen rüber.
Gilbert Sandner:
Genau, muss ich natürlich auch Gedanken machen bei Konservendosen, wie wärme ich die auf? Also das ist schon so ein Thema, dass Vorratshaltung schon ein bisschen ein persönliches Sicherheitskonzept benötigt und vor allem natürlich im städtischen Raum schwieriger, aber ja, Möglichkeit mit einem Gaskocher, Gasgriller, das am Balkon aufzuwärmen, ist gegeben und da muss man sich entsprechend auch vorab durchdenken.
Simone Koren-Wallis:
Aber in der Stadt wahrscheinlich schwerer umzusetzen als am Stadtrand oder auch außerhalb der Stadt?
Gilbert Sandner:
Jein, würde ich jetzt einmal sagen. Also ich glaube, wenn man sich selbst Gedanken macht, wie man das in seinen eigenen vier Wänden umsetzen kann, vielleicht ein bisschen mehr Herausforderung in der Summe, ja, als wie am Stadtrand in dem Bereich, aber auf alle Fälle durchführbar und umsetzbar.
Simone Koren-Wallis:
Es gibt noch eine andere Checkliste, da steht auch Dokumentenmappe und Notfallrucksack. Bitte erklären Sie das noch kurz.
Gilbert Sandner:
Ja, wichtig ist das Thema Vorratshaltung soll ja nicht nur auf einem Szenario wie Blackout sein. Also wir sehen es jetzt wirklich umfassend im Katastrophenmanagement, dass man sukzessive oder für unterschiedlichste Krisenszenarien vorbereitet ist und natürlich gehören da meine persönlichen Dokumente auch entsprechend dazu, dass ich die griffbereit habe. Was tun wir zum Beispiel beim Thema Hochwasser? Wenn ich meine persönlichen Dokumente griffbereit habe, dann spare ich mir im Nachgang vermutlich viele Behördengänge und Wege, da wieder diese neu ausstellen zu können oder ausstellen zu lassen. Das soll eigentlich umfassend in ein Bevorratungskonzept, ein persönlicher Sicherheitskonzept, reinfließen.
Simone Koren-Wallis:
Das ist so ein bisschen bedrückend, das ganze Thema schon, oder? Wie man sich immer mit dem befasst.
Gilbert Sandner:
Ich sage gerne, wir gehen jeden Tag dennoch gerne mit einem Lächeln rein und lachen auch draußen gerne. Also nur weil wir uns aus Krisenszenarien vorbereiten und immer ja natürlich das Worst-Case-Szenario denken. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Job und uns darauf vorzubereiten, gibt es bei uns im Referat dennoch viel Spaß und auch Lachen zwischendrin. Und sehen wir nicht nur düstere Wolken.
Simone Koren-Wallis:
Alle Infos und worüber wir da jetzt alles gesprochen haben, das findet ihr übrigens auch auf sicherheit.graz.at.
Hier die Vorschau fürs nächste Mal. Da schauen wir, mehr oder weniger, in den Grazer Boden hinein und welche Schätze da schon gefunden worden sind. Wir hören uns, ich freue mich.
Jingle
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 12: Wie wild ist Graz? Mit Antworten vom Stadtförster
Wenn der Dachs am Schloßberg haust... Welche Wildtiere man bei uns in Graz trifft, warum Hunde jetzt im Frühling im Wald unbedingt angeleint sein sollen und welche die schönsten Wald-Fleckerln für unseren Stadtförster sind. Das gibt's in der heutigen Folge von Grazgeflüster mit Peter Bedenk.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Wie wild ist eigentlich die Stadt Graz? Also wild im Sinne von Wildtieren. Welche trifft man da bei uns und wie viele sind es ungefähr? Außerdem, was sind die absoluten No-Gos jetzt im Frühling im Wald? Und welche sind die schönsten Waldfleckern? Das gibt es heute in unserer Folge mit dem Stadtförster. Ich bin Simone Korenwallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Peter Bedenk.
Peter Bedenk:
Mein Name ist Peter Bedenk. Ich bin jetzt schon 32 Jahre Förster in der Stadt Graz. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir die Wälder und Naherholungsgebiete, die im Eigentum der Stadt sind, auch entsprechend bewirtschaften, entwickeln. Und dass wir uns ganz einfach darum kümmern, dass die Grazer und Grazerinnen diese Naherholungsgebiete auch genießen können.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Den Frühlingsduft haben wir Menschen nicht in den Genen. Nein, wir haben ihn erlernt. Und zwar, indem wir jedes Jahr, wenn es Frühling wird, irgendeinen bestimmten Duft wahrnehmen. Und das eben schon seit unserer Kindheit. Und wenn wir diesen Duft riechen, dann wissen wir, jetzt ist Frühling. Verschiedene Blumen, die Sonnenstrahlen, die die Erde langsam erwärmen. Es kann sehr, sehr vieles sein und auch natürlich von Mensch zu Mensch anders. Lieber Peter Bedenk, wie riecht denn der Frühling in Graz? Wie würden Sie das beschreiben?
Peter Bedenk:
In der Stadt hat man sehr viele Gerüche. Aber der Frühling an und für sich ist vor allem dadurch geprägt, dass es ein bisschen wärmer wird. Und wenn noch das Laub in der Früh feucht ist, also das Herbstlaub, das hier unten ist, hat so einen leicht modrigen Geruch, der aber schon Richtung der neuen Pflanzen, die jetzt anwachsen und ausschlagen geht, so dass man merkt, da rührt sich jetzt etwas. Das ist nicht mehr diese Kälte, wo alles dann am Boden anfriert, sondern da rührt sich dann im Boden schon etwas. Das sind Bodenlebewesen unterwegs. Und das merkt man schon, ja.
Simone Koren-Wallis:
Das ist eigentlich voll lustig, weil dieser modrige Geruch ist ja eigentlich, der eigentlich in der Nase nicht so positiv sein sollte. Aber wir nehmen es positiv wahr, oder?
Peter Bedenk:
Wir nehmen es sehr deswegen positiv wahr, weil es ja wirklich ein Kontrast ist zu dem, was im Winter stattfindet. Wo entweder Schneedecke drüber ist oder wo es dann wirklich kalt ist und das gar nicht so zur Geltung kommt. Weil die Gerüche, die man dann hat drinnen im Wald, die kommen natürlich auch mit der Temperatur mehr zur Geltung.
Simone Koren-Wallis:
Sie sind seit über 30 Jahren Stadtförster. Ich glaube, keiner kennt sich im Grünen so gut aus wie Sie, wenn ich das einmal behaupten darf. Was sind für Sie die schönsten grünen Fleckerln in Graz, die Sie uns auch preisgeben?
Peter Bedenk:
Ich bin tatsächlich ausschließlich für den Wald zuständig. Es gibt noch andere schöne grüne Fleckerln in Graz. Aber das will ich nicht unbedingt. Aber im Stadtgebiet ist es für mich nach wie vor der Blaubutsch. Warum? Weil man da einen wunderbaren Blick hat bis hin vom Hochschwab, wenn man es genau nimmt, bis die Stadt, die unter einem liegt. Und dann sieht man auch bis zum Gleichenbergerkogl oder Stradnerkogl. Also ein wunderbarer Rundblick. Und natürlich mit direktem Blick auf den Schöckl. Also ein großer Teil der Steiermark, den man dort sehen und erleben kann. Wir haben 2008 das Ganze erschlossen mit einer Forststraße. Und von dieser Forststraße aus, die so ein bisschen die Lebensader ist, so wie sich das jetzt präsentiert am Blaubutsch oben, kann man immer wieder wunderbare Aus- und Einblicke auf die Stadt Graz und in ihrer Umgebung genießen.
Simone Koren-Wallis:
Nehmen das die Grazerinnen und Grazer zu wenig wahr, dass man sagt, man kann ja auch wirklich in den Wald gehen bei uns in Graz?
Peter Bedenk:
Ich glaube nicht, dass sie es zu wenig wahrnehmen. Zum Beispiel Waldgebiete wie der Lechwald, die sind schon fast überlaufen. Also ich glaube schon, dass sie es wahrnehmen. Aber es sind gewisse Gebiete, die natürlich intensiver genutzt werden in der Innenstadt gegenüber anderen Gebieten wie zum Beispiel Buchkogl und Blaubutsch, wo man dann schon ganz bewusst hingehen muss und wandern.
Simone Koren-Wallis:
Was sind die No-Gos, wo Sie sagen, bitte passt es mir da auf in unserem Wald? Also was sollte man gar nicht tun jetzt im Frühling?
Peter Bedenk:
Na ja, der Frühling ist auch die Zeit, wo die Tiere ihre Jungen auf die Welt bringen. Ein großes Thema ist immer wieder Hunde, Rehe. Also Hunde unbedingt an die Leine im Frühjahr bis in den Juni hinein. Setzen die Rehe ihre Kitze. Die Kitze werden abgelegt. Sie haben keinen direkten Fluchtreflex. Also der Schutz ist, dass sie sich so still wie möglich verhalten. Und natürlich jeder Hund wird darauf reagieren, auch wenn er noch so lieb ist, Er kann zumindest, wenn nicht ärgerer ist, zumindest große Irritationen hervorrufen bei den Tieren, die natürlich auch zum Tod der Tiere führen können. Wir müssen uns bewusst sein, dass das auch die Zeit ist, wo die Vögel brüten. Also irgendwas herumreißen oder sonst irgendwas kann natürlich auch dazu führen, dass ein Nest, das irgendwo im Geist gebaut ist, zerstört wird. Also man muss sich schon bewusst sein, man geht hier in einen eigenen Lebensraum, der sich jetzt wieder erblüht und erwacht, wenn man so will. Andererseits betritt man natürlich auch, wenn man es genau nimmt, eine fremde Wohnung. Also da wohnen einfach ganz andere Tiere, da wohnen Pflanzen. Und das Ganze sollte man natürlich auch berücksichtigen und immer im Hinterkopf haben.
Simone Koren-Wallis:
Respektieren vor allen Dingen. Also dass ich da jetzt eigentlich eindringen.
Peter Bedenk:
Ich würde gar nicht sagen eindringen. Der Wald ist dazu da, dass man ihn auch nutzen kann. Für Erholungszwecke kann man ihn jederzeit betreten. Aber man sollte ganz einfach nicht, weil es ihn dann irgendjemand sagt oder weil es in einem Gesetz steht, sondern dann auch aus dem eigenen Empfinden her, mit ein bisschen Nachdenken, diese Möglichkeit nutzen.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt muss ich mal fragen, weil ich überhaupt keine Idee habe. Wie viele Tiere leben ungefähr? Also wie viele Rehe? Gibt es da irgendwas, was man ungefähr schätzen kann?
Peter Bedenk:
Ja, Schätzungen sind natürlich sehr schwierig. Jetzt kommen die bösen Jäger ins Spiel, die diese Wildzählungen machen, die aber gar nicht so böse sind. Und wir rechnen hier mit einem Rehwildbestand von rund 600 bis 650 Rehen im Grazer Stadtgebiet. Wir haben aber auch natürlich Gämsen und andere interessante Tiere hier drinnen, Füchse bis in die Innenstadt. Wir haben das als Lebensraum entdeckt und auch mehrere Dachsbauten am Schlossberg sogar. lso die Tierwelt ist sehr vielfältig und, naja, Marder kennt auch jeder, der ein Auto zu Hause hat. So wenig Wild ist diese Stadt gar nicht.
Simone Koren-Wallis:
Das glaubt man aber irgendwie gar nicht, oder?
Peter Bedenk:
Glaubt man nicht, aber wenn man genau schaut, findet man immer wieder die Spuren davon, sei es Kratzer an Hauswänden, die von Marder sind, oder auch Spechtlöcher bei Wärmedämmungen. Also das ist auch immer wieder ein großes Thema.
Simone Koren-Wallis:
Was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich irgendeinen Wildbefall habe zu Hause, oder rufe ich dann den Bedenkern zu, bitte um Hilfe? Was ist da die beste Lösung?
Peter Bedenk:
Man sollte in jedem Fall den örtlich zuständigen Jäger informieren. Wenn der nicht bekannt ist beim Landesjagdamt, erfährt man, dass wer zuständig ist, der kann dann die weiteren Schritte setzen, sei es, dass ein Tierarzt gerufen wird, sei es sonst irgendwie, dass man das einfängt, irgendwo anders aussetzt oder sonstige Maßnahmen setzen muss.
Simone Koren-Wallis:
Zu wie viel schafft ihr das alles in eurer Abteilung?
Peter Bedenk:
Die Fläche, die wir verwalten, das sind fast 700 Hektar. Das ist gar nicht so wenig im Stadtgebiet, weil man natürlich immer mit ganz anderen Sachen konfrontiert ist, aber wir sind im Arbeiterbereich zu dritt, in der Verwaltung auch zu dritt, und dann betreiben wir auch noch die Waldschule mit unseren WaldpädagogInnen, wo wir all diese Informationen, die Sie da hören, auch weitergeben vor Ort an Interessierte, nicht nur jetzt an Schulen oder was, auch wenn es Schule heißt, aber im Sinne des lebenslangen Lernens, kann natürlich jeder zu uns kommen. Die Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gpg.graz.at.
Simone Koren-Wallis:
Auf was freuen Sie sich im Frühling jetzt am meisten?
Peter Bedenk:
Dass es wärmer wird. Wir sind doch draußen, und man merkt, wenn man draußen ist, längere Zeit, und vor allem etwas montieren oder schreiben muss, das geht auf die Finger, weil es schön kalt ist. Nein, es ist ganz anders. Die Menschen, das muss man ganz offen sagen, sind auch anders in den Verhältnissen gegenüber. Es ist schon ein bisschen freundlicher, lockerer, die Atmosphäre dann.
Simone Koren-Wallis:
Weg vom Wald hin zu den Grazer Leuchttürmen. Ja, die gibt es elf Stück sogar, und die sind in Krisenzeiten verdammt wichtig. Die genaue Erklärung gibt es in der nächsten Folge von Graz Geflüster. Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 11: Schwimmkurse für Ihr Kind - Denn: Schwimmen rettet Leben!
Die häufigste Todesursache bei Kindern ist das Ertrinken. Umso erschreckender, dass nicht einmal jedes zweite Kind in Graz mit 10 Jahren schwimmen kann. Das will die Stadt Graz ändern und so gibt es heuer zusätzliche Schwimmkurse im Sommerprogramm. Alle Infos zur Anmeldung und zu den Kosten gibt es in dieser Folge von Grazgeflüster mit dem Sportamtsleiter Thomas Rajakovics.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Die häufigste Todesursache bei Kindern ist Ertrinken. Umso erschreckender, dass nicht mal jedes zweite Kind in Graz mit zehn Jahren schwimmen kann. Das will die Stadt Graz ändern. Es gibt heuer zusätzliche Schwimmkurse im Sommerprogramm. Alle Infos zur Anmeldung und zu den Kosten gibt es in dieser Folge von Graz Geflüster. Denn Schwimmen rettet Leben. Ich bin Simone Korenwalis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Thomas Rejakowitsch.
Thomas Rejakowitsch:
Hallo, Thomas Rejakowitsch. Ich bin seit 2019 Sportamtsleiter der Stadt Graz und heute zu Gast beim Graz Geflüster, beim Grazer Podcast.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Wer sich in dieser Woche schon die erste Folge mit Thomas Rejakowitsch angehört hat, der hat sich schon einen Tag ganz, ganz dick im Kalender angestrichen. Thomas, das ist der?
Thomas Rejakowitsch:
22. Mai, weil da beginnt die Anmeldung für die 3800 Plätze, die wir bei unseren Sommerkursen vergeben können. Da ist es wichtig, ganz in der Früh 7.30 Uhr wirklich am Computer zu sitzen, weil wir wissen, dass die Sportkurse, die die Kinder besonders gerne buchen, dass die halt sehr schnell ausgebucht sind. Und wir wissen das auch von den Skikursen, die 350 Plätze waren innerhalb von 8 Minuten ausgebucht. Deshalb muss man sich diesen Termin wirklich dick anstreichen. Wobei wir heuer am 22. Mai ja nicht nur unsere 3800 Plätze für den Sommer vergeben, sondern wir haben eine besondere Aktion und die haben wir ja im März gemeinsam auch mit den Kinderärzten und dem Landesschwimmverband vorgestellt. Und zwar unter dem Thema Schwimmen rettet Leben gibt es auch zusätzliche Schwimmkurse. Wir bieten vom Sportamt im Frühjahr und im Herbst traditionell unsere Schwimmkurse an, aber wir haben im Sommer diesmal erstmals auch Schwimmkurse im Sommerprogramm drinnen. Insgesamt 300 Plätze beim VGT und beim ATG. Im Freien, es ist ja Sommer. Und warum machen wir das? Weil Schwimmen eine Grundtechnik der Bewegung ist. Und das gerät leider in Vergessenheit. Immer weniger Kinder können mit 10 Jahren schwimmen. Wir haben ja da die Untersuchungen auch durch unsere Kinderärztin, die Frau Dr. Pamperl, die ist da auch sehr motiviert und in den Schulen unterwegs und fragt nach, wie viele Kinder können schon schwimmen. Und da sind wir in Graz leider schon unter die 50-Prozent-Marke gerutscht. Und es ist deshalb dramatisch, weil laut Kinderärzten das Ertrinken tatsächlich die häufigste Todesursache bei Unfällen von Kindern ist. Ich glaube ja, so wie Radfahren gehört Schwimmen einfach dazu, dass auch ein Aufruf an die Eltern. Natürlich ist es auch die öffentliche Hand, die sich bemüht, Kindern solche Grundfertigkeiten beizubringen. Aber ich muss ehrlich sagen, auch bei meinen Kindern, es ist ein bisschen auch die Elternpflicht, dass man Kindern so etwas beibringt. Und Radfahren und Schwimmen wären schon Sachen, die man eigentlich, sagen wir es so, knapp nach dem Kindergarten spätestens erlernen sollte. Dass dem nicht der Fall ist, das können wir auch sagen.
Simone Koren-Wallis:
Warum ist das so, Thomas?
Thomas Rejakowitsch:
Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft sehr vieles gerne delegiert wird an andere. Und da sind Eltern gegenüber den Kindern vielleicht gar keine Ausnahme. Und was man selbst entweder aus möglichem Zeitmangel oder auch aus Desinteresse nicht machen möchte, das delegiert man halt an den Kindergarten, an das Sportamt, an den Staat, an wen auch immer. Und es sind eigentlich Grundtechniken der Bewegung. Und die sind meiner Meinung nach schon auch Aufgabe von Erziehung. Wenn es nicht mehr so ist, springt der Staat ein, zu Recht. Und deshalb hat eben der Landesschwimmverband gemeinsam mit den Ärzten und mit dem Sportamt das Programm entwickelt. Wir werden heuer insgesamt auch Bezahlkurse deutlich mehr haben, damit eben dieses Thema bei den Kindern gut ankommt. Wir werden aber auch im Sommer zusätzliche 300 Plätze anbieten. Und zwar jeweils eine Stunde für Fortgeschrittene, wo einfach Kinder und Jugendliche sich entsprechend verbessern können. Und jeweils eine Stunde pro Tag für Anfänger. Sechs- bis Zehnjährige, Fortgeschrittene von sechs bis zwölf. Ich hoffe, das Programm kommt gut an. Wie gesagt, von Seiten der Ärzteschaft, man liest es ja in den Zeitungen, es ist auch immer wieder ein Thema in anderen Medien. Es ist ein Problem, wenn Kinder nicht schwimmen können, auch wenn man nicht selbst gerne baden geht. Aber man geht wandern, man ist an Flüssen unterwegs. Und es reicht, dass man einen falschen Schritt macht und in ein Wasser hineinfällt. Und dann kommt es zu spät. Und wir haben das ja ganz tragisch vor zwei Jahren erlebt, wie ein Tretboot untergegangen ist, wenn eine Familie sich auf ein Tretboot begiebt, die nicht schwimmen kann, wo dann auch ein Kind tatsächlich ertrunken ist. Das ist dann ganz furchtbar. Und deshalb, ich kann nur appellieren an die Eltern, bitte macht mit euren Kindern Sport, aber bringt den Kindern vor allem Bewegungstechniken bei, die sie im Leben brauchen. Und das ist Radfahren und Schwimmen ganz eindeutig.
Simone Koren-Wallis:
Und vor allen Dingen, Kinder ertrinken ja lautlos. Die wackeln ja nachher nicht oder schreien um Hilfe, sondern da ist der Kopf unter Wasser und die bewegen sich ja dann gar nicht mehr.
Thomas Rejakowitsch:
Genau, genau. Und deshalb, ja, ich hoffe, dass das ein Impuls ist. Wir können ja nur Angebote machen. Ich weiß, dass unsere Schwimmkurse gut angenommen werden. Ich nehme an, auch weil sie natürlich, wie alle unsere Sportkurse, sehr günstig sind.
Simone Koren-Wallis:
Ich wollte gerade fragen, wie viel kostet denn so etwas?
Thomas Rejakowitsch:
Auch diese Kurse kosten nur 10 Euro pro Woche. Ja, das ist schon ein spezielles Angebot. Aber ich glaube, wenn es ums Leben meiner Kinder geht, sollten die 100 bis 120 Euro, die die Schwimmschulen offiziell verlangen, nicht zu viel sein. Und es ist natürlich, unsere Kurse sind genauso professionell, aber die Schwimmschulen, die wir in Graz haben, haben natürlich dann noch das eine oder andere an speziellen Ausrüstungen, damit auch Kinder, die vielleicht nicht so begabt sind, recht schnell das Schwimmen lernen. Und man sollte auch diese Angebote einfach nützen. Wir bieten jedenfalls im Sommer jetzt zusätzlich 300 Plätze an. Es wird auch noch ein eigenes Programm geben für Kindergartenkinder über das Jugendamt und einfach am 22. Mai 7.30 Uhr am Computer sitzen.
Simone Koren-Wallis:
Das ist dann einmal am Tag eine Stunde, von Montag bis Freitag?
Thomas Rejakowitsch:
Genau, das ist beim ATG und beim VGT jeweils von 9 bis 10 Uhr der fortgeschrittenen Kurs und von 10 bis 11 der Anfängerkurs. Es sind fünf Einheiten, fünf Stunden und es ist grundsätzlich ausreichend, damit Kinder sich zumindest so weit über Wasser halten können, dass man keine Angst haben müsste.
Simone Koren-Wallis:
Haben wir das Datum schon einmal gesagt, wann man sich anmelden muss?
Thomas Rejakowitsch:
Ja, am 22. Mai 7.30 Uhr.
Simone Koren-Wallis:
Viel Spaß beim Schwimmen und Sporteln im Sommer. In der nächsten Folge geht es in die Grazer Wälder und zwar mit unserem Stadtförster. Wir hören uns, ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Graz Geflüster, der Stadt Graz Podcast. Neun Wochen Sommerferien, das macht man da mit den Kindern die ganze Zeit. Wie wärs mit einer richtig coolen Sportwoche oder mit einem Sportkurs? Wir verraten euch heute, was es da alles in der Stadt Graz gibt, wann ihr euch dafür anmelden müsst und was sowas kostet. Heute dreht sich nämlich alles um den Sport. Ich bin Simone Korenwalis aus der Abteilung für Kommunikation, mein Gast Thomas Rajakovic.
Thomas Rajakovic:
Hallo Thomas Rajakovic, ich bin seit 2019 Sportamtsleiter der Stadt Graz und heute zu Gast beim Graz Geflüster, beim Grazer Podcast.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Heute wird's sportlich, meine Damen und Herren, liebe Grazerinnen, liebe Grazer. Thomas, du als Leiter vom Sportamt, wir sporteln jetzt nicht selber, weil ich würde zu sehr keuchen beim Aufnehmen vom Podcast. Nein, es geht ums Ferienprogramm der Stadt Graz. Aber davor habe ich noch eine Frage. Wir haben jetzt das Sportjahr der Stadt Graz hinter uns. Kurzes Resümee?
Thomas Rajakovic:
Ja, das Sportjahr war, glaube ich, wirklich ein ganz besonderes, auch wenn es letztlich durch die Pandemie ganz anders ausgefallen ist, als wir es ursprünglich geplant hatten. Wir hatten ja viel mehr auch noch mit den Vereinen geplant. Dadurch, dass Vereinstätigkeit zu Beginn 2021 ja komplett noch untersagt war, haben wir uns auf den öffentlichen Raum konzentriert und wir haben Projekte gehabt wie Seven Summits, normal die höchsten Gipfel der Welt, diesmal die höchsten Gipfel im Umland von Graz, die man besteigen konnte, wann immer man wollte. Und ich glaube, wir haben allein 4.500 solche Sammelpässe, inklusive Urkunde dann ausgestellt. Das heißt, es war erfolgreich. Es haben auch ganz viele Menschen mitgemacht beim Tischtennis-Kaiser im Sommer, wo es nicht darum gegangen ist, möglichst viele Spiele zu gewinnen, sondern gegen möglichst viele verschiedene Gegner zu spielen. Also das Miteinander, Bewegung machen, das ist im Mittelpunkt vom Sportjahr gestanden, schon mit der Absicht, die Menschen insgesamt auch zu motivieren, regelmäßig Sport zu machen. Ob das dann privat ist, indem man einfach, ich sage zweimal in der Woche, dreimal in der Woche laufen gehen, oder ob es über einen Verein ist, was mir natürlich ein großes Anliegen ist, weil da auch sehr engagierte und professionelle Trainer im Hintergrund sind, die gerade bei Kindern und Jugendlichen auch verhindern, dass sie sich überstrapazieren, beziehungsweise bei verschiedenen Sportarten natürlich, ihnen bei ihrer Technik auch helfen können. Das heißt, der Sportjahr ist angetreten mit der Idee, das Thema Bewegung in Graz unter Anführungszeichen noch salonfähiger zu machen. Ich glaube, das ist gelungen. Nach einer Umfrage, die wir im Jahr 2019 zu Beginn der Sportstrategie, wie wir zu arbeiten begonnen haben, gemacht haben, und zur Befragung nach dem Sportjahr im Jahr 2022, machen jetzt 30 Prozent mehr Grazerinnen und Grazer regelmäßig Bewegung. Das klingt viel, ist aber natürlich insgesamt, da wir von einem Level von knapp 35 Prozent der Grazerinnen und Grazer ausgegangen sind, noch nicht das, wo wir hinwollen. Ziel wäre natürlich, dass man sagen kann, mehr als die Hälfte oder zwei Drittel der Grazerinnen und Grazer machen jene Bewegung, die die WHO vorsieht. Und es ist dreimal in der Woche wenigstens eine Stunde richtig Sport, beziehungsweise, was vor allem auch bei den Senioren inzwischen auch schon sehr gut ankommt, 10.000 Schritte pro Tag.
Simone Koren-Wallis:
Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt war ich kurz da, dreimal, okay, aber 10.000 Schritte am Tag, das schaffe ich öfters. Aber wie wichtig ist Sport für Kinder und Jugendliche?
Thomas Rajakovic:
Für Kinder und Jugendliche ist er deshalb wichtig, weil Sport generell für den Menschen enorm wichtig ist, auch letztlich bis ins hohe Alter. Wenn ich allerdings als Kind beginne und mir etwas für mich selbst zu einer Selbstverständlichkeit mache, dann kann man davon ausgehen, dass das auch im Alter sich fortsetzt. Und wir sind eigentlich, und das war auch die Herausforderung, mit der wir in die Sportstrategie 2019 hineingegangen sind, wir liegen in Österreich zwar bei der Lebenserwartung durchaus gleich wie die Schweden bei knapp 84 Lebensjahren zurzeit, das steigt ja ständig.
Simone Koren-Wallis:
Die Männer oder die Frauen?
Thomas Rajakovic:
Die Frauen bei 84,1 und die Männer nur bei 79,3. Aber das ist im Steigen. Also ich hoffe schon, dass ich über 80 werde. Und das Problem daran ist, dass die Schweden in dieser Zeit mehr als zwölf Jahre keine Einschränkung in ihrer Aktivität haben. Das heißt, sie sind einfach gesünder, das betrifft die Schweden ganz besonders, aber es ist überhaupt festzustellen, dass in vielen Ländern die Menschen einfach von klein auf gewohnt werden, sich mehr zu bewegen und das wirkt sich letztlich in der Lebensqualität aus. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir gerade schon bei den Kindern anfangen und ihnen schauen, die Freude an der Bewegung zu vermitteln, damit sie das dann auch bis ins hohe Alter behalten.
Simone Koren-Wallis:
Und so wie du es schon auch angesprochen hast, es gibt ja wirklich viele Vereine in Graz, wo man wirklich sagen kann, hey, ich als Elternteil, da melde ich mein Kind an, schauen wir mal, was macht es gern. Und es gibt ja wirklich einen Haufen.
Thomas Rajakovic:
Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, man kann alles in Graz machen, was an Sport so auf der Welt passiert, aber tatsächlich von den klassischen Sportarten, Mannschaftssportarten wie Basketball, Handball, Volleyball, Fußball bis hin zu etwas Ausgefallenem wie Baseball, Cricket, aber auch zu ganz Neuem wie Quidditch. Es ist in Graz alles auch vereinsmäßig organisiert.
Simone Koren-Wallis:
Quidditch?
Thomas Rajakovic:
Quidditch, ja, das ist die Harry-Potter-Sportart. Ach, genau. Schaut vielleicht ein bisschen witzig aus, weil man mit einem Stecken zwischen den Beinen dann den Ball durch drei verschiedene große Ringe befördern muss, aber es ist alles recht, was dazu führt, dass Kinder gerne Sport betreiben.
Simone Koren-Wallis:
Wenn ich jetzt als Mama sage, okay, ich möchte mein Kind irgendwo hingeben, mein Kind interessiert sich jetzt für Tanzen, wo suche ich dann, rufe ich bei euch an im Sportamt, suche ich auf eurer Website, wie tue ich?
Thomas Rajakovic:
Beides ist möglich. Anrufen ist selbstverständlich immer möglich. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da sehr kompetent, aber am einfachsten geht auf www.graz.at, klickt sich dann auf das Sportamt und schaut durch, was es an Sportangeboten gibt, weil wir ja auch vom Sportamt für die vierten Klassen jeweils einen Gutschein zu Jahresbeginn ins Elternheft hineinlegen. Das heißt, die Kinder können ein Jahr gratis bei einem Sportverein ihrer Wahl, nicht bei einem Sportverein, wo sie bereits Mitglied sind, können sie ein Jahr gratis diesen Sport ausprobieren. Das ist quasi der Sportscheck für die Zehnjährigen. Wird auch ganz gut angenommen. Also ich höre von den Vereinen, dass sich im Schnitt ungefähr ein Drittel der Kinder tatsächlich dieses Angebot zunutze macht. Ist natürlich Luft nach oben. Wenn wir ca.1500 Schecks ausgeben und 500 werden eingelöst, könnte es noch mehr sein, aber da sind natürlich sicher auch schon in der vierten Klasse etliche Kinder, die schon fix in einem Verein sind, wo Eltern eben dahinter sind, dass ihre Kinder Sport machen. Aber für jene, die da noch nicht so motiviert sind, soll dieser Check einfach eine kleine Hilfe sein. Und daher gibt es auch das gesamte Angebot auf unserer Homepage.
Simone Koren-Wallis:
Du, jetzt haben wir erst die Osterferien hinter uns gebracht. Die nächsten sind dann schon die Sommerferien. Für viele Eltern heißt das, boah, was mache ich mit den Kindern? Ich kann mir nicht neun Wochen Urlaub nehmen. Und da habt ihr euch eh schon seit Jahren was Gutes ausgedacht. Und wie schaut das heuer aus?
Thomas Rajakovic:
Ja, wir haben gerade 444 Kinder in den Osterferien betreuen dürfen. Das heißt, die Vereine, die mit uns da zusammenarbeiten. Für das Sommerprogramm gibt es natürlich deutlich mehr Plätze. Also wir haben insgesamt 3800 Plätze und fast in allen Sportarten. Also wir haben das jetzt inzwischen schon geklastert. Es gibt Bewegung und Geschicklichkeit, wo Abenteuer im Lechwald ist, Frisbee, Discgolf. Es gibt Einzelsport, von BA über Bogensport bis hin zum Orientierungslauf. Mannschaftssport, es gibt alles von Basketball, Handball bis zum Fußball. Es gibt Rückschlagspiele, auch Paddle, was im Moment einen richtigen Boom erfährt. Aber auch Wassersport wie Kajak. Ja, das einzig Wichtige für Eltern ist, sich rechtzeitig auf Venusel anzumelden, damit sie dann, wenn um halb acht die Kurse freigeschalten werden, sofort auch ihr Kind auf den Kurs anmelden können, wo es unbedingt dabei sein möchte. Weil, wie wir heuer erfahren haben, bei den Skikursen, den Skitagen im Winter, 350 Plätze waren innerhalb von nicht einmal acht Minuten ausgebucht. Das heißt, auch Eltern, die wirklich möchten, dass ihr Kind einen speziellen Kurs besucht, sollten da tatsächlich vorbereitet sein und pünktlich um halb acht beim Computer sitzen.
Simone Koren-Wallis:
Du hast gerade angesprochen, es gibt eine Deadline. Welchen Termin muss ich mir ganz rot im Kalender ankreuzen?
Thomas Rajakovic:
Also eigentlich muss man sich zwei Termine rot anstreichen. Einmal den 24. April, da werden die Ganztagesbetreuungsplätze vergeben, und zwar da haben wir insgesamt 350 Plätze. Und dann den 22. Mai, immer 7.30 Uhr, da werden die 3.800 Plätze in den diversen Sportarten für die Kurse, die jeweils eineinhalb bis zwei Stunden pro Tag dauern, angeboten.
Simone Koren-Wallis:
Und die Kurse kann ich mir natürlich vorher auch auf der Sportamt-Seite anschauen?
Thomas Rajakovic:
Natürlich.
Simone Koren-Wallis:
Und dann kann ich mit meinem Kind sagen, ich entscheide, hey, was möchtest du machen? Und darf ich fragen, was kostet das?
Thomas Rajakovic:
Die Ganztageskurse kosten 150 Euro für die Woche, inklusive Essen, also eine Okkasion, um das einmal so zu sagen. Und die Ferienkurse, die zweistündigen, kosten überhaupt nur 10 Euro. Ist etwas, was wir immer wieder auch diskutieren, vor allem bei den Skitagen, darf ich vielleicht auch mal so kritisch anmerken, dass sich dann natürlich manche Eltern sagen, na ja, da melde ich einmal mein Kind an. Und wenn es nicht passt, dann geht das Kind halt nicht. Und nehmen wir damit auch einem anderen Kind, gerade beim Skikursen, war es ärgerlich, wenn ich 350 Plätze in so kurzer Zeit vergeben habe. Und letztlich stellen wir dann fest, dass 18 Kinder wieder abgemeldet wurden, aber auch nicht erschienen sind. Dann nehme ich ja vielen anderen die Möglichkeit weg. Und wir überlegen, ob vielleicht die 10 Euro zu wenig sind, dass man sich das gut überlegt, bevor man ein Kind anmeldet. Weil natürlich ist 10 Euro auch nicht wenig Geld, aber es ist für das, was da geboten wird, schon sehr wenig und motiviert manche nicht dazu, das Angebot dann wirklich zu konsumieren.
Simone Koren-Wallis:
Also falls irgendwer wirklich verhindert ist, bitte unbedingt abmelden, damit der Preis auch gehalten werden kann. Es gibt aber auch noch zusätzliche Kurse, und zwar im Wasser. Immer weniger Kinder können mit 10 Jahren schwimmen. Dabei ist das wichtig, nicht nur wichtig, es ist lebenswichtig. Alles zu den Schwimmkursen im Sommerprogramm gibt's in der nächsten Folge. Am besten gleich weiterhören.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 9: Lebensmittelsicherheit: Kontrolle auch in Drogerien und Kindergärten
Was kontrollieren die Mitarbeiter:innen der Lebensmittelsicherheit der Stadt Graz? Soviel vorweg: es sind nicht nur Gastrobetriebe! Und warum diese Folge von Grazgeflüster mit dem Referatsleiter für Lebensmittelsicherheit und Märkte Christian Siedl vielleicht sogar das eine oder andere Leben retten kann.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Wie funktioniert eine Lebensmittelkontrolle in einem Gasthaus? Das kann sich wahrscheinlich jeder von uns so irgendwie vorstellen, oder? Falls nicht, sagen wir euch das heute und gehen der Frage nach, was machen genau diese Kontrolleure der Stadt Graz in einer Drogerie oder in einem Kindergarten? Das gibt's in der heutigen Folge von Graz Geflüster, die vielleicht sogar das eine oder andere Leben retten kann. Ich bin Simone Karrenwallis aus der Abteilung für Kommunikation, mein Gast Christian Siedl.
Christian Siedl:
Mein Name ist Christian Siedl, ich bin der Referatsleiter für Lebensmittelsicherheit und Grazer Märkte.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Vielleicht habt ihr es schon einmal gesehen, ATV, die Lebensmittelpolizei. Gegenüber von mir sitzt eigentlich ein Promi, der damals immer mit dabei war.
Komm, ich darf es so sagen, lieber Christian. Christian, du warst damals schon immer mit dabei, denn du bist Lebensmittelkontrolleur, also du leitest nicht nur das Referat, du bist jahrelang Lebensmittelkontrolleur auch gewesen. Erzähl einmal, wie funktioniert das eigentlich? Wie kontrolliert ihr die Gasthäuser, die ganzen Betriebe, Bäckereien in Graz?
Christian Siedl:
Unsere Kontrollen sind ja unangemeldet. Das heißt, wir haben auch diesbezüglich ein eigenes Programm, welches österreichweit einheitlich ist bei den Lebensmittelinspektoren, weil diese Betriebe natürlich in Risikogruppen eingestuft werden. Das heißt, am Gastgewerbe wird zum Beispiel alle zwei Jahre kontrolliert, weil es von dem Risiko her ein bisschen abgeschwächter wird von einem Krankenhaus. Krankenhaus wird zum Beispiel jährlich kontrolliert und nach diesen Vorgaben, wie Risiko passiert, deren Betrieb eingestuft ist, so wissen wir dann, in welchen Betrieb wir gehen.
Simone Koren-Wallis:
Warum ist es heutzutage noch immer wichtig, dass es euch gibt, dass ihr diese Kontrollen durchführt?
Christian Siedl:
Ich würde sagen, gerade die unangemeldete Kontrolle ist wichtig, weil man sich dann wirklich ein Bild machen kann, ist das Hygieneverständnis wirklich in den Köpfen der Köche? Weil sonst kommt man zu einer gewissen Betriebsblindheit, ein Schleim dran, entwickelt sich in der Küche, wo man sagt, okay, das war jetzt nicht ganz so hygienisch, wie man es eigentlich gewohnt ist oder wie man es machen sollte. Reinigung ist immer wieder ein Thema, weil man dann natürlich durch den Stress, wenn man ein großes Tagesgeschäft hat zum Beispiel und dann nachher die Zeit fehlt zum Putzen der Küche, dass man für den nächsten Tag wieder die Mise en Place herrichtet. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man auf die Hygiene setzt und da haben wir doch die Möglichkeit, auch immer ins Bewusstsein der Köpfe einzudringen und zu sagen, das ist wirklich wichtig, wie wascht man sich richtig die Hände, Kühltemperaturen, man merkt ja doch immer auch in den Medien, welche Krankheitserreger es gibt, was kann über das Lebensmittel auch übertragen werden. Ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist, dass es diese Kontrollen gibt und es hat sich ja auch über die Sendung damals auch gezeigt, dass es wichtig ist, dass es uns gibt.
Simone Koren-Wallis:
Da hat es auch einige Schließungen gegeben, glaube ich. Es kommt immer wieder vor.
Christian Siedl:
Es kommt natürlich auch immer wieder vor.
Simone Koren-Wallis:
Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, also Ungeziefer ist das eine, was man in der Küche bitte nicht haben möchte, aber es kommt auch immer wieder vor. Aber es gibt auch ganz lustige Sachen, oder? Ich habe einmal gesehen, dass irgendwer mit so einer Art Betonmischung oder irgendwas, irgendwas verrührt hat. Also es gibt, glaube ich, in der Küche nichts, was es nicht gibt, oder?
Christian Siedl:
Das ist richtig. Also wir haben schon sehr viel gesehen und das stimmt. Gerade bei asiatischen Lokalen wird der Bohrer gerne verwendet, aber natürlich, der wird natürlich auch untersagt.
Simone Koren-Wallis:
Ja, natürlich.
Christian Siedl:
Aber natürlich sehen wir das eine oder öfter wieder.
Simone Koren-Wallis:
Macht das Spaß? Macht der Job Spaß oder bist du so ein bisschen der Spielverderber?
Christian Siedl:
Also Spielverderber, natürlich, so werden wir manchmal genannt, aber mir macht er im Prinzip wirklich sehr viel Spaß, weil man auch die Möglichkeit hat, auch unterstützend zu helfen. Also wir sind jetzt nicht immer nur die bösen Kontrolleure und sagen, bitte gar nicht, das dürft ihr nicht, sondern wir versuchen auch schon, das Wissen auch zu vermitteln und auch die Möglichkeiten, den Gastronomen zu bieten, „hey, schaut her, macht es bitte so, haltet euch ein bisschen an die Leitlinien. Wie kann man sich untereinander ein bisschen helfen?" Also wir forcieren nicht immer gleich die Strafe.
Simone Koren-Wallis:
Ihr versucht auch zu sagen, hey, macht es so oder so, dann haut die nächste Kontrolle besser hin.
Christian Siedl:
Richtig, also immer natürlich, wie man den Wald ruft, so kommt es retour, aber wir sind auch schon bedacht, dass die Gastronomen auch bestehen bleiben.
Simone Koren-Wallis:
Natürlich.
Christian Siedl:
Also dass man auch diese strengen Auflagen, die natürlich von der EU vorgeschrieben werden, sind natürlich schwer umzusetzen, natürlich für den kleinen Betrieb und deshalb ist es auch wichtig, dass wir unsere Seite auch mit unterstützen, dass man ihnen erklärt, okay, in abgeschwächter Form, wie kann man einen Reinigungsplan besser gestalten, wie kann man sich ein bisschen das Leben erleichtern in der Küche, dass nicht zu viel Bürokratie herrscht.
Simone Koren-Wallis:
Wenn ich jetzt, heutzutage ist es sicher nicht so einfach, aber wenn ich sage, ich möchte irgendeinen Gastrobetrieb eröffnen, könntet ihr mir dann eigentlich auch helfen? Also kann ich bei euch anrufen und sagen, bitte, ich brauche Hilfe, was muss ich alles umsetzen?
Christian Siedl:
Genau, also sie können gern zu uns ins Büro kommen, die Lagergasse, also wir unterstützen immer gern bei, gerade bei fertigen Plänen, wie soll eine Küche ausschauen, welche Anforderungen brauche ich für eine Küche, was ist überhaupt die Hygieneanforderung und da sind wir sehr offen und unterstützen natürlich sehr, wenn die Hilfe gefragt wird.
Simone Koren-Wallis:
Ihr kontrolliert aber nicht nur die Gastronomiebetriebe, wie eben Restaurants, Gasthäuser, Cafés, Bäckereien, sondern auch die Märkte.
Christian Siedl:
Also prinzipiell muss ich sagen, wir kontrollieren alles, also das ist auch die Spielzeugverordnung gehört dazu, Kosmetikverordnung, Wasser, wir kontrollieren alles eigentlich, was verkehrsfähig ist, was am Markt ist und natürlich ein großer Punkt ist natürlich auch die Märkte, aber auch wieder im Lebensmittelbereich.
Simone Koren-Wallis:
Wie funktioniert so eine Kontrolle auch am Markt zum Beispiel?
Christian Siedl:
Man besucht den Markt und schaut sich mal das Warensortiment an. Wenn es Produkte sind, die gekühlt werden müssen, schauen wir, ist die Kühlung in Ordnung, gibt es eine Möglichkeit, wo sich die Beschicker und Beschickerinnen die Hände waschen können, ist irgendwie ein mobiles Handwaschbecken möglich, dann die Rückverfolgbarkeit wird angeschaut, gerade wenn Aufstriche gemacht werden, irgendwelche Produkte, die eingelegt werden, wie Gemüse, wann ist das produziert, die Kennzeichnung ist ein großes Thema auf den Märkten, ist das Produkt auch gekennzeichnet, das sind eben so Punkte, die man kontrolliert.
Simone Koren-Wallis:
Du hast es vorher kurz erwähnt, auch mit Kosmetik und so weiter kostet es ja die Proben auch, aber Spaß beiseite, wie kontrolliert ihr die?
Christian Siedl:
Wir sind ja für die Produktsicherheit oder für das in-Verkehr-Bringen der Lebensmittel oder Produkte am Markt natürlich auch verantwortlich. Das heißt, wir kontrollieren die, wir gehen zu einem Hersteller, der Cremen anbietet und die werden dann von uns amtlich beprobt und diese kommen dann zur AGES, das ist die Agentur für Ernährungssicherheit, das Labor, das akkreditierte, und dort wird dann überprüft, ist es ein sicheres Produkt, sind irgendwelche Inhaltsstoffe, die vielleicht eine allergische Reaktion auf der Haut hervorrufen und nach diesem Gutachten, je nachdem wie es ausgeht, ist es beanstandet oder nicht beanstandet. Wenn es nicht beanstandet ist, ist es okay und wenn es beanstandet wird, passiert ein sogenannter Produktrückruf, das werden alle kennen, wenn man zum Beispiel an der Kasse steht, gibt es ein Produkt, das rückgerufen wird und da kann man dann erkennen, dass es eine lebensmittelrechtliche Kontrolle gegeben hat, gerade in der Kosmetik und das Produkt eigentlich für die Anwendung nicht geeignet war.
Simone Koren-Wallis:
Ich habe das nicht gewusst, dass auch die Cremen quasi unter Lebensmittelsicherheit fallen.
Christian Siedl:
Ja, also alles, was in der Verordnung, kann man nachlesen, also was alles in die Kontrolle der Lebensmittelinspektion reinfällt und da sagt man auch alles, was in Verbindung mit Haut, Schleimhaut oder für den Verzehr geeignet ist, fallt halt zu uns.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, euch wird es nie fad, also ihr habt immer genug zu tun.
Christian Siedl:
Wir haben immer genug zu tun, ja.
Simone Koren-Wallis:
Wie viele Kontrollore gibt es in der Stadt Graz?
Christian Siedl:
Derzeit elf.
Simone Koren-Wallis:
Und elf Kontrollore schaffen das, die ganze Stadt abzudecken?
Christian Siedl:
Wir bemühen uns.
Simone Koren-Wallis:
Wow, was ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte einmal Lebensmittelkontrolleur werden, das ist mein Berufswunsch, wie funktioniert das?
Christian Siedl:
In erster Linie braucht man eine berufsbezogene Ausbildung, entweder kommt man aus einem Tourismuszweig oder...
Simone Koren-Wallis:
Koch zum Beispiel?
Christian Siedl:
Zum Beispiel Koch, also wenn der Koch hintritt, muss er eben auf einer zweiten Bildung für die Matura nachmachen, weil es eine Vorgabe ist, weil man eben in der häuslichen Verwaltung ist und auch eine Zulassungsverordnung gibt, die eben sagt, dass man eben eine gewisse Grundausbildung braucht, um in Wien für diesen Ausbildungslehrgang zugelassen wird. Das heißt immer ein ernährungsbezogener Hintergrund mit Matura oder ein Studium, Ernährungspädagogen oder landwirtschaftlicher Bereich, die erfüllen alle die Vorgabe und dann werden sie in Wien ausgebildet.
Simone Koren-Wallis:
Ihr als Lebensmittelkontrolleure geht sogar in Kindergärten?
Christian Siedl:
Genau, die Spielzeugverordnung ist ja auch ein großes Thema, was wir betreuen und kontrollieren und da ist es natürlich auch wichtig. Es gibt sehr viele Lebensmittel am Markt, die aus Drittländern erzeugt werden, die im Umlauf sind und da ist es auch ganz wichtig, dass man die kontrolliert, weil unsere Kleinsten, die gerade im Kindergarten sind, muss man natürlich auch ein gutes Auge auf diese Spielzeug haben, weil die nehmen das natürlich in den Mund, können sich Farbmittel oder irgendwelche Sachen lösen und das ist auch ganz wichtig, dass das kontrolliert wird.
Simone Koren-Wallis:
Da geht ihr in den Kindergarten rein oder in eine Krippe und sagt, okay, ihr habt den Baustein und dann schaue ich, ob da die Farbe abgeht?
Christian Siedl:
Zum Beispiel, und schauen, welches Spielzeug ist im Umlauf, ist das überhaupt geeignet für Kinder unter drei Jahre zum Beispiel, wie schaut das bei Stofftiere aus zum Beispiel, wenn man ein Teddybär in der Hand hat, können sich da die Augen lösen, dann ist natürlich eine Erstickungsgefahr und das muss natürlich alles auch gekennzeichnet sein, wenn man das kauft und da gibt es gewisse Richtlinien, die müssen eingehalten werden oder bei Spielzeugen, die Geräusche machen, wie laut sind die, wie sind die eingestuft.
Simone Koren-Wallis:
Machen sie mich wahnsinnig, oder? (lacht)
Christian Siedl:
Genau, und es gibt viel am Markt, was wir natürlich überprüfen und versuchen, dass das auch den Sicherheitsanforderungen entspricht.
Simone Koren-Wallis:
Ich glaube, wichtig für alle da draußen ist auch, dass ihr als Kontrolleure ja nicht die Bösewichte seid, sondern ihr wirklich eigentlich nur Gutes tun wollt damit.
Christian Siedl:
Genau, richtig, ja, also wir sind ja für den Gesundheitsschutz verantwortlich, das heißt, wir schauen ja wirklich all diese Produkte, die am Markt sind, dass die auch in Ordnung sind und natürlich auch Schutz vor Täuschung. Es ist sehr viel am Markt, was irreführend ist, es gibt sehr viel gesundheitsbezogene Angaben, die nicht erlaubt sind und da ist es schon wichtig, dass es uns gibt, damit man den Markt auch kontrolliert und im Überblick hat, „hey, das ist gesundheitsschädlich, das muss weg".
Simone Koren-Wallis:
Apropos gesundheitsschädlich, du bist auch der Pilzbeauftragte der Stadt Graz, also dein Job kann vor allem im Herbst lebenswichtig sein, oder?
Christian Siedl:
Genau, eine große Leidenschaft ist es, wir bestimmen Pilze, das heißt, wie kann man sich das vorstellen, das heißt, wenn ihr leidenschaftliche Pilzsammler seid oder ihr seid einfach neugierig, okay, was wächst in den schönen Wäldern der Steiermark, dann kann man mit diesen Exemplaren zu mir kommen, ich werde sie dann anhand oder mit ihnen dann bestimmen, ob sie genussfähig sind oder nicht.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, da kann man einfach sagen, okay, ich komme zu dir oder gibt es dann eigene...
Christian Siedl:
Genau, immer von Montag bis Mittwoch, von 8 bis 12 ist die Möglichkeit dann, gerade in der Pilzsaison, dass ihr unangemeldet mit dem Körberl, Eierschwammerl oder mit den Parasolen oder mit den Steinpilzen zu mir kommt und wir bestimmen sie dann gemeinsam und dann können sie 100% sicher sein, dass es auch ein Steinpilz ist.
Simone Koren-Wallis:
Hast du schon jemanden mal das Leben damit gerettet?
Christian Siedl:
Ja, ich habe immer wieder Fälle, die mit Knollblätterpilzen kommen, die fest davon überzeugt sind, dass es keiner ist und wir bestätigen, dass das eigentlich wirklich rasch zum Tod führt.
Simone Koren-Wallis:
Aber ich muss echt sagen, dein Job ist sehr vielfältig.
Christian Siedl:
Sehr vielfältig und dumm ist auch so interessant.
Simone Koren-Wallis:
Also ich für meinen Teil kann sagen, wieder was gelernt oder habt ihr von einem Pilzbeauftragten der Stadt Graz gewusst. Jetzt sind wir noch in den Osterferien, die nächsten Ferien sind die großen, die Sommerferien.
Und damit da wirklich niemandem langweilig wird, schon gar nicht unseren Kindern, erfahrt ihr beim nächsten Mal alles über die Sportangebote der Stadt Graz. Was es da alles gibt und wann ihr euch da anmelden müsst. Wir hören uns. Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 8: Die Grazer Märkte: wie kann ich dort stehen? Wie werden die kontrolliert?
Ostern steht vor der Türe: wo gibt's Ostermärkte in Graz? Außerdem: alles zu den Grazer Bauernmärkten: wie werden die kontrolliert, wie kann ich dort selbst stehen und wo Sie sich jetzt NEU dafür anmelden können. Das gibt's in dieser Folge von Grazgeflüster mit dem Referatsleiter für Lebensmittelsicherheit und Märkte Christian Siedl.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Kunsthandwerk, Workshops für die Kinder, Straßentheater, Livemusik und vieles mehr. Das gibt es aktuell beim Grazer Ostermarkt am Hauptplatz.
Darüber reden wir heute genauso wie über die Bauernmärkte in Graz. Wie wird denn da eigentlich kontrolliert, wie kann ich selber stehen und welches neue Tool wird dafür genutzt? Das gibt es in dieser Folge von Graz Geflüster. Ich bin Simone Korren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast ist Christian Siedl.
Christian Siedl:
Mein Name ist Christian Siedl, ich bin der Referatsleiter für Lebensmittelsicherheit und Grazer Märkte.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Man riecht schon ein bisschen das Osterfleisch, das Osterbrot, ein paar Finger sind vielleicht schon voll mit Farbe vom Ostereierfärben.
Ostern steht bevor jetzt am Wochenende. Wenn man jetzt aber natürlich nichts selber machen will, und da gibt es sicher einige, ist glaube ich ein guter Anlaufpunkt die Grazer Ostermärkte. Christian, bitte erzähl ganz kurz, wir haben wieder zwei große Ostermärkte bei uns in Graz.
Christian Siedl:
Das ist einmal am Hauptplatz und einmal am Dummlplatz, wo man wirklich das Ostern schön erleben kann. Wir haben sehr viele wunderschöne Beschicker und Aussteller, also wirklich von der Kreativwerkstatt, von schönen Karussells für die Kinder, sowie das gut riechende Geselchte und die Osterkrainer, die man sich nach der Fastenzeit schon sehnlich wünscht. Auch eine gute Unterhaltung und ich glaube, dass unsere Grazer Märkte auch ein schöner Ausflugsziel ist für die Grazer Bevölkerung.
Simone Koren-Wallis:
Du, weil du sagst, du bist ja allgemein für die Märkte zuständig, vielleicht ist es eine blöde Frage, aber dadurch, dass ich wirklich gar keinen Dauer davon habe, ich will irgendwo vermarkten, geh dann einfach zu einem Marktstand hin und sag, ich möchte da jetzt stehen, wie funktioniert das eigentlich?
Christian Siedl:
Genau, man sucht unser Amt auf in der Lagergasse unter 32 und bringt einmal den Vorschlag, ich bin ein neuer Produzent oder ein neuer Beschicker, ich würde gerne am Grazer Bauernmarkt stehen und dann sagen wir, ja, dann müssen wir bitte einen Produzentennachweis ausfüllen und mit diesem Produzentennachweis erfolgt dann bei uns im System dann die Meldung und nach dieser Meldung kommt dann ein Kontrolleur raus, schaut sich einmal den Betrieb an, passt das überhaupt, hat er überhaupt diese Flächen oder produziert er eigenes Fleisch oder Brot und erst nach dieser erfolgreichen Prüfung bekommt er dann von uns das Okay, dass er auf dem Platz stehen darf.
Simone Koren-Wallis:
Das heißt, es wird wirklich kontrolliert? Wird kontrolliert, ja. Da gibt es jetzt kein schwarzes Schaf, kauft es irgendwo ein und sagt, haha, kauf ich günstig und dort verkaufe ich es dann ein bisschen teurer?
Christian Siedl:
Nein, also mit dieser Prüfung bestätigen wir auch, dass das wirklich ein regionaler Bauer ist, der in der Umgebung wirklich sein gutes Gesellschafts für Ostern produziert und das, was auch neu ist, sie bekommen dann so eine Art Gütesiegel, wo der Produzent dann auch sagen kann, er ist ein überprüfter Beschicker der Stadt Graz und all das, was er dort präsentiert und verkauft, wirklich auch von ihm selber ist.
Simone Koren-Wallis:
Und mit den ganzen Beschickern, mit den ganzen Bauern, arbeitet sie da auch mit der Landwirtschaftskammer zusammen?
Christian Siedl:
Genau, also wir arbeiten ganz eigen mit der Landwirtschaftskammer zusammen, also es ist ein schönes Zusammenspiel, weil wir uns untereinander abstimmen, wo entstehen gerade neue Beschicker und welche Beschicker sind von uns schon kontrolliert und da ist die Landwirtschaftskammer federführend.
Simone Koren-Wallis:
Wenn ich jetzt neu stehen will oder vielleicht habe ich eine Pause gemacht und ich will wieder stehen, da gibt es jetzt dann aber auch etwas Neues, gell?
Christian Siedl:
Ja, es ist so, dass wir eben die Servicestellen miteinbinden wollen, damit dann auch die Flexibilität der Beschicker da ist, dass man sagt, okay, Sie müssen nicht mehr zwingen in die Lagergasse, sondern können alle Servicestellen in Graz nutzen, dass Sie zu einem Ticket kommen für den Marktplatz.
Simone Koren-Wallis:
Nachdem ich das überhaupt nicht einschätzen kann, was kostet so ein Tisch auf dem Bauernmarkt?
Christian Siedl:
Also von Montag bis Donnerstag 4,60 Euro und von Freitag bis Samstag 7 Euro hat der Tisch.
Simone Koren-Wallis:
Also ich gehe selbst gern zum Markt und für mich ist das so ein Erlebnis, findest du das nicht auch?
Also das ist so, Markt gehen ist ganz was anderes, als wenn ich normal einkaufen gehe.
Christian Siedl:
Ja, also Markt gehen ist immer ein schönes Flair, es ist nach wie vor dieser Kundenkontakt, die Nähe zum Produzenten, zum Beschicker, diese Vielfalt, die dort angeboten wird, diese verschiedenen Düfte, die für einen einwirken, es ist wirklich ein Highlight und es ist eine schöne Tradition, die wir in Österreich noch haben und es soll noch gut besucht werden, damit es auch in der neuen Generation fortgeführt wird.
Simone Koren-Wallis:
Neben dem Erlebnis, welche Vorteile gibt es, dass ich sage, ich gehe jetzt auf einen Grazer Markt?
Christian Siedl:
Also wirklich ein schöner Vorteil ist, wirklich die Regionalität, also die Produkte, das ist ja jetzt wirklich auch ein schöner Trend, dass es wirklich auch in mehren Köpfen jetzt schon drinnen ist, dass man wirklich Lebensmittel kauft, die wirklich in der Umgebung produziert werden, damit man auch die Möglichkeit hat, das zu kaufen und ich finde, das ist immer ein schöner Vorteil, wenn ich auch dann den Beschicker kenne, wo ich sage, hey, das ist das Gerücht vom XY und ich habe da einen Bezug dazu, der macht das nach meinem Geschmack, ich habe ein bisschen eine Persönlichkeit drinnen und ich finde, das ist schon etwas Tolles.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es eigentlich so einen Lieblingsmarkt von dir? Darf man das eigentlich als Leiter oder sagst du, es sind alle gleich gut?
Christian Siedl:
Nein, es sind alle schön, wirklich.
Simone Koren-Wallis:
Du darfst nichts anderes sagen jetzt, ge?
Christian Siedl:
Nein, ich muss sagen, vom Flair her ist der Josefplatz für mich, vom Flair her wirklich schön, aber genauso der Lenkplatz oder die außenliegenden Märkte haben alle seinen Reiz.
Simone Koren-Wallis:
Ich glaube, jeder Standler freut sich natürlich, wenn ihr da draußen regional einkauft, damit wisst ihr auch, wo das Fleisch, wo die Eier, wo alles herkommt und falls ihr euch das jetzt noch anhört vor Ostern, Christian, können wir jetzt noch frohe Ostern wünschen.
Christian Siedl:
Also ich kann dem nur zustimmen, also bitte geht auf die Grazer Baumärkte, es ist wirklich ein Erlebnis und gerade zu Ostern, die guten Produkte, die regional produziert werden, werden euch das Osterfest sicher schmackhaft machen und in diesem Sinne wünsche ich auch schöne Ostern.
Simone Koren-Wallis:
Und für alle, die es sich danach anhören, das nächste Ostern kommt bestimmt.
Lieber Christian, nachdem du nicht nur für die Märkte zuständig bist, sondern auch für die Lebensmittelsicherheit, gibt es heute gleich noch eine Folge, denn ihr kontrolliert ja auch den Gastrobereich, aber eben nicht nur das. Was ihr auch in der Kosmetikbranche oder zum Beispiel in Kindergärten macht und warum du, Christian, vielleicht sogar das ein oder andere Leben retten kannst, das gibt es in der nächsten Folge. Am besten gleich weiterhören.
Ich freue mich.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Kleine Schätzfrage, wie viele fahrradfreundliche Tempo-30-Straßen gibt's in Graz in Kilometern? 70, 250 oder 800? Die Antwort gibt's in dieser Folge von Graz Geflüster, in der sich alles rund ums Radl dreht. Zum Beispiel auch, was ist geplant in der Stadt, wie viel wird investiert und ob und wie Radfahrer:Innen vielleicht bald bei Rot über die Ampel fahren dürfen. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation, mein Gast Wolfgang Feigl.
Wolfgang Feigl:
Mein Name ist Wolfgang Feigl, ich bin Leiter der Abteilung für Verkehrsplanung und ich möchte heute wirklich gerne mal erklären, wieso Graz auf dem Weg ist zu einer europäischen Radhauptstadt.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Am Montag war offizieller Frühlingsbeginn, was heißt das? Die Natur erwacht schön langsam, ich finde auch, dass die Grazer:Innen schön langsam erwachen, auch ein bisschen freundlicher durch die Gegend gehen und auch mehr mit dem Rad fahren. Ist so ein bisschen mein Eindruck. Lieber Wolfgang Feigl, sind Sie ein Schönwetter-Radfahrer oder ein Ich-fahre-immer-mit-dem-Rad-egal-welches-Wetter?
Wolfgang Feigl:
Ich glaube, ich bin durchaus der normale, typische Grazer Radfahrer, Radfahrerin. Wir sehen immer mehr, dass die Leute nicht nur bei schönstem Wetter mit dem Fahrrad fahren, sondern eigentlich fast das ganze Jahr über. Und so gesehen werden wir natürlich jetzt am Frühlingsbeginn mehr Radfahrer:Innen am Radweg antreffen als im Winter, aber es ist mittlerweile durchaus ein Ganzjahresthema.
Simone Koren-Wallis:
Sind Sie mit dem Radl hergekommen?
Wolfgang Feigl:
Ich bin deswegen auch ein bisschen außer Atem, weil ich gerade vor Ihrem Büro eingeparkt habe mit dem Fahrrad und jetzt hier sitzen darf.
Simone Koren-Wallis:
Ist Graz wirklich eine Radfahrhauptstadt?
Wolfgang Feigl:
Graz ist definitiv eine Radfahrhauptstadt, wir können durchaus auch sagen, eine europäische Radfahrhauptstadt. Wir haben in Graz 20% aller Wege der Grazer Wohnbevölkerung, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Das ist im Verhältnis zu anderen Städten relativ viel. In Wien werden 9% aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Graz liegt aber hier doch auch gleichauf mit Salzburg und Bregenz, die auch um die 20% Radverkehrsanteil haben.
Simone Koren-Wallis:
Das klingt wirklich viel eigentlich. Ist das auch, gell?
Wolfgang Feigl:
Ich glaube, Graz hat einen Riesenvorteil. Wir haben nicht nur ein sehr schönes und angenehmes Klima das ganze Jahr über. Wir haben mit unseren 300.000 Einwohnern eine gute Größe, aber davon auch 60.000 Studierende, die in Graz anwesend sind. Und damit auch schon eine ganz gute Masse an Studierenden, die das Rad gern benutzen. Und deswegen eben von den 1980ern, wo wir noch 8% Radverkehrsanteil gehabt haben, jetzt eben auf 20% Radverkehrsanteil gekommen sind.
Simone Koren-Wallis:
Also mehr als verdoppelt.
Wolfgang Feigl:
Es ist mehr als eine Doppelung, so ist es. Und wir haben ehrgeizige Ziele. Wir wollen tatsächlich auch hier den großen Städten, den großen Vorbildern wie Kopenhagen oder Amsterdam auch durchaus hier folgen. Und in den nächsten Jahren den Radverkehrsanteil noch wesentlich steigern, weil es auch sehr viel Sinn für die Stadt macht, hier mehr Radfahrer:innen zu haben.
Simone Koren-Wallis:
Ich kann's mir jetzt denken, aber für alle, die es sich vielleicht nicht denken können, können Sie es ein bisschen erläutern?
Wolfgang Feigl:
Wir sind immer auf der Suche nach flächeneffizienten Verkehrsmitteln. Der gelebte Straßenraum und der gewachsene historische Straßenraum ist beengt, das wissen wir alle. Wir suchen nach Verkehrsmitteln, die sehr flächeneffizient sind. Dazu zählt einmal auch vom Platzverbrauch der Fußverkehr und der Radverkehr ganz stark. Nehmen wir nur das Beispiel her, ein Fahrrad braucht rund fünf Quadratmeter Platz, wenn es sich bewegt, wenn es gefahren wird. Ein Kfz, ein Auto braucht 140 Quadratmeter Platz, wenn es mit 50 km/h durch die Stadt fährt. Und so gesehen spart man auch einfach viel Platz, wenn immer mehr Radfahrer:innen in Graz mit dem Fahrrad fahren.
Simone Koren-Wallis:
Nicht nur das, es ist ja auch viel gesünder.
Wolfgang Feigl:
Zu den Fakten vielleicht auch noch einmal, wir sind auch froh, wenn die, die gerne mit dem Fahrrad fahren, auch ein gutes Angebot in Graz vorfinden. Weil die dann auch helfen, das Straßennetz so zu entlasten für alle, die wirklich das Auto auch brauchen. Für Ladetätigkeiten, für Berufsverkehr, um ja auch für die ein besseres und angenehmeres Straßennetz zur Verfügung zu stellen.
Simone Koren-Wallis:
Weil Sie das Netz gerade angesprochen haben, wie groß ist das Radverkehrsnetz in Graz? Kann man das mit Kilometern sagen?
Wolfgang Feigl:
Ja, durchaus. Wir haben ein dezidiertes Radverkehrsnetz, da gelten alle Radfahrstreifen, Mehrzweckstreifen und Radwege dazu, von 150 Kilometer Länge. Das ist durchaus viel in einem Straßennetz der ganzen Stadt Graz von 1.000 Kilometer.
Unser großer Vorteil aber ist auch seit 1992 das Tempo 30 Straßennetz. Wir haben von diesen 1.000 Kilometern Straßennetz gesamt ja 800 Kilometer sehr fahrradfreundliche Tempo 30 Straßen, die auch jederzeit und gut für die Radfahrer:innen genutzt werden. Und das bestätigen auch Umfragen, die wir gemacht haben, wieso überhaupt Grazerinnen und Grazer mit dem Fahrrad fahren. Und hier ist es gar nicht so der Umweltgedanke oder das Faktenbasierte, sondern einfach eher auch die Emotion. 90 Prozent unserer Befragten haben uns gesagt, sie fahren, weil es einfach flexibel und unabhängig ist, mit dem Fahrrad zu fahren. 80 Prozent schätzen es sehr, kein Parkplatzproblem zu haben, wenn sie mit dem Fahrrad einkaufen fahren, zur Ausbildung, in den Beruf. Und sogar 70 Prozent sagen, es macht einfach Spaß, in Graz das Fahrrad zu benutzen.
Simone Koren-Wallis:
Wahrscheinlich sind es auch viele Faktoren gemeinsam, oder?
Wolfgang Feigl:
Genau. Es ist sicher ein emotionales Thema. Es ist sicher nicht nur ein Vernunftthema, mit dem Fahrrad zu fahren, aber auch.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es noch weitere Zahlen, Daten, Fakten zu Graz und den Radlern?
Wolfgang Feigl:
Naja, was wir jetzt seit 2019 haben, ist die sogenannte Radoffensive, gemeinsam mit dem Land Steiermark. Hier dürfen wir in zehn Jahren, von 2020 bis 2030, 100 Millionen Euro ausgeben, um das Radnetz in Graz sicherer zu machen. Diese große Summe wird von Land Steiermark und Stadt Graz jeweils zur Hälfte bestritten. Und damit sind wir auf einem Schlüssel auch pro Einwohner von 33 Euro pro Jahr. Jetzt kann man sich darunter wahrscheinlich wenig vorstellen, aber wenn man zum Beispiel die Rad-Hauptstadt anschaut, Amsterdam oder Kopenhagen. Amsterdam hat 11 Euro pro Jahr zur Verfügung für den Radwegeausbau. Kopenhagen ein bisschen mehr als wir, 36 Euro pro Jahr und Einwohner. Also wir sind ja durchaus auch vom Budget in einer Liga von den europäischen Radhauptstädten.
Simone Koren-Wallis:
Aber was bedeutet diese Radoffensive jetzt genau? Vielleicht nicht in Zahlen, sondern was ist da alles geplant?
Wolfgang Feigl:
Bei der Radoffensive Graz hat man gemeinsam mit dem Land Steiermark ein Radnetz entwickelt, wo man bis 2030 das Radnetz sehr gut ausgebaut haben will. Hier geht es uns vor allem auch darum, dass auch die schwächeren Verkehrsteilnehmer, Kinder in die Schule zum Beispiel mit dem Fahrrad, sichere Radwege haben. Aber auch Senior:innen, die auch ein sicheres Angebot benötigen, hier auch noch im Alter gut sich mit dem Fahrrad in der Stadt bewegen können.
Und im Zuge der Radoffensive wird dieses Radnetz von 150 Kilometer sukzessive erweitert auf ein sicheres Radwegenetz in der Stadt Graz. Das Radwegenetz der Zukunft ist für uns durchgängig, sicher und auch einfach befahrbar.
Simone Koren-Wallis:
Gibt es dann auch irgendwie so andere Offensiven oder andere Überlegungen, wie diese Grünphasen für Radler oder so, dass man irgendwie auf den Ampeln auch schaut, dass der Radler schneller durchkommt? Ist da auch irgendwas geplant?
Wolfgang Feigl:
Ja, auch das wird ständig von uns und auch den benachbarten Abteilungen evaluiert. Hier gibt es auch immer wieder gesetzliche Änderungen, die uns auch dabei helfen, sinnvolle Maßnahmen umzusetzen. Zum Beispiel jetzt ganz aktuell gibt es ja die Möglichkeit, teilweise auch das Abbiegen bei Rot für Radfahrer:innen zu ermöglichen. Hier gibt es gerade gemeinsam mit dem zuständigen Straßenamt auch erste Versuchsanordnungen, wo man diese Kreuzungen findet, wo man das auch mal probieren kann. In anderen Städten, wie z.B. Zürich, ist das schon üblich und funktioniert sehr gut dort.
Simone Koren-Wallis:
Wie könnte man noch mehr Grazer:Innen dazu bewegen, aufs Rad umzusteigen oder überhaupt einmal mit dem Rad zu fahren?
Wolfgang Feigl:
Wir fangen da mit den Kleinsten an, wir fangen mit den Volksschulkindern an, wo es das Fahrradtraining gibt für die Ausbildung zum Fahrradführerschein. Damit können die Kinder schon mit zehn Jahren dann das im öffentlichen Raum sich selbst bewegen und nicht erst mit zwölf.
Simone Koren-Wallis:
Das war früher mit zwölf, genau.
Wolfgang Feigl:
Wir machen seit 30 Jahren erfolgreich dieses Training der Grazer Volksschulkinder. Da haben wir einen sehr guten Erfolg und hier gibt es durchaus tausend Kinder pro Jahr, die dieses Training durchlaufen und damit haben wir schon mal den Grundstock geschaffen für ein späteres, gutes Radler:Innen-Leben, wenn man so will.
Was wir durchaus auch jetzt noch weiter forcieren wollen, ist auch das Thema Wie komme ich zur Schule? Deswegen gibt es auch heuer wieder das Projekt Bizibus. Hier wollen wir Volksschulkinder motivieren, mit dem Fahrrad gemeinsam mit Schulkolleg:Innen in die Schule zu fahren. Hier haben wir 2022 ein erstes Pilotprojekt erfolgreich durchgeführt.
Die Kinder waren sehr begeistert von der Idee und wir suchen jetzt 2023 einen neuen Schulstandort, um eben hier von allen Richtungen Kinder in eine Schule mitzunehmen und unter Anleitung Erwachsener mit dem Fahrrad in die Schule zu kommen und immer mal aus diesem Elterntaxi Alltag auszubrechen.
Simone Koren-Wallis:
Was heißt Bizibus?
Wolfgang Feigl:
Bizibus ist eine Idee aus Spanien. Bizi kommt von Bicicletta, aus dem Spanischen.
Simone Koren-Wallis:
Ah, alles klar.
Wolfgang Feigl:
Aber wir stoppen natürlich nicht bei den Jüngsten, es geht dann auch weiter. Wir beraten auch ganz viele Firmen und Betriebe in der Stadt Graz über das Jahr über das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement. Ganz viele große Firmen haben immer stärkere Anforderungen von Mitarbeiter:Innen, die mit dem Fahrrad in den Betrieb kommen wollen. Das setzt uns zum einen natürlich positiv unter Druck, auch Radwege dorthin bauen zu können, zu diesen großen Betriebsstandorten. Aber natürlich auch diese Firmen fragen uns um Beratung zum Thema Radabstellanlagen, zum Thema betriebliches und Gesundheitsvorsorge. Und hier sehen wir auch einen großen Anteil, hier sind glaube ich auch die Firmen mittlerweile unter einem gewissen Druck, auch nach der Suche der besten Köpfe am Arbeitsmarkt. Sie müssen mittlerweile einen ganz guten Mobilitätsmix anbieten, um auch hier gute Arbeitskräfte in Graz zu bekommen.
Simone Koren-Wallis:
Aber ihr könnt bei dem auch unterstützen, das heißt, wenn ich jetzt eine Firma habe und sage, okay, ich möchte da schauen, da kann man wirklich bei euch sich melden und sagen, bitte helft mir, ich möchte gern das, das und das, was das Radfahren betrifft in meiner Firma.
Wolfgang Feigl:
Ja, genau. Wir beraten auch zum Thema Parken, Radfahren zu Fuß mit den Öffis. Wir suchen jetzt tatsächlich noch ungefähr fünf Firmen, die sich vielleicht heuer sogar bereit erklären mitzumachen bei diesem betrieblichen Mobilitätsmanagement.
Ein anderer wichtiger Punkt für mich wäre noch das Thema Senior:innenradfahrtraining. Hier wollen wir unterstützen, aber auch das neue Thema Elektrofahrräder kommt hier stark ins Spiel. Hier gibt es einfach jetzt technische Möglichkeiten und auch sehr schnelle und stark beschleunigende Fahrräder, wo Senior:innen auch, wie jeder andere natürlich auch, aber hier speziell eine gute Einschulung brauchen. Und auch hier beraten wir Senior:innen im Zuge eines Radtrainings, wie sie mit einem Elektrorad gut umgehen können. Mittlerweile sehen wir ja auch, dass der Marktanteil bei den neuen Fahrrädern, gerade die Elektroräder, fast schon die Hälfte der Neuräder ausmachen.
Simone Koren-Wallis:
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Wolfgang Feigl:
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass das Thema Rad ein Bastelstück ist in einer gesamten Verkehrskultur in der Stadt Graz.
Zur Verkehrskultur gehört einfach, dass man sich gut in der Stadt bewegen kann, angenehm auch alle Generationen angenehm in der Stadt bewegen können. Wenig eigentlich Einschränkungen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenig Einschränkungen. Und dadurch wird, glaube ich, die Stadt in Summe sicherer, weil wir weniger Unfälle haben. Die Stadt wird leiser, weil auch der Radverkehr in Summe kein lauter Verkehr ist. Und ich glaube, die Stadt wird in Summe, wie es man auch bei anderen europäischen Radhauptstädten schon sieht, lebenswerter, noch lebenswerter als heute.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 6: Weltfrauentag: Warum es diesen Tag gibt und er so wichtig ist!
Männer verdienen in Österreich im Durchschnitt um 18,8 Prozent mehr als Frauen. In kaum einem anderen EU-Land ist der Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern so groß. Falls dieser Satz noch nicht ausreicht, um zu erklären, warum der Weltfrauentag so wichtig ist, hier noch mehr Infos von der Leiterin des Referats "Frauen und Gleichstellung" Doris Kirschner.
Intro/Simone Koren-Wallis:
In vielen Regionen der Welt sind Frauen bereits besser gebildet und erfolgreicher und bewirken so einen grundsätzlichen Wandel unserer männerdominierten Welt. Schöner Satz heute zum Weltfrauentag, oder? Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Graz Geflüster.
Es geht heute einfach darum, warum es diesen Tag überhaupt gibt und warum er so wichtig ist. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Doris Kirschner.
Doris Kirschner:
Mein Name ist Doris Kirschner, ich bin die Leiterin vom Referat Frauen und Gleichstellung in der Stadt Graz. Ich bin 56 Jahre alt, falls das jemanden interessiert. Schon lange bei der Stadt Graz, ganz, ganz lange in der Arbeit mit und für Frauen und das war es eigentlich schon.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Heute ist der 8. März, Weltfrauentag. Liebe Doris Kirschner, warum gibt es denn diesen Tag überhaupt?
Doris Kirschner:
Der Weltfrauentag ist einfach ein international begangener Tag, einmal im Jahr, festgelegt von den Vereinten Nationen, wo es darum geht, Frauenthemen verstärkt an die Öffentlichkeit zu bringen. Der Internationale Frauentag ist von seiner Tradition her auch ein Kampftag für Frauenrechte und hat einfach eine lange Geschichte. 1911 hat der erste Internationale Frauentag stattgefunden und weltweit ist es heute noch so, dass Frauen auf die Straße gehen, dass es Veranstaltungen gibt, dass auf Ungerechtigkeiten hingewiesen wird, dass Forderungen erhoben werden, um einfach aufmerksam zu machen, dass noch nicht alles so ist, wie es sein sollte.
Simone Koren-Wallis:
Aber warum der 8. März?
Doris Kirschner:
Dieses Datum geht zurück auf ein Ereignis in Amerika, wo Arbeiterinnen in einer Textilfabrik gestreikt haben und darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Arbeitsbedingungen einfach katastrophal sind. Und diese Arbeiterinnen sind dann zurückgedrängt worden, sozusagen in eine Halle hineingedrängt worden. Und diese Halle hat Feuer gefangen und die Arbeiterinnen sind da zu Tode gekommen. Und deswegen ist dieses Datum sozusagen auch als Gedenkdatum gewählt worden.
Simone Koren-Wallis:
Traurig und verständlich, aber warum ist dieser Tag für uns Frauen so dermaßen wichtig?
Doris Kirschner:
Es ist der eine Tag im Jahr, und das ist die traurige Nachricht bei dem Ganzen, wo Frauenanliegen tatsächlich öffentlich wahrgenommen werden, wo Medien darüber berichten, wo Themen, Frauenangelegenheiten, noch immer bestehende Benachteiligungen von Frauen eine Chance haben, in die Öffentlichkeit zu kommen. Eigentlich sollte das permanent so sein, aber die Wertigkeit vom Internationalen Frauentag besteht einfach darin, dass weltweit Rechte und Benachteiligungen von Frauen zum Thema gemacht werden und es damit einfach eine gute Öffentlichkeit gibt.
Simone Koren-Wallis:
Weil gerade das Wort Benachteiligungen gefallen ist, Stichwort Gender Pay Gap. Wir Frauen verdienen im Durchschnitt leider noch immer viel weniger als die Männer. Und was auch vor allem in letzter Zeit immer schlimmer wird, finde ich, ist die Gewalt gegenüber Frauen. Und da haben Sie auch eine sehr, sehr traurige Statistik.
Doris Kirschner:
Frauen erfahren in ihrem Umfeld Gewalt. Es gibt Schätzungen, dass jede fünfte Frau in Österreich Gewalt erfährt, beziehungsweise wenn man da auch noch die sexuelle Belästigung dazunimmt, dann ist es jede dritte Frau in Österreich, die irgendwann im Laufe ihres Lebens Gewalt erfährt.
Simone Koren-Wallis:
Da auch die Info, wohin sich Frauen bei uns in Graz wenden können, egal ob physische oder psychische Gewalt. Es gibt das Gewaltschutzzentrum, die Beratungsstelle Tara, das ist der ehemalige Frauennotruf und vieles, vieles mehr. Und alle Kontakte werde ich euch auf graz.at/podcast verlinken. Da passt auch meine nächste Frage. Wo steht denn die Frau von heute eigentlich in der Gesellschaft?
Doris Kirschner:
Es hat sich natürlich ganz, ganz viel verändert. Frauen sind selbstbewusster. Frauen gehen ihre eigenen Wege. Frauen machen Ausbildungen. Frauen stehen im Berufsleben. Und es ist überhaupt nicht unser Anspruch, Frauen grundsätzlich als Opfer zu sehen. Ganz im Gegenteil. Unser Job ist auch sehr stark, Frauen zu stärken, ihre Entscheidungen zu treffen und ihren Weg zu gehen. Es gibt aber sozusagen auch die andere Seite. Und dafür sind die Beratungsstellen da. Es gibt eben noch immer Gewalt. Es gibt Benachteiligungen. Und deswegen ist es wertvoll, dass es Anlaufstellen gibt, wo die Frauen hingehen können.
Simone Koren-Wallis:
Und davor sollte sich wirklich keine fürchten. Jeder Frau kann geholfen werden. Nicht nur heute an diesem Weltfrauentag natürlich. Apropos, was passiert eigentlich heute in Graz?
Doris Kirschner:
Es gibt schon seit einigen Jahren das Bündnis 0803, das wir von der Stadt Graz auch fördern, sprich finanzieren. Das ist eine Plattform, wo alle möglichen Veranstaltungen zusammengefasst werden. Veranstaltungen von allen möglichen Organisationen. Aber am 8. März selber ist natürlich immer die Veranstaltung schlechthin, die Demo zum 8. März, die es auch heuer wieder geben wird. Und am Abend gibt es auch wieder eine Veranstaltung im Schauspielhaus, wo ganz viele verschiedene Beiträge von unterschiedlichen Organisationen Platz haben werden, wo einfach gefeiert wird.
Simone Koren-Wallis:
Es darf also auch natürlich gefeiert werden.
Doris Kirschner:
Es muss gefeiert werden.
Simone Koren-Wallis:
Liebe Frau Kirschner, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Was würde ich mir für die Zukunft noch wünschen?
Doris Kirschner:
Dass es uns als Referat Frauen und Gleichstellung nicht mehr braucht und dass es tatsächlich eine Gleichstellung der Geschlechter gibt, ist natürlich auch wieder ein großgegriffener Wunsch, aber das kann nur das Ziel jeglicher Aktivität sein.
Simone Koren-Wallis:
Vielen Dank, liebe Doris Kirschner. Apropos Zukunft, die Vorbereitungen für den Grazer Frauenpreis laufen. Die Verleihung ist am 17. Mai mit dem Ziel, Frauenprojekte, Fraueneinrichtungen sichtbar zu machen und zu würdigen und natürlich auch die Personen dahinter. Man kann bereits Projekte einreichen und zwar bis zum 13. März. Alle Infos gibt es unter graz.at/frauenpreis. Das war die Folge zum Weltfrauentag. Das nächste Mal geht es aufs Radl und um die Radfahrhauptstadt Graz. Ich hoffe, wir hören uns.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Wie kann euch das Umweltamt der Stadt Graz eigentlich helfen? Ist es immer so geschickt, neue Geräte gegen alte auszutauschen? Und warum gibt es keine A+++ Geräte mehr zu kaufen? Das beantworten wir in dieser Folge des neuen Stadt Graz Podcasts Graz Geflüster. Diesmal wieder aus dem Umweltamt. Mein Name ist Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast ist wieder Werner Prutsch.
Werner Prutsch:
Mein Name ist Werner Prutsch. Ich bin der Leiter des Umweltamtes der Stadt Graz.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Herzlich willkommen zurück hier im Umweltamt im Büro von Werner Prutsch, in das ich euch mitnehmen darf. Wir haben schon sehr, sehr viel über Energiesparen gehört. Warum und wie? Ein ganz großer Punkt sind die alten Geräte. Es gibt ja ganz, ganz viele alte Geräte, die noch überall in Wohnungen, in Häusern in Graz herum lagern, natürlich auch noch in Verwendung sind. Und jetzt hört man ganz viel neue Geräte, viel, viel besser, viel besser, was die Energieeffizienz betrifft. Ist es jetzt sinnvoll, diese alten Geräte rauszuschmeißen und sich neue zu besorgen?
Werner Prutsch:
Auch da gibt es leider wieder keine ganz einfache Antwort, indem man jetzt zum Beispiel sagen könnte, ja, machen Sie das in allen Fällen. Es kann durchaus so sein, dass die technische Weiterentwicklung nicht so viel gebracht hat, dass sich das dann wirklich auszahlt, nämlich in dem Sinne jetzt nicht nur für das persönliche Budget auszahlt, sondern was bei diesem Gerätetausch schon auch berücksichtigt werden muss, ist, dass für die Produktion eines neuen Gerätes irgendwo auf der Welt dann ja auch sehr viel Energie aufgewendet werden muss. Die Fachleute nennen das dann sogenannte graue Energie, die im Gerät sozusagen in der Produktion drinnen steckt und nicht dann während der Nutzung verbraucht wird. Ja, man muss sich das dann schon anschauen. Also wenn das Geräte sind, die dann langsam in den Bereich kommen, wo eben technische Mängel zu sehen sind, also wenn irgendwo die Dichtung eines Kühlschrankes wirklich nicht mehr in den Griff zu bekommen ist und der Kühlschrank dann ständig überfeuchtet ist im Inneren, dann kann man davon ausgehen, dass da sehr viel warme Raumluft hinein strömt und dann wird es irgendwo schon an der Zeit sein, das Gerät vielleicht auch auszutauschen. Solange ein Gerät technisch eigentlich einwandfrei funktioniert, muss man sich das glaube ich sehr genau überlegen, ob man es austauscht oder nicht aus den vorhin genannten Gründen. Ich glaube, dass bei sehr vielen Gerätetauschempfehlungen schon auch durchaus handfeste wirtschaftliche Interessen dahinterstehen, dass das natürlich von Geräteherstellern und so weiter immer wieder irgendwo propagiert wird, weil die natürlich auch den Absatz ihrer Geräte damit ankurbeln möchten. Ob das dann sowohl für die eigene Geldbörse als auch für den globalen Energieverbrauch so ein großer Vorteil ist, das muss man sich dann wirklich im Einzelfall entsprechend anschauen. Ich bin nicht der größte Fan dieser Gerätetauschgeschichten. Das ist eine einfache Energieberatungsformel, die immer wieder verwendet wird, aber ich bin mir nicht sicher, ob man da überall etwas Gutes tut. Wenn man das Gerät einschätzen möchte, dann ist es sinnvoll zu schauen, ob das sogenannte Energiekennzeichnungslabel noch irgendwo vorhanden ist.
Simone Koren-Wallis:
Das ist das mit dem A++?
Werner Prutsch:
Genau, das sind diese farbigen Streifen in der Regenbogenkonstellation von Rot bis Grün. Da hier nur bitte aufpassen, diese Kennzeichnung ist 2021 von der EU geändert worden. Früher ist die Skala von einem weichen D wie Dora bis zu einem A mit drei Plus gegangen. Das war die alte Kennzeichnung, also Geräte, die vor 2021 gekennzeichnet worden sind.
Die neue Bezeichnung geht jetzt von G wie Gustav bis zu A und es gibt diese Plus-Unterkategorien jetzt nicht mehr. Das heißt, das, was früher zum Beispiel eine Kennzeichnung B wie Berta gewesen ist, das würde jetzt einer Kennzeichnung E wie Emil entsprechen.
Simone Koren-Wallis:
Okay, das heißt, dieses A++ ist jetzt ein A, A++ wäre jetzt eine B.
Werner Prutsch:
Genau, das hat sich verschoben. Es sind zwar sieben Stufen geblieben, aber es hat sich die Bezeichnung geändert.
Simone Koren-Wallis:
Da wurde es kompliziert. Aber wichtig sind die Farben, oder? Wenn man sich ein neues Gerät anschaut, das ist der grüne Bereich, oder?
Werner Prutsch:
Genau, das Dunkelgrün ist die beste Kategorie, das ist geblieben. Das heißt, wenn ich ein altes Gerät austausche, dann lohnt sich schon ein Blick vielleicht irgendwo auf der Seite des Geräts, wo dann diese alte Plakette noch draufklebt. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob die dann schon irgendwo dunkelorange ist oder vielleicht noch im hellgrünen Bereich. Also ein Gerät, das hellgrün gekennzeichnet ist, das würde ich, solange es noch einwandfrei funktioniert, nicht austauschen.
Simone Koren-Wallis:
Wenn ich mir jetzt tatsächlich ein neues Gerät zulegen möchte, ist es natürlich sehr, sehr gut, dass man sagt, ich lasse mich beraten. Und beraten ist, glaube ich, schon das richtige Stichwort, denn man kann sich auch hier bei euch beraten lassen. Wie könnt ihr das vom Umweltamt unterstützen?
Werner Prutsch:
Da gibt es zwei Möglichkeiten aus dem Umweltamt heraus. Es gibt einmal schon sehr viel Basisinformation, die über unsere Homepage verfügbar ist, also unter umwelt.graz.at kann man da im Bereich Energie schon sehr viele Informationen auch herausziehen, also sehr viele Energiespartipps, beziehungsweise wie man dann seinen Haushalt eben richtig analysiert in Richtung Energieverbrauch. Wenn diese Dinge vielleicht nicht klar drüber kommen sollten, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich dann direkt an uns zu wenden, bei uns anzurufen und entsprechend Fragen zu stellen. Da bemühen wir uns dann im Einzelfall eben auch herauszufinden, woran es liegen könnte, beziehungsweise wenn das dann umfangreichere Geschichten werden, dann ist es auch möglich Energieberatungsstellen, von denen es in Graz ja mehrere gibt, die auch entsprechend dafür heranzuziehen. Es gibt Energieberatungsstellen bei den großen Energieversorgern, bei der Energie Steiermark, bei der Energie Graz und auch von der Stadt Graz aus in der Grazer Energieagentur, beziehungsweise in der Energieagentur Steiermark, die vom Land Steiermark aus betrieben wird.
Simone Koren-Wallis:
Was kostet so eine Energieberatung?
Werner Prutsch:
Das ist ganz verschieden. Einfache Auskünfte werden natürlich so erledigt, dass es praktisch gar nichts, wenn dafür eine Analyse notwendig ist, wenn es zum Beispiel um die Heizungsumstellung in einem Einfamilienhaus gibt oder was, dann braucht man schon professionelle Beratung. Dann wendet man sich zum Beispiel an die Energieagentur Steiermark und dort gibt es dann immer wieder geförderte Modelle. Es gibt dann zum Beispiel Beratungschecks, die man in Anspruch nehmen kann und da muss man eben dann schauen, inwieweit man das über diese Schecks abwickeln kann beziehungsweise für Einfamilienhaus können sich solche Dinge dann irgendwo so im 1-200-Euro-Bereich irgendwie bewegen, einmal eine Erstberatung zu bekommen.
Simone Koren-Wallis:
Aber man spart sich dann dadurch ja auch sehr viel.
Werner Prutsch:
Das zahlt sich schon aus. Natürlich zahlt sich das in den allermeisten Fällen aus. Wenn es dann irgendwo sehr ins Detail geht, also dann muss man sich an eine Firma wenden, die dann entsprechend auch die Umstellungen durchführt.
Simone Koren-Wallis:
Die Stadt Graz hilft also dort natürlich, wo es geht. Ich habe jetzt eine Abschlussfrage, weil wir kommen zum Ende von unserem Energiespar-Podcast. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Wo das Ganze hingeht?
Werner Prutsch:
Ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein Wunsch von mir, sondern das sollte unser aller Wunsch sein, dass wir eben diese Transformation des Energiesystems in einer höheren Geschwindigkeit schaffen, als das bis jetzt gewesen ist. Wir haben in den letzten 50 Jahren ungefähr ein Drittel fossile Energie ersetzt. Und wir müssten eigentlich diese restlichen, unter Anführungszeichen restlichen, weil es ja sehr viel ist, zwei Drittel in wenigen Jahren schaffen eigentlich. Das heißt, die Schlagzahl, die Geschwindigkeit bei der ganzen Geschichte muss schon sehr stark gesteigert werden. Und dafür, damit man das machen kann, braucht es einen umfassenden gesellschaftlichen Konsens.
Das heißt, die Leute müssen auch alle anerkennen, dass das ein wichtiges Thema ist und vor allem, dass es uns auch betrifft. Also nicht dieses alte Argument verwenden, es müssen einmal zuerst die Inder, Chinesen oder Amerikaner sparen, sondern dass es uns durchaus persönlich betrifft und wir im eigenen Bereich auch etwas machen müssen. Ich glaube, wenn dieses gemeinsame Verständnis vorhanden ist, dann wird es auch gehen, weil die Wirtschaftskraft bei uns sicher groß genug ist, diese Transformation auch zu schaffen. Das heißt, es liegt nicht am Können, sondern sehr stark am Wollen eigentlich.
Simone Koren-Wallis:
Das waren die Folgen zum Thema Energiesparen. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Für euch und natürlich auch für die Umwelt und fürs Konto, wohlgemerkt. Nächstes Mal geht es um Frauen und den Weltfrauentag am 8. März.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Warum hat ein Krankenhausaufenthalt das Zahnputzverhalten eines Mannes verändert? Und was hat das mit Energiesparen zu tun? Und wie viel Energie könnten wir in Graz eigentlich sparen, wenn wir alle Geräte, die im Standby-Modus laufen, ausschalten würden? Die Antworten gibt es in dieser Folge von unserem Graz Geflüster Podcast zum Thema Energiesparen. Mein Name ist Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast ist wieder Werner Prutsch.
Werner Prutsch:
Mein Name ist Werner Prutsch, ich bin der Leiter des Umweltamtes der Stadt Graz.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Wie können wir Energie sparen? Das haben wir in den letzten Folgen schon ausführlich erklärt. Und vielleicht als kleine Zusammenfassung, lieber Werner Prutsch, eine kleine persönliche Geschichte von Ihnen selber, dass man wirklich einmal zeigen kann, spart man jetzt wirklich Energie und wo haut man sie dann aus dem Fenster raus? Bitte!
Werner Prutsch:
Da ist mir eine kleine Episode sehr gut in Erinnerung, die ich erlebt habe, als ich nach einem Unfall einige Tage in einem Krankenhaus verbringen musste und dort mit einem Kollegen mir ein Zweibettzimmer geteilt habe. Man redet dann natürlich in dieser Situation über alle möglichen Dinge des Lebens und nachdem er erfahren hat, in welchem Bereich ich arbeite, hat sich sein Gesicht erhellt und er hat mir ganz freudig erklärt, er ist der größte Energiesparer aller Zeiten und er bemüht sich da extrem und er dreht immer das Licht ab, auch wenn er nur irgendwo ein oder zwei Minuten aus dem Raum geht. Wie die ganze Geschichte sich dann so weiterentwickelt hat, habe ich dann beobachtet, wenn er dann unser kleines Gemeinschaftsbad in diesem Krankenhauszimmer benutzt hat.
Dann habe ich gemerkt, dass er seine Zahnhygiene sehr, sehr ernst nimmt und viele Minuten lang dort verbracht hat und die Zähne geputzt hat und nebenbei immer das Warmwasser gelaufen ist. Er hat keinen Zahnputzbecher benutzt, sondern das Wasser ist ständig gelaufen und wenn man das jetzt wirklich durchrechnet und ich habe ihm das dann erklärt und er war dann schon ein bisschen betroffen, dann spielt eigentlich das, was er so quasi über die Beleuchtung einspart, im Verhältnis zu dem, was er da über das Warmwasser verbraucht, überhaupt keine Rolle. Das heißt, wenn er da zum Beispiel 20, 30 Liter Warmwasser verbraucht und das geht dann in Richtung einer verbrauchten Kilowattstunde, dann kann irgendwo eine Lampe vielleicht 100 Stunden lang brennen. Also das ist dann keine Relation, wenn man da dann kurz irgendwo das Licht abdreht.
Simone Koren-Wallis:
Aber das ist ja schon bezeichnend für ganz viel, weil viele sich denken, Energiespann hat nur mit dem Licht zu tun.
Werner Prutsch:
Genau.
Simone Koren-Wallis:
Und das ist es aber nicht. Also es geht jetzt nicht nur darum, wo schalte ich mein Licht aus. Es ist ja viel, viel mehr. Und wir waren eben schon im Badezimmer, wir waren im Schlafzimmer. Gehen wir kurz ins Wohnzimmer und vielleicht auch ins Büro. Manchmal ist ja das auch ein Zimmer. Was verbraucht mehr Energie, der TV oder der PC?
Werner Prutsch:
Das hängt ja jetzt davon ab, mal wie groß das TV-Gerät ist. Also die berühmte Bildschirmdiagonale, wo man dann ja stolz darauf ist, dass man einen sehr, sehr großen Fernseher hat zum Beispiel, was natürlich seine Vorteile hat und auch sehr beeindruckend sein kann. Das Gerät braucht dann natürlich deutlich mehr Strom. Das startet dann bei kleinen Geräten mit ungefähr 100 Watt Leistung und geht dann in die Höhe bis zu mehreren 100 Watt. Bei den PCs ist es auch sehr stark davon abhängig, wie das Gerät ausgestattet ist und wie man es nutzt. Also wenn man quasi nur Office-Programme verwendet und damit Texte schreibt oder irgendwelche Folien erstellt oder was, dann hält sich da der Stromverbrauch in Grenzen. Wirklich zu beachten ist es dann, wenn das sehr stark aufgerüstete Geräte sind, die man zum Beispiel im Spielebereich braucht. Also wenn da Spiele mit sehr hochauflösender Grafik und schnellen Szenen abfolgen und so verwendet wird, dann geht das extrem in die Rechnerleistung. Und die Leute, die das machen, die kennen das ja auch, wenn der PC dann sehr stark mit Lüftungsgeräten ausgestattet werden muss, weil die Prozessoren so heiß werden, dann weiß man ja auch, wo die Energie hingeht. Also es ist ein Unterschied, ob man sozusagen ein Tablet verwendet und da einen zweiseitigen Brief schreibt oder ob man da irgendein hochauflösendes Spiel verwendet, wo dann die Kühlung für die Prozessoren alleine schon eine technische Herausforderung ist.
Simone Koren-Wallis:
Aber wenn wir jetzt zu einem durchschnittlichen Haushalt in Graz hernehmen, hilft es jetzt einfach nur in den Standby-Modus zu gehen oder ist es da schon vielleicht vorteilhafter, dass ich sage, jetzt schalte ich kurz alles aus?
Werner Prutsch:
Also ich würde, wenn es eine kürzere Pause ist, also wenn ich zum Beispiel irgendwo 20 Minuten weg bin oder was, würde ich da in den Standby-Modus gehen. Die Geräte ständig rauf und runter zu fahren, ist ja dann auch von der technischen Seite her oft nicht wirklich gut. Das muss man ja dann auch berücksichtigen. Wenn sich das dann irgendwo auf die Lebensdauer meines Geräts niederschlägt oder was, dann spart man da ja auch nicht jetzt dann global gesehen Energie, wenn das Gerät zum Beispiel früher kaputt wird oder was. Es ist was anderes, wenn ich länger weg bin, wenn ich sage, ich gehe jetzt zum Beispiel drei Stunden einkaufen oder was, dann schalte ich es natürlich aus. Das ist überhaupt keine Frage. Also das ist dann eine Frage der Abschätzung, ob es jetzt einige Minuten sind oder ob ich stundenlang weg bin.
Simone Koren-Wallis:
Eine sehr wahrscheinlich theoretische Frage, aber wenn man bei uns in Graz alle Geräte, die im Standby-Modus laufen, ausschalten würde, könnte man geschätzt wie viel Energie sparen? Was schätzen Sie?
Werner Prutsch:
Es gibt auch beim Standby eine sehr große Bandbreite. Ich habe selbst einmal gemessen, ein altes Gerät aus den 80er Jahren, das eine Größenordnung von 20 Watt Standby-Verbrauch gehabt hat. Es war auch entsprechend warm. Das ist übrigens ein Tipp, wenn man kein Energie-Messgerät zur Verfügung hat, um diesen Standby-Verbrauch zu messen. Man muss nur einfach das Gerät angreifen. Wenn das Gehäuse warm ist, dann verbraucht es auch im Standby relativ viel Energie. Wenn es eiskalt ist, dann kann es keinen großen Energieverbrauch haben, weil wo soll die Energie hin?
Simone Koren-Wallis:
Das kennen jetzt sicher alle vom Handy. Wenn ich ganz viel am Handy bin und denke, boah, es ist warm, oder?
Werner Prutsch:
Genau, dann kann man auch schauen, wie sich der Akku leert irgendwo. Wenn das Handy auf Normaltemperatur ist, dann wird auch der Akku-Füllstand langsam abnehmen. Bei moderneren Geräten, da gibt es mittlerweile eine sehr gute technische Weiterentwicklung, liegt der Standby-Verbrauch dann irgendwo deutlich unter 2 Watt. Das ist dann nicht mehr so das große Thema. Wir haben in Graz größenordnungsmäßig 180.000 Haushalte. Wenn wir sagen, da laufen in jedem Haushalt im Schnitt drei Standby-Geräte, dann sind wir bei ca. 500.000 Stück. Wenn das im Schnitt zwei Watt sind, dann wäre das eine Million Watt. Na ja, da kommt schon was zusammen. In Summe eine Million Watt werden dann tausend Kilowatt. Das ist ein Megawatt.
Simone Koren-Wallis:
Das sind jetzt alles Bezeichnungen, wo ich mir denke, wie viel ist das? Wie viel verbraucht der Durchschnittshaushalt in Graz an Energie im Jahr? Oder kann man das irgendwie, damit wir das ein bisschen greifbarer machen und sagen, damit die Leute was anfangen können mit diesen Bezeichnungen?
Werner Prutsch:
Es gibt mittlerweile sogar einen amtlich festgestellten Durchschnittsverbrauch, nachdem der Bund den Strompreis deckelt und für diese Strompreisdeckelung ein Durchschnittsverbrauch festgelegt worden ist. Der liegt jetzt in der Größenordnung von 3600 Kilowattstunden im Jahr. Das ist das, was der typische Drei-Personen-Haushalt verbraucht. Die Bandbreite ist aber relativ groß. Das fängt irgendwo in Ein-Personen-Haushalten so um die 1000 Kilowattstunden an und kann dann nach oben natürlich fast unbegrenzt sein. Wenn jemand irgendwo dann in seinem Einfamilienhaus ein beheiztes Hallenbad hat und das vielleicht auch dann noch mit Strom betreibt, mit einer Wärmepumpe zum Beispiel, dann kann der Stromverbrauch im Haushalt natürlich extrem hoch sein. Bei Nachtspeicherheizungen, wenn die Wohnung voll beheizt wird, ich kenne da auch Fälle, die brauchen dann 15.000 bis 20.000 Kilowattstunden oder noch mehr. Wobei da, wer dann natürlich die Heizung mit inbegriffen ist, der hat dann natürlich keine andere Heizung, die sonst extra anzurechnen wäre. Aber vom Stand-by-Verbrauch her, wenn man nochmal auf das zurückkommt und diese eine Million Watt, wenn ich mich da jetzt im Kopf nicht verrechne, das sind 1000 Kilowatt, also das ist ein Megawatt. Vielleicht vergleichen wir es anders. Das wäre, ein Megawatt braucht man eine Solarfläche von ungefähr einem Hektar. Das sind 10.000 Quadratmeter Solarfläche braucht man, wenn am Tag die Sonne scheint, um diese Stand-by-Leistung bereitzustellen. In der Nacht muss es natürlich irgendwo anders herkommen. Also in Summe ist es dann schon wieder irgendwo zu beachten auch. Das ist schon klar.
Simone Koren-Wallis:
Vielleicht kann man das nochmal irgendwie beschreiben oder umschreiben, sagen wir so. Ich kann das so schwer greifen.
Werner Prutsch:
Ja, diese 500.000 Geräte, wenn man von drei Stück je Haushalt in Graz in etwa ausgeht und wenn sie nur 2 Watt Stand-by-Verbrauch aufweisen, dann ist das eine Million Watt, die da gleichzeitig läuft. Das sind 1.000 Kilowatt mal 8.000 Stunden im Jahr gerechnet, sind das 8 Millionen Kilowattstunden, die diese Geräte im Stand-by-Betrieb in einem Jahr verbrauchen. Parallel dazu kann man mit diesen 8 Millionen Kilowattstunden ca. 2.200 Haushalte auch ein Jahr lang versorgen.
Simone Koren-Wallis:
Das ist Wahnsinn, oder? Das klingt jetzt so viel.
Werner Prutsch:
Das ist die Stadt Mureck plus ein bisschen Umgebung.
Simone Koren-Wallis:
Aber kann man vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören und sich denken, aber was ist überhaupt eine Kilowattstunde? Was kann ich mit einer Kilowattstunde überhaupt alles machen?
Werner Prutsch:
Mit einer Kilowattstunde können Sie z.B. eine Energiesparlampe, bei der man von einer Leistung von ca. 10 Watt spricht, die kann man 100 Stunden lang laufen lassen. Sie können damit etwa 20-30 Liter Warmwasser auf Boiler-Temperatur bringen. Sie können ein TV-Gerät mit 100 Watt damit 10 Stunden lang laufen lassen oder einen PC, einen leistungsfähigen mit 150 Watt, können Sie dann etwa 7 Stunden damit betreiben. Das sind so die Relationen, die dabei herauskommen. Oder man kann eben, wenn man das dann in den Verbrauch umrechnet, sie ungefähr 3 Minuten lang duschen.
Simone Koren-Wallis:
Was kostet eigentlich eine Energieberatung? Und ist neu eigentlich immer besser als alt? Also ein Geräten wohlgemerkt. Das alles gibt's in der nächsten Folge.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Hallo und willkommen zum Podcast der Stadt Graz. Weiter geht's heute mit dem Thema Energiesparen. Was bringt es wirklich, wenn ich die Heizung um ein Grad runterdrehe? Und warum zum Beispiel nicht immer die Arbeit oder vielleicht die Kolleg:innen dran schuld sind, wenn ich zum Beispiel in der Arbeit gähnen muss? Mein Name ist Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Werner Prutsch.
Werner Prutsch:
Mein Name ist Werner Prutsch, ich bin der Leiter des Umweltamtes der Stadt Graz.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Lieber Werner Prutsch, wir haben beim letzten Mal auch gesprochen, und da möchte ich jetzt nur kurz einhaken, übers Duschen. Es gibt ja Leute, denen ist kalt, ich kenne solche Leute, die gehen sehr, sehr gut, und die stehen sich dann wirklich sehr, sehr gern in die Dusche und denken sich, oh, da bleibe ich jetzt einfach einmal eine halbe Stunde stehen und lasse mich vom warmen Wasser berieseln. Schlecht, oder?
Werner Prutsch:
Vom Energieverbrauch her ist das natürlich schlecht, das ist keine Frage, außer man hat irgendwie die Möglichkeit, auch sein Warmwasser beispielsweise über eine Solaranlage zu erzeugen. Es hängt jetzt diese Aussage, ob das schlecht ist oder nicht, natürlich auch sehr von der Jahreszeit ab. Also irgendwo im Herbst, wo vielleicht meine Solaranlage noch mein Wasser erwärmt, oder was ist das weniger ein Thema, was man dann natürlich trotzdem im Auge behalten muss, das ist der Wasserverbrauch, das ist ja auch ein eigenes Thema. Aber vom Energieverbrauch her, solange ich das über eine eigene Solaranlage zum Beispiel machen kann, sollte das nicht so das Thema sein.
Aber im Jänner, wo wirklich dann die Energie über fossile Kraftwerke bereitgestellt wird, also die mit fossiler Energie betrieben werden, also sollte man, wenn man hier seinen Beitrag leisten möchte, sich das schon überlegen, ob man das öfter macht. Ich glaube, wenn man lange irgendwo im Freien, im Kalten gearbeitet hat und dann sich irgendwie aufwärmen möchte, dann bin ich da wirklich der Allerletzte, der nicht Verständnis dafür hat. Also ich bin auch eher so von der Hälfte der Menschheit, der es lieber warm hat als zu kalt. Aber es muss einem natürlich dann schon bewusst sein, was man damit auslöst irgendwie. Also man wird jetzt die Welt nicht ins Unglück stürzen, wenn man einmal heiß duscht. Wenn man das zweimal am Tag und das jeden Tag macht, dann kann es natürlich schon irgendwo ein großes Thema werden. Also dann hat man sicher einen ökologischen Fußabdruck, der viel, viel größer ist, als das bei anderen Leuten ist. Und dann sollte man sich im Interesse, wie sich die Welt weiterentwickelt, schon seine Gewohnheiten überlegen. Also das muss man dann schon Nahe legen.
Simone Koren-Wallis:
Aber vielleicht können wir gleich da die Frage dann einwerfen, in welchem Bereich lässt sich in einem Privathaushalt wirklich jetzt besonders viel Energie sparen? Ist es wirklich das Heizen und das Warmwasser, sind es die Elektrogeräte oder ist es die Beleuchtung? Wo kann man wirklich viel sparen?
Werner Prutsch:
Wenn man von einer durchschnittlichen Nutzung dieser Geräte ausgeht. Das heißt, ich habe eben am Abend nur dort Lampen brennen, wo ich mich aufhalte und nicht in allen Räumen gleichzeitig. Wenn ich meinen PC, mein TV-Gerät etc. irgendwo maßvoll nutze über einige Stunden am Abend. Wenn ich eben nur eine überschaubare Zeit mich unter der Dusche aufhalte und so weiter. Dann wird es in erster Linie dieser Wärmebereich sein. Wenn das Verhalten von diesem Durchschnittsverhalten abweicht, dann können natürlich auch andere Dinge sein. Also wenn jemand 20 Stunden am Tag vor einer Spielkonsole sitzt, die eine sehr hohe Leistung hat, dann kann das natürlich schon enorm viel ergeben. Oder es gibt Leute, die stehen in der Früh auf, schalten den Fernseher ein und der läuft dann irgendwo den ganzen Tag durch. Man nimmt eigentlich gar nicht so richtig wahr, was da so an Programm ausgestrahlt wird. Aber er läuft halt irgendwie so als Hintergrundgeräusch und das kann in Summe dann natürlich schon sehr, sehr viel ergeben. Das ist dann immer das Problem dabei. Das ist diese Analyse, die man dann über seine Lebensgewohnheiten darüber legen muss.
Simone Koren-Wallis:
Vielleicht bleiben wir kurz bei der Wärme, weil Sie es jetzt auch gerade angesprochen haben. Man hört es ja überall, Raumtemperatur senken.
Bei uns im Magistrat haben wir auch schon überall jetzt die Thermometer, weil wir ja runter müssen, was ja auch sinnvoll ist. Man hört ja auch ganz, ganz viel in der Werbung von wegen 11% runter. Wie viel sollte man jetzt von der Raumtemperatur wirklich runter und was bringt das? Also was bringt zum Beispiel, wenn ich sage, auf meinen Thermometer, da gehe jetzt ein Grad runter?
Werner Prutsch:
Das ist relativ einfach zu beantworten, wie viel das bringt. Man geht von einer Temperaturdifferenz im Durchschnitt von ungefähr 20 Grad zwischen außen und innen aus. Also wenn es draußen 0 Grad hat und im Raum 20 Grad, dann muss meine Heizung sozusagen diese 20 Grad Temperaturdifferenz abdecken zwischen innen und außen. Das heißt, ein Grad macht bei diesen 20 Grad Differenz ungefähr 5% aus. Natürlich gibt es abweichende Situationen, wenn es im Raum 25 Grad hat. Das ist aber insofern kein Problem, weil es hat ja dann draußen auch nicht immer 0 Grad, sondern halt auch einmal plus 5 Grad. Und im längeren Durchschnitt sind es eben diese circa 20 Grad Differenz.
Und auf 20 Grad bezogen macht ein Grad eben circa 5% aus. Das heißt, wenn ich die Raumtemperatur um ein Grad absenke, zum Beispiel von 21 auf 20 oder von 20 auf 19, dann kann ich davon ausgehen, dass ich damit ungefähr 5% Heizenergie spare.
Simone Koren-Wallis:
Das ist aber ganz schön viel aufs Jahr gesehen.
Werner Prutsch:
Sicher sehr viel. Also überheizte Räume sind nicht nur schlecht irgendwie für die Gesundheit, weil das ja eben die Atemwege austrocknet und so weiter und uns anfällig macht dann für verschiedene Infektionen, sondern natürlich auch vom Energieverbrauch her sehr, sehr ungünstig.
Simone Koren-Wallis:
Aber durchgehend lüften ist auch wieder nicht gut.
Werner Prutsch:
Nein, das sollte man auch nicht machen. Also da gibt es auch eindeutige Empfehlungen, wie ich das Handhaben soll. Aber grundsätzlich lüften ist sehr notwendig und wird in vielen Fällen unterschätzt. Wir haben das auch gesehen, indem wir in vielen Räumen CO2-Messungen gemacht haben. Wir haben den Kohlendioxidgehalt in der Luft von Räumen gemessen, wo sich mehrere Leute aufhalten. Und da gibt es auch sehr eindeutige Richtwerte dafür. Der natürliche Außengehalt in der Luft liegt bei ca. 420 ppm. Das sind Teile auf eine Million, „parts per million". Und wenn sich zwei, drei Leute in einem Raum aufhalten, dann kann das sehr schnell irgendwo über 1000 ppm steigen. Und was damit dann nämlich ausgelöst wird, ist, dass man irgendwie sich müde fühlt, dass man dann bei noch höheren Konzentrationen, Konzentrationsschwächen bekommt. Das kann dann bei hohen Konzentrationen, wenn es über 2000 hinausgeht, dahingehend führen, dass man Kopfschmerzen bekommt. Man darf sich da oft dann wirklich nicht wundern, wenn man dann nachmisst und draufkommt, wie die Situation ist, dass die Leute dann irgendwo müde sind. Das liegt dann vielleicht nicht am vorigen Abend, der vielleicht ein bisschen länger geworden ist, sondern das liegt unter Umständen dann auch am schlechten Lüftungsverhalten. Das heißt, man braucht Frischluft.
Simone Koren-Wallis:
Darf ich da kurz einhaken? Da denke ich jetzt aber gerade an die Schulen und an die Schulklassen. Das heißt, in den Schulklassen ist es ganz besonders wichtig, da immer wieder das Fenster aufzureißen, weil da sitzen jetzt ganz, ganz viele Kinder und dann liegt es nicht immer am Lehrer, dass die Kinder müde werden, sondern auch an der Frischluft.
Werner Prutsch:
Genau, genau, das ist absolut richtig. Wir haben auch in Schulklassen gemessen und wenn sich da jetzt zum Beispiel 20 oder 25 Kinder plus Lehrpersonen in einem Raum befinden und da haben wir dann leider den Effekt auch, dass gerade moderne Gebäude, die sehr gut abgedichtet sind, dass die dann in Richtung CO2-Konzentration eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit benötigen. Früher einmal, wenn man so an meine Schulzeit zurückdenkt und da irgendwelche sehr, sehr alten Holzfenster eingebaut waren, da hat man ja fast mit dem kleinen Finger irgendwo durch das geschlossene Fenster greifen können. Also dort war irgendwo das Lüftungsthema nicht wirklich ein Thema. Da hat es ausreichend Frischluft gegeben, von der energietechnischen Seite her sehr schlecht. In vielen modernen Gebäuden sind wir da jetzt ein bisschen auf das andere Extrem verfallen. Das ist eben jetzt sehr gut abgedichtet, hat einen niedrigen Energieverbrauch, aber erkauft sich das dann durch eine hohe CO2-Konzentration. Das heißt, wie kommt man aus dem Dilemma jetzt heraus, was kann man machen? Empfohlen wird eben in relativ kurzen Zeitabständen Stoß zu lüften. Das heißt, man macht die Fenster wirklich komplett auf, also die Fenster nicht kippen, sondern komplett öffnen, wenn es möglich ist auch die Türen dazu öffnen, dass es einmal kurz einige Minuten durchzieht, dass die Luft im Raum ausgetauscht wird und dann wieder zumachen. Was man nicht machen sollte, ist über Stunden oder den ganzen Tag das Fenster gekippt zu halten. Das kühlt dann die Gegenstände im Raum sehr stark aus und ist eben für den Energieverbrauch sehr schlecht und bringt eigentlich nicht sehr viel Vorteil dann, was die CO2-Konzentration betrifft.
Simone Koren-Wallis:
Eine private Frage, ich schlafe bei gekippten Fenstern, ist das jetzt auch energieeffizienzmäßig? Ja, schlecht?
Werner Prutsch:
Das kommt darauf an, wie Sie den Raum beheizen. Es gibt sehr viele Leute, die durchaus gerne in kalten Räumen schlafen, also die dann auch die Heizung abdrehen und dann das Fenster kippen. Dann muss man nur irgendwo wieder aufpassen, dass man nicht irgendwo in den Ecken Schimmelbildung bekommt, weil natürlich auch immer in einem Raum dann entsprechende Raumfeuchtigkeit vorhanden ist. Und wenn der Raum an sich sehr weit auskühlt, dann muss man da immer aufpassen, dass dann nicht irgendwo an diesen kalten Stellen sich Kondenswasser bildet. Und das ist dann natürlich ein sehr guter Nährboden für Schimmelbildung. Und das ist dann ganz, ganz schlecht. Also wenn jemand irgendwo im Raum Schimmelbildung haben sollte, bitte das unbedingt beachten. Da werden dann Schimmelsporen freigesetzt, die gesundheitlich dann wirklich sehr, sehr negative Auswirkungen haben können.
Simone Koren-Wallis:
Aber vom Lüften her, wenn ich jetzt wirklich stoßlüfte, ich habe einmal irgendwo gelesen, man soll so lange lüften, bis das Fenster nicht mehr beschlagen ist. Stimmt diese Regel ungefähr oder ist das ein Humbug?
Werner Prutsch:
Das kann man sicher beachten. Weil solange sozusagen verbrauchte, unter Anführungszeichen verbrauchte Luft im Raum noch vorhanden ist, hat die natürlich auch einen höheren Feuchtigkeitsgehalt. Und wenn man das Fenster öffnet und die strömt dann raus, dann wird sich da eben Kondenswasser am Fenster bilden. Das heißt, das sieht man. Und wenn dann im Raum weitgehend schon frische, kalte Luft von draußen vorhanden ist, dann wird das Fenster nicht mehr beschlagen. Also das hat schon auch einen fachlich erklärbaren Hintergrund.
Simone Koren-Wallis:
In dieser Folge waren wir im Badezimmer, im Schlafzimmer, ein bisschen in der Küche.
Das nächste Mal gehen wir ins Büro und auch ins Wohnzimmer und wo wir dort am besten sparen können.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Willkommen zum neuen Podcast der Stadt Graz. Kleines Quiz für euch: Welches Gerät ist eigentlich der größte Stromfresser? Der Gefrierschrank, die Waschmaschine, der Elektroherd oder der Geschirrspüler? Die Antwort gibt es in dieser Folge, in der es wieder um Energiesparen geht. Mein Name ist Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast ist Werner Prutsch.
Werner Prutsch:
Mein Name ist Werner Prutsch. Ich bin der Leiter des Umweltamtes der Stadt Graz.
Jingle
Simone Koren-Wallis:
Das ist die zweite Folge des neuen Stadt Graz Podcasts und es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim letzten Mal haben wir die Frage geklärt, warum sollte jede Grazer:in da ihren Teil dazu beitragen? Und das mit dem Beitragen ist, glaube ich, schon heute unser Thema, lieber Werner Prutsch. Und zwar ist es die Frage, wie, was können wir tun? Was ist das Einfachste? Was kann ich jetzt sofort tun als Simone, damit ich jetzt Energie spare?
Werner Prutsch:
In unserer konkreten Lebenssituation Energie zu sparen, gibt es folgende Punkte, die man da besonders beachten kann. Das ist einmal in erster Linie die Mobilität. Also wie wickele ich so quasi meine täglichen notwendigen Wege ab?
Simone Koren-Wallis:
Ich darf nicht mehr mit dem Auto fahren, quasi. Das will ich so nicht formulieren.
Werner Prutsch:
Also nicht mit dem Auto fahren, aber doch bewusster das Ganze zu verwenden. Also es ist sicher nicht so, dass alle Wege, die derzeit mit dem Auto zurückgelegt werden, auch wirklich nur mit dem Auto zurückgelegt werden können. Es ist eben ein Unterschied, ob ich irgendwo am Vormittag, wo ich eine sehr gute ÖV-Versorgung habe, von A nach B muss, ohne dass ich vielleicht sehr schwere Gegenstände irgendwo transportieren muss. Oder ob ich irgendwo sozusagen den Jahreseinkauf erledige oder für die Renovierung meiner Wohnung in den Baumarkt fahre und dort irgendwo 200 Kilo Material einkaufe. Also da wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein Automobil in der einen oder anderen Form, wie immer das dann technisch funktioniert, ob das dann elektrisch ist oder mit etwas anderem betrieben wird, das werde ich brauchen. Aber es gibt auf jeden Fall ein großes Potenzial, die derzeit gefahrenen Kilometer sehr stark zu reduzieren und auf andere Mobilitätsformen zu verlegen. Also in erster Linie eben zu Fuß zu gehen, das Fahrrad zu nützen oder eben auch mit dem ÖV zu fahren.
Simone Koren-Wallis:
Der öffentliche Verkehr ist ja in Graz auch sehr, sehr gut ausgebaut. Das heißt, ich komme wirklich auch sehr, sehr leicht von A nach B. Aber hilft es eigentlich auch, dass ich sage, ich mache irgendwie so Fahrergruppen, ich schaue, dass ich jemanden mitnehme aus meiner Siedlung, aus meinem Haus, aus meiner Umgebung und sage, okay, du musst ja auch in die Richtung. Hilft das schon?
Werner Prutsch:
Das hilft natürlich auch. Also für Wege, die regelmäßig zurückgelegt werden, sind solche Mitfahrgemeinschaften natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also wenn man irgendwo vergleichbare Arbeitswege hat, dann ist es sicher eine ganz gute Geschichte. Eben fachlich spricht man dann davon, den Besetzungsgrad der Fahrzeuge zu steigern. Und das ist eben auch ein großes Problem. Nicht nur, dass zu viele Autos unterwegs sind, sondern dass in den allermeisten Autos auch nur eine Person drinnen sitzt. Das heißt, wenn es da gelingt, irgendwo Fahrgemeinschaften verstärkt zu organisieren, dann nützt das natürlich auch sehr stark. Wobei man da natürlich immer sehen muss, die gesellschaftlichen Tendenzen in der Arbeitswelt und die Flexibilisierung der Arbeitszeit, die uns ja allen irgendwo sehr zugutekommt und so, die ist in der Richtung natürlich nicht sehr förderlich. Wenn Leute zwar in einer Firma arbeiten, aber der eine arbeitet bis 14 Uhr, der nächste bis 15 Uhr und der nächste bis 16 Uhr, dann ist das für Fahrgemeinschaften natürlich nicht sehr hilfreich. Also da gibt es eben auch Tendenzen, die eben diesen sinnvollen Ansätzen leider etwas entgegenlaufen.
Simone Koren-Wallis:
Aber Homeoffice war dann gar nicht so schlecht, oder? Also, dass man dieses Homeoffice zu Corona-Zeiten dann in vielen Firmen eingeführt hat.
Werner Prutsch:
Homeoffice hat die zurückgelegten Wege sicher sehr reduziert. Man muss nur bei einem Effekt auch aufpassen bei Homeoffice. Leute, die früher fünf Tage in der Woche ins Büro gefahren sind, die haben sich natürlich auch eine entsprechende Zeit- oder Dauerkarte gekauft, haben beispielsweise eben eine Jahreskarte gehabt. Wenn jetzt jemand eine sehr umfangreiche Homeoffice-Regelung hat und beispielsweise nur mehr einen Tag ins Büro muss, dann überlegt er sich das schon. Auch wenn die ÖV-Karten teilweise wirklich sehr, sehr preisgünstig sind, höre ich immer wieder von Leuten, die sich dann doch überlegen, dann für diesen einen oder maximal zwei Tage eine Karte zu kaufen, weil diesen einen Tag, den fahren sie dann mit dem Ausdruck. Genau, das ist dann eh schon egal. Und der Effekt, der dann herauskommt, ist, dass der früher fünf Tage mit dem ÖV gefahren ist und eigentlich nie mit dem Auto und jetzt fährt er einen Tag mit dem Auto. Also hat sich dann eigentlich mit der Homeoffice-Variante nicht verbessert. Aber es hat natürlich schon ein Potenzial, wenn man es eben richtig einsetzt und vernünftig betreibt, die ganze Geschichte. Dann hat Homeoffice natürlich ein Potenzial, auch beim Verkehr Energie einzusparen.
Simone Koren-Wallis:
Vielleicht gehen wir kurz von diesem Homeoffice eben zu Hause. Ich habe mein Büro zu Hause und ich habe den Haushalt zu Hause. Wenn ich dann daheim bin und vielleicht auch arbeite, mache ich da noch viele andere Sachen zu Hause. Und vielleicht, dass wir da ein kleines Quiz für alle, die jetzt zuhören. Was sind denn die größten Stromfresser? Wo verschleudern wir ganz, ganz besonders viel Energie? Was glaubt ihr? Ist es der Gefrierschrank, ist es die Waschmaschine, der Elektroherd oder der Geschirrspüler? Ich hätte sofort eine Tendenz gehabt, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie richtig ist. Ist es der Gefrierschrank?
Werner Prutsch:
Der Gefrierschrank wird es in den allermeisten Fällen nicht sein, sondern in den allermeisten Haushalten ist es die Nutzung von Wärme. Das hängt natürlich immer sehr von den Lebensgewohnheiten ab. Also wenn Sie 90 Prozent der Zeit außer Haus essen und den Elektroherd eigentlich nur sporadisch benutzen, dann wird der nicht der große Energieverbrauchstreiber sein. Wenn man Kochen als Hobby hat und da viel Zeit damit verbringt, dann kann das natürlich dann schon sehr viel an Stromverbrauch irgendwo bewirken. Die Geräte, die Sie jetzt gerade genannt haben, Waschmaschine, Geschirrspüler, Elektroherd, da ist man beispielsweise, wenn man eine Waschmaschine einmal laufen lässt, gleich einmal in einer Größenordnung von ungefähr 2 Kilowattstunden Verbrauch, die die Waschmaschine für einen Waschgang benötigt. Im Vergleich dazu kann man eine Energiesparlampe, die grob eine Leistung von 10 Watt hat, damit 200 Stunden lang laufen lassen. Daraus kommt eben sozusagen ein großer Mythos in der Bevölkerung, wo die Leute immer wieder ihre Energiesparaktivitäten auf die Beleuchtung fokussieren. Das ist natürlich dann ein Thema, wenn jemand am Abend in allen seinen Räumen das Licht einschaltet, auch wenn er sich darin nicht aufhält und es brennen dann in der Wohnung 20 Lampen und das dann sieben Stunden am Abend, dann spielt das natürlich auch eine Rolle. Wenn man das normal nutzt, das heißt, dass man irgendwo so zwei, drei Lampen gleichzeitig in Betrieb hat, dann macht die Beleuchtung eigentlich nicht das große Thema, sondern wie gesagt überall dort, wo Wärme im Spiel ist. Das ist dann, das ist die Waschmaschine, das ist der Geschirrspüler. Wenn diese Geräte nicht voll eingeräumt werden, sondern quasi nur teilweise genutzt werden und oft laufen, dann kann das sehr, sehr groß in den Stromverbrauch gehen. Und was natürlich auch eine große Rolle spielt, das ist der persönliche Warmwasserverbrauch. Das ist ein altbekanntes Beispiel, dass man mit Vollbädern, die circa 150 Liter Wasser brauchen, eigentlich sehr sparsam sein sollte. Und natürlich aber auch, wenn man sich dann ersatzweise duscht, die Zeit da insgesamt eine sehr große Rolle spielt. Man kann in zwei Minuten duschen, 20 Liter Wasser verbrauchen und das kann dann eine Kilowattstunde kosten. Im Vergleich jetzt wieder mit der Energiesparlampe sind das 100 Stunden Betrieb der Lampe, was man in zwei Minuten duschen an Energie verbraten kann. Also ich stelle immer wieder fest in der Praxis, Leute möchten ja durchaus Energie sparen, aber es liegt da sehr häufig irgendwo so quasi dann am Wissen, wo mache ich das dann richtig. Das heißt, sie bemühen sich oft irgendwo bei Dingen, die dann aber letztendlich nicht so wirklich den Erfolg bringen. Überall, wo viel Hitze in der Wohnung auch mit vorhanden ist, und das ist natürlich auch ein Gerät wie Geschirrspüler oder Waschmaschine, dort sollte ich zuerst ansetzen. Oder was so ganz heimliche, stille und leise Energieverbraucher sind, das sind die berühmten Untertischboiler, die in vielen Wohnungen gerne verbaut worden sind, wo man dann einen Heißwasseraufbereiter irgendwo in der Küche unterhalb der Abwasch montiert hat, der 24 Stunden am Tag eingeschaltet ist und dort Warmwasser bereit hält, nur weil man vielleicht dann irgendwo einmal zwei Minuten da seine drei Kaffeehäferln damit abspült. Und das braucht dann im Verhältnis sehr, sehr viel Energie für einen sehr geringen Nutzen eigentlich. Also es gibt schon sehr viel Potenzial, aber man muss dann schon ein bisschen schauen und analysieren, wo man richtig ansetzt.
Simone Koren-Wallis:
Jetzt brauchen wir aber definitive Antworten. Also wo verschleudert man ganz besonders viel Energie? Ist es jetzt der Gefrierschrank, die Waschmaschine, der Elektroherd oder der Geschirrspüler?
Werner Prutsch:
Also ich hätte in den allermeisten Fällen jetzt in der Reihenfolge die Waschmaschine hergenommen, weil die sehr stark verwendet wird und auch bei höheren Temperaturen sehr viel Strom verbraucht. Aber wie gesagt, es hängt von den Lebensgewohnheiten ab. Wenn jemand Hobbykoch ist und fünf Stunden am Tag am Herd steht, dann wird es eindeutig der Elektroherd sein. Wenn jemand seine warmen Speisen in den Gefrierschrank stellt, um sie dort abzukühlen, dann darf man natürlich auch den Gefrierschrank nicht unterschätzen. Oder wenn er auch vielleicht technisch nicht mehr so ganz im Stand ist, also, dass zum Beispiel die Dichtung nicht mehr in Ordnung ist und da ständig warme Luft irgendwo in den Kühlschrank hineinkommt, dann kann der natürlich auch in den Dauerlauf gehen und sehr viel Strom verbrauchen. Also eine wirklich generelle Antwort dazu ist sehr, sehr schwierig. Sonst würde es keine Leute geben, die sich speziell mit Energieberatung beschäftigen und die genau wissen, wenn sie in einen Haushalt kommen, welche Testfragen müssen sie dort sozusagen stellen, um herauszufinden, was dort die Ursache ist. Der Standardfall ist ja, Leute melden sich, weil sie eine sehr hohe Stromrechnung haben. Dann schaut man sich die Rechnung an und dann ist der Stromverbrauch vielleicht das Doppelte oder Dreifache von dem, was in Österreich so in etwa der Schnitt ist. Und dann fängt man mit diesen Testfragen an und schaut irgendwo, wie die Lebensgewohnheiten ausschauen, um herauszufinden, was es ist. Also es gibt ja angeblich Leute, die eine Waschmaschine starten mit einem Badetuch drinnen. Das kann natürlich dann irgendwo auf der Stromrechnung ganz böse enden.
Simone Koren-Wallis:
Ich überlege mir jetzt gerade, ob ich meine Bolognesesauce das nächste Mal wieder zwei Stunden köcheln lasse oder nicht. Also zwei Stunden Sauce Bolognese - wird mir zum Verhängnis?
Werner Prutsch:
Genau, es gibt da ja jetzt so sehr viele Leute, die sich ein bisschen lustig machen über die Energiespartipps, die unterwegs sind, die sich da mit dem Kochen auseinandersetzen. Also der berühmte Satz, den Deckel auf den Kochtopf zu geben. Wenn ich nur ganz kurz einmal irgendwo etwas heiß mache oder was, dann wird es im Jahresverbrauch nicht durchschlagen. Aber wie gesagt, wenn ich viel koche, macht das natürlich schon einen Unterschied, ob alles jetzt mit dem Deckel am Herd steht oder ohne Deckel am Herd steht. Also das darf man dann nicht unterschätzen irgendwo. Also das macht dann sicher mehr aus, als ob ich jetzt irgendwo am Gang drei Minuten das Licht drinnen lasse oder nicht. Nur das ist den meisten Leuten nicht so bewusst. Es wird Licht erfahrungsgemäß mehr mit Energieverbrauch identifiziert, als es die Wärmedinge sind.
Simone Koren-Wallis:
Bringt es wirklich was, wenn ich die Heizung um ein Grad runterdrehe? Was das ausmacht und wie wir auch richtig lüften, das gibt es in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir hören uns.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Folge 1: Energiesparen: Warum überhaupt?
Los geht's mit unserem Grazgeflüster-Podcast zum Thema "Energiesparen": warum es wichtig ist, dass jeder von uns seinen Teil dazu beitragen sollte, was passieren würde, wenn wir es nicht tun und was Menschen mit grünen Augen mehr oder weniger damit zu tun haben. Das alles gibt's in dieser Folge mit dem Abteilungsleiter des Umweltamtes: Werner Prutsch.
Intro/Simone Koren-Wallis:
Willkommen zum neuen Podcast der Stadt Graz. Heute geht es um Energiesparen.
Warum es wichtig ist, dass jeder von uns seinen Teil dazu beitragen sollte. Was passieren würde, wenn wir es nicht tun und was Menschen mit grünen Augen mehr oder weniger damit zu tun haben. Mein Name: Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation.
Mein Gast: Werner Prutsch.
Jingle
Werner Prutsch:
Mein Name ist Werner Prutsch. Ich bin der Leiter des Umweltamtes der Stadt Graz.
Simone Koren-Wallis:
Hallo und es freut mich sehr, dass die Stadt Graz ab sofort auch hörbar ist mit einem eigenen Podcast. Wir liefern euch so Informationen aus dem Magistrat, den Abteilungen und den Ämtern, geben hilfreiche Tipps und erzählen Geschichten aus der schönsten Stadt der Welt, nämlich Graz. Und heute starten wir mit einem sehr, sehr aktuellen Thema.
Beschäftigt uns, glaube ich, alle. Energiesparen. Man sieht's überall, überall steht Raumtemperatur bitte senken, kochen nur mit Deckel, und vieles, vieles mehr - und die große Frage: Lieber Werner Prutsch, wie würden Sie einer 10-jährigen Grazerin erklären, warum sie Energie sparen soll?
Werner Prutsch:
Weil eine 10-jährige Grazerin noch ihr ganzes Leben vor sich hat.
Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, die Welt auch so zu erhalten, dass sie lebenswert ist. Und da ist eben ein ganz, ganz wichtiger Teil davon, wie wir mit unseren Energieressourcen umgehen. Ob wir ausreichend und vernünftig zur Verfügung gestellte Energie auch in den nächsten Jahren zur Verfügung haben.
Und wenn man das insgesamt sich anschaut, dann ist es eben notwendig, das Energiesystem noch weiter zu transformieren. Das Thema ist ja nicht neu. Es wurde vor Jahrzehnten ja schon begonnen, sich von fossilen Energien wegzubewegen und wegzuentwickeln.
Als Stichwort fällt mir da immer das Jahr 1973 ein, wo es die große erste Ölkrise gegeben hat. Wo die Politik und Gesellschaft gemeint haben, ja, das muss jetzt alles ganz, ganz schnell stattfinden. In Wirklichkeit ist es dann nicht so schnell gegangen, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte.
Wir haben bis jetzt ungefähr ein Drittel der fossilen Energie haben wir ersetzt. Was für die letzten 50 Jahre eine sehr große Aufgabe war, aber eben bei Weitem keine ausreichende. Das heißt, wenn jetzt das Mädchen mit zehn Jahren auch in den nächsten Jahrzehnten hier gute Lebensqualität vorfinden will, dann müssen wir diesen Vorgang wirklich beschleunigen und uns schneller bemühen, hier von den fossilen Energien wegzukommen.
Simone Koren-Wallis:
Ist das schon jedem bewusst?
Werner Prutsch:
Ich glaube schon, dass es den allermeisten Leuten bewusst ist, dass hier eine Änderung notwendig ist. Was glaube ich in sehr vielen Fällen noch nicht ganz angekommen ist, das ist die Wichtigkeit des eigenen Beitrages. Also sehr viele Leute glauben leider noch immer diesen verschiedenen Berechnungen, die es da in dem Bereich gibt, dass man sagt, na ja, Staaten wie China oder die USA oder andere, die machen eigentlich die größten Anteile. Nur man muss es, wenn man es wirklich vernünftig betrachtet, auf die einzelne Person herunterbrechen. Und da sind wir natürlich schon irgendwo mit unserem Lebensstandard und unserer Lebensweise irgendwo ganz vorne mit dabei. Das heißt, wenn so man den typischen Chinesen mit dem typischen Österreicher vergleicht, dann sind die Treibhausgasemissionen eines Österreichers deutlich höher als eines Chinesen. Und wenn man dann weiter berücksichtigt, dass in China ja sehr viele Emissionen dadurch entstehen, dass für uns dort Güter produziert werden, die wir dann verbrauchen, wenn man das alles noch irgendwo mitberücksichtigt und einberechnet, dann geht die Bilanz nicht wirklich zu Gunsten von uns aus, sondern wir müssen uns da wirklich ganz stark selbst bemühen, die Situation zu ändern.
Simone Koren-Wallis:
Ich höre das nämlich ganz oft auch in meinem Umkreis, so in der Richtung, was sollten denn wir da jetzt anfangen, Energie zu sparen? Sollen einmal die Amerikaner, sollen einmal die, wenn die nicht mitmachen, was bringt das, wenn ein Grazer eine Grazerin da jetzt startet? Aber genau das ist es eben nicht.
Werner Prutsch:
Man kann da sehr viele Beispiele dafür bringen, um sich ins Bewusstsein zu führen, warum die Überlegung eigentlich schon eine andere sein muss. Ich stelle bei Veranstaltungen zum Beispiel immer wieder die Frage, wie viele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern grüne Augen haben. Statistisch ist das in der Weltbevölkerung ungefähr 2 bis 4 Prozent und das funktioniert auch ganz super. Also wenn mehr als 20, 30 Leute beisammen sind, dann passt diese Quote auch ganz gut - habe ich vor circa zwei Wochen wieder getestet. Es zeigen dann ungefähr 3 Prozent der Leute auf und die Aussage ist dann, naja, die brauchen eigentlich bei diesen ganzen Bemühungen nicht mitmachen, weil sie sind ja nur 3 Prozent. Das heißt, sie brauchen sich ja eigentlich da keine Gedanken darüber machen, weil sie so einen kleinen Teil der Weltbevölkerung darstellen. Das heißt einmal die 97 Prozent der Braun- und Blauäugigen sollten einmal was unternehmen. Ich glaube, dass das ein relativ einfaches Beispiel ist, um irgendwie ein bisschen die Absurdität dieser Überlegung zu zeigen, beziehungsweise man kann das fortsetzen. Beispielsweise bemüht sich ja die Region Katalonien in Spanien ja schon seit vielen Jahren mehr Unabhängigkeit zu bekommen. Würde das jetzt zum Beispiel wirklich passieren, dass Katalonien von Spanien unabhängig wird, haben die dann ihre Treibhausgasgeschichte damit in den Griff bekommen, weil dann bleibt Barcelona irgendwie mit der Umgebung übrig und natürlich sind dort die Emissionen dann viel, viel geringer, als das in Spanien insgesamt ist. Oder als sich die Tschechoslowakei aufgelöst hat in die Slowakei und Tschechien, sind beide Länder damit dann irgendwie saniert, weil in etwa haben sie ihre Emissionen halbiert dann jeweils. Was ich damit sagen will, das ist so quasi, man kann das nicht irgendwie an einer sogenannten Bilanzgrenze festhalten.
Das könnte ich ja beliebig fortsetzen. Ich könnte ein Wohnhaus hernehmen, das von auswärts mit Strom und Fernwärme versorgt wird, wo die Leute irgendwo in drei Kilometer Entfernung tanken, ihre Lebensmittel kommen aus einem sehr großen Umkreis, die Kleidung kommt von irgendwo her, diese Wohnsiedlung hat eigentlich null Emissionen. Also die sind überhaupt nicht dabei bei der ganzen Geschichte.
Also es ist nur eine Frage einer willkürlich gezogenen Grenze, wie viele Leute dann in diesem Bereich anzusprechen sind und wie viel dort an Emissionen auftritt. Das heißt, wenn man es wirklich vernünftig betrachten will, dann muss man immer auf die Einzelpersonen herunterbrechen. Und wie gesagt, da sind wir in den westlichen Staaten natürlich schon ganz, ganz vorne mit dabei und es macht keinen Sinn, das Thema dann irgendwo auf größere Länder mit größerer Bevölkerungszahl abzuschieben.
Simone Koren-Wallis:
Wenn wir jetzt das ganz, ganz hart ausdrücken, was würde passieren, wenn wir nicht Energie sparen?
Werner Prutsch:
Es sind ja zwei Dinge, es geht ums Energiesparen und es geht um die Änderung der Aufbringung. Wobei das eine ohne das andere da jetzt nicht machbar ist. Was alle Berechnungen zeigen, ist, dass sozusagen der momentane Level oder das momentane Niveau, mit dem Energie verbraucht wird, dass das nur sehr, sehr schwer auf Alternativenergie umgestellt werden kann.
Es gibt zwar immer wieder Leute, die sagen, das sei alles kein Problem. Es gibt auch die verschiedensten Berechnungen, welcher wirklich kleine Bruchteil der Sonnenenergie, die auf die Erde eingestrahlt wird, schon ausreichen würde, die ganze Menschheit mit Energie zu versorgen. Das klingt theoretisch irgendwie sehr, sehr, sehr einfach und plausibel, ist in der praktischen Umsetzung dann aber so nicht machbar.
Wenn man es dann sozusagen nicht top-down, sondern bottom-up, von unten her betrachtet, von der einzelnen Situation weg, dann kommt man sehr schnell zur Schlussfolgerung, dass man die Flächen, die man irgendwo dann braucht, lokal nicht zur Verfügung hat. Also wir haben das ja an den verschiedensten Beispielen für eine Stadt wie Graz schon durchexerziert. Die letzten, die das sehr plakativ gemacht haben, das ist unser Stadtrechnungshof in der Stadt Graz, der eine Karte dargestellt hat, welcher Anteil des Stadtgebietes hier zum Beispiel mit Photovoltaikflächen belegt werden müsste.
Und das sind ungefähr 20 Quadratkilometer. Das ist schon fast ein Fünftel des gesamten Stadtgebietes, das man für Photovoltaikflächen nützen müsste. Was will ich damit sagen? Wenn ich es nicht schaffe, den Energieverbrauch zu reduzieren, dann werden extrem große Flächen notwendig sein.
Und es gibt das Stichwort in der Energiediskussion, das nennt sich Peak Oil, also sozusagen wann uns irgendwo die Erdölvorräte ausgehen werden. Und man muss da jetzt sehr aufpassen in dieser ganzen Geschichte, dass nicht Peak Oil durch Peak Soil ersetzt wird, was heißen soll, dass wir uns einfach die Flächen nicht leisten können. Also zumindest nicht dort, wo wir sie brauchen.
Es gibt natürlich schon sehr weit gefasste Projekte, dass man sagt, naja, ein gewisser Prozentsatz der Wüste Sahara würde ausreichen, mit Solaranlagen bestückt, ganz Westeuropa mit Energie zu versorgen. Nur bis jetzt sind diese Projekte alle an der praktischen Umsetzbarkeit gescheitert. Wir wissen alle, welches Problem es in Staaten gibt, die politisch instabil sind, wo man jetzt schon jahrzehntelang keine gesicherte Ölversorgung hat.
Und es macht keinen Sinn, die nicht gesicherte Ölversorgung durch die nicht gesicherte Solarversorgung aus diesen Regionen zu ersetzen, weil solche Systeme natürlich auch sehr anfällig sind. Das heißt, wenn man irgendwo in der Sahara eine große Photovoltaikanlage errichtet, dann wird es irgendwo die Stelle geben müssen, wo entweder das Kabel im Mittelmeer verschwindet, das dann irgendwo Richtung Europa geht, oder wo irgendwo ein größeres Wasserstoffterminal errichtet wird, mit dem diese Energie nach Europa transformiert wird. Und diese Punkte sind natürlich extrem anfällig.
Das heißt, wenn dort in diesen Ländern ein Klima herrscht, dass diese Dinge dort nicht gewollt sind, dann ist es auch praktisch nicht umsetzbar. Das heißt, lange Rede kurzer Sinn, wir müssen uns hier von der Versorgung her viel stärker der eigenen Möglichkeiten besinnen. Und die eigenen Möglichkeiten sind halt dann in der Realität nicht so groß, um den aktuellen Energiebedarf zu decken.
Das heißt, um diese Schere zu schließen, muss man auf der einen Seite den Energieverbrauch reduzieren und auf der anderen Seite eben alternativ Energie ausbauen. Wenn beides gelingt, dann wird sich das irgendwo in der Mitte treffen und es wird auch funktionieren.
Simone Koren-Wallis:
Aber wir müssen, also es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen. Jeder von uns muss sparen.
Werner Prutsch:
Alle aus meiner Sicht seriösen Wissenschaftler sagen das.
Es gibt auch Leute, das kann man nicht verhehlen, die verschiedensten Theorien über die Entwicklung des Treibhauseffektes haben, ob es den überhaupt gibt, beziehungsweise ob er menschengemacht ist oder ob er nicht von irgendeinen anderen Faktoren abhängt. Also es gibt da seitenlange Listen, was da alles so in die Diskussion gebracht wird, von den Sonnenfleckenaktivitäten bis zum Abstand von der Sonne, Vulkanaktivitäten und alle möglichen Dinge, die da immer wieder genannt werden. Aber es ist, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte diese Evaluierung des Treibhauseffektes wirklich eines der Themen, das am genauesten durchgerechnet und durchexerziert worden ist.
Es sind mehrere zehntausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Thema beschäftigt und ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass die sich da gravierend irren. Das heißt, wir müssen diese Prognosen ernst nehmen und diese Prognosen schauen, wenn wir nicht rasch handeln, nicht sehr gut aus. Also dann wird sich die Welt in eine Richtung entwickeln, die wir nicht haben möchten und die dann vor allem auch das zehnjährige Mädchen, das wir früher angesprochen haben, nicht haben möchte.
Simone Koren-Wallis:
Was jeder von uns sofort tun kann, um Energie zu sparen, am Beispiel Auto- und Fahrgemeinschaften und alles zu den Stromfressern schlechthin, das hört ihr in der nächsten Folge.
Jingle Graz, die Stadt meines Lebens.
Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.