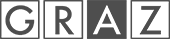Aus der Jänner-BIG: Diplomat und Osteuropa-Experte Wolfgang Petritsch im Gespräch über eine Politik des Gegeneinanders, das Gefühl der Mitbestimmung, die Macht des Wortes und die Notwendigkeit, über Fakten Bescheid zu wissen.
Diplomat und Osteuropa-Experte Wolfgang Petritsch im Gespräch über eine Politik des Gegeneinanders, das Gefühl der Mitbestimmung, die Macht des Wortes und die Notwendigkeit, über Fakten Bescheid zu wissen.
Das Bild des Diplomaten ist oft von Hollywood geprägt, war das auch in Ihrer Kindheit präsent?
PETRITSCH: Nein, ich komme aus Glainach/Glinje in Südkärnten. Ich bin dort in die einklassige, aber zweisprachige Volksschule gegangen. Im Dorf mit mehr als einem Dutzend Bauernhöfen, Keuschen, der Kirche mit Friedhof, Schule und dem Gasthaus meiner Mutter. In dieser Welt war in meiner Kindheit Slowenisch die Umgangssprache. Wir Kinder haben mühelos von einer Sprache in die andere gewechselt. Mit den Älteren haben wir Slowenisch gesprochen, bei den Jüngeren wars dann bereits mehr Deutsch. Dann bin ich in die Hauptschule gegangen und habe erfolgreich die Aufnahmeprüfung zum Werkzeugmacherlehrling in einer eisenverarbeitenden Fabrik in Ferlach gemacht. Irgendein Lehrer hat gesagt: Der Bub ist so gescheit, er soll doch nach Klagenfurt in die Lehrerbildungsanstalt gehen. Dann bin ich eben Volksschullehrer geworden.
Warum sind Sie nicht im Lehrberuf geblieben?
PETRITSCH: Ich war eine Zeit lang Lehrer. Auch in so einem kleinen Dorf, wo mein Direktor der Vater des späteren Burgtheaterdirektors Kušej war. Dann war ich beim Bundesheer und danach - ich war gerade zwanzig - habe ich mir gesagt, das kann doch nicht alles gewesen sein. Freunde von mir sind nach Wien studieren gegangen und ich habe gesagt, da gehe ich mit.
Sie haben Geschichte, Germanistik, Politikwissenschaft und Recht studiert ...
PETRITSCH: Eigentlich wollte ich zurück und Gymnasiallehrer werden. Aber es hat mich in die USA verschlagen mit einem Fulbright-Stipendium. Ich habe in Los Angeles internationale Beziehungen studiert und danach relativ rasch, 1977, bei Bruno Kreisky einen Job bekommen. Ich war der Pressesprecher des Bundeskanzlers bis Ende 1983 und habe dort das Handwerk der Außenpolitik praktisch erlernt. Als Direktor des österreichischen Presse- und Informationsdienstes war ich dann in New York und auch bei der UNO akkreditiert. Später bin ich zurück nach Wien, war eine Zeit lang im Außenministerium, 1997 als Botschafter in Belgrad. Als der Krieg im Kosovo ausbrach, hat die EU jemanden gesucht, der die Vermittlung zwischen Belgrad und Pristina übernimmt. Als europäischer Chefverhandler habe ich gemeinsam mit einem Amerikaner und einem Russen die Friedensverhandlungen in Rambouillet und in Paris geleitet. Der von uns ausgehandelte Vertrag wurde dann ab Juni 1999 umgesetzt. Der Rest ist Geschichte.
Wie ist denn Ihre weitergegangen?
PETRITSCH: Im selben Jahr 1999 wurde ich zum Hohen Repräsentanten der UNO für den Wiederaufbau Bosnien und Herzegowinas bestell. Das Land war wirklich zerstört. Häuser, Wohnungen zerbombt, ebenso Straßen und Brücken. Einfach unvorstellbar, was da nicht funktioniert hat. Im Staat fehlte es an allem, es gab keine funktionierenden öffentlichen Strukturen, keine modernen Gesetze, nichts. Ich habe so um die 1.000 Mitarbeiter gehabt, aus mehr als 30 Nationen. Ein internationales Team an Experten für alle Bereiche. Von Juristen bis zu Verwaltungsbeamten und Wirtschaftsberatern und natürlich Diplomaten mit besonderen Kenntnissen der Region. Dieses Büro des Hohen Repräsentanten funktionierte wie eine Überregierung, eigentlich ein Protektorat. Das war zwar nicht demokratisch, jedoch notwendig, um den Ausbruch neuer Feindseligkeiten zu verhindern. Der internationale Amtsträger ist mit umfangreichen Vollmachten ausgestattet, ich konnte unter anderem Gesetze erlassen (es waren wohl hunderte) und Politiker, die gegen den Friedensvertrag arbeiteten, entlassen. Tatsächlich musste ich über einhundert Politiker (Frauen waren nicht darunter) aus ihren Ämtern entfernen - vom Präsidenten Bosniens über einen Premierminister bis hin zu Bürgermeistern und Stadträten.
Sie mussten eine Menge unpopulärer Entscheidungen treffen. Warum stellt man sich als Politiker in einem Land, das wieder bei null beginnt, gegen positive Veränderung?
PETRITSCH: Weil der Krieg in den Gehirnen und in den Gefühlen, vor allem vieler Politiker, weitergegangen ist. Dieser Ethno-Nationalismus ist als politisches Instrument missbraucht worden. Das merkt man leider heute noch, während die Menschen vom Krieg genug haben. Aber wir erleben es ja selbst in Demokratien, wie schwer es ist, eine kompetente Regierung zusammenzubringen. Das geht oft beim besten Willen nicht. In kriegszerstörten Gesellschaften, wo der Hass, die Trauer über die mehr als 100.000 Toten, die Vertreibung aus der Heimat samt dem immer noch geschürten Konflikt zwischen den Ethnien zusammenkommen, ist das unendlich schwieriger. Rund 80 Prozent der zivilen Opfer waren Muslime. Aber auch Serben und Kroaten waren betroffen. So lebt das Gefühl weiter: Wir sind Opfer. Und das auf allen Seiten. Das macht es eben so schwierig, Frieden und Versöhnung zu schaffen, dass die Menschen sich einander zuwenden und sich die Politik vor allem jenen Aufgaben widmet, die so wichtig sind: Für ein besseres Leben für alle zu sorgen, der Jugend eine gute Ausbildung zu garantieren, den Alten ein sicheres Auskommen. Also all das, wonach sich alle Menschen überall sehen. Das aber ist in Nachkriegsgesellschaften wie jener in Bosnien oder auch im Kosovo immer noch ein Problem. Daher müssen gerade wir weiter mithelfen - es sind schließlich unsere Nachbarn.
Wo waren Sie danach?
PETRITSCH: Als Botschafter für Österreich bei den Vereinten Nationen in Genf, danach noch bei der OECD in Paris.

Diplomatie heute
Wie viele Sprachen sprechen Sie?
PETRITSCH: Englisch ist die lingua franca der Diplomatie, auch Französisch ist immer noch wichtig. Neben Slowenisch verstehe und spreche ich so halbwegs auch die übrigen südslawischen Sprachen, sie sind ja alle ziemlich ähnlich - Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Montenegrinisch. Bei meinen beruflichen Kontakten in Bosnien habe ich gerne meine Sprachkenntnisse ausprobiert. Wenn ich mit den Menschen in den Dörfern und Städten des Landes gesprochen habe, dann habe ich immer wieder scherzhaft gemeint: „Ich weiß jetzt nicht, welche eurer Sprachen ich spreche, aber offensichtlich versteht ihr mich alle." Einfach, um zu zeigen, dass kleine Unterschiede, nicht zu großen hochstilisiert werden sollen. Man muss das Gemeinsame suchen, nicht auf Differenzen insistieren. Diese übertriebene Betonung der Unterschiede hat in Jugoslawien geradewegs in den Krieg geführt. Toleranz, Großzügigkeit sind die Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben. Überall. Wir sehen das jetzt auch, Europa hat sich ja über viele Jahrzehnte - auch und gerade dank amerikanischer Hilfe - wirklich beeindruckend entwickelt. Und jetzt soll das alles in Frage gestellt werden?
Sie haben das auch in Ihrer Festrede anlässlich der Verleihung des Menschenrechtspreises der Stadt Graz erwähnt.
PETRITSCH: Weil ich wirklich daran glaube und davon überzeugt bin. Das Wichtigste ist das gegenseitige Verständnis, der Respekt füreinander. Die Unterschiede, ja, die gibt es. Die sind oft irritierend, aber letzten Endes sind sie bereichernd. Weil man damit die Verschiedenartigkeit der Welt und der Menschen, diesen unglaublichen Reichtum, besser kennenlernt. An Sprachen, an Kulturen, an Essen. Wir sind sofort dabei, Cevapcici oder Falafel zu essen, aber wenn es darum geht, die „anderen" auch zu respektieren, ist es nicht immer so. Dieser große Raum des Balkans, der mentalitätsmäßig weit nach Österreich hereinreicht, hat aufgrund der gemeinsamen Geschichte grundlegende Gemeinsamkeiten. Wie ähnlich, merkt man allein schon an den Speisen. Und wir genießen das. Man muss nicht naiv sein, es gibt klarerweise kulturelle, sprachliche, religiöse Unterschiede, aber das soll ja kein Grund sein, Menschen deshalb zu verdammen.
Angesichts der multiplen Krisen, die es derzeit gibt, wie groß ist der Einsatz von Diplomatie im Hintergrund?
PETRITSCH: Diplomatie spielt derzeit - zum Bedauern für meinen Berufsstand - eine völlig untergeordnete Rolle. Während in Zeiten des Kalten Krieges die Gesprächskanäle stets offen waren, scheint dies zurzeit kaum noch zu funktionieren. Das muss sich gründlich ändern. Europa muss wieder auf zivilisierte Lösungen, auf faire Kompromisse setzen. Das setzt die Rückkehr zur Diplomatie voraus, die sehe ich im Augenblick nicht.
Von multilateralen Verständigungsversuchen hört man derzeit wenig ...
PETRITSCH: Russland, das einen brutalen Krieg gegen die Ukraine führt und jetzt auch noch die Abwendung der USA von ihren eigenen Wertvorstellungen, beide setzen auf krude Großmachtpolitik. Nicht mehr die Stärke des Rechts, sondern das Recht des Stärkeren dominiert die Weltpolitik. Und das ist eine wirklich gefährliche Entwicklung. Damit kann das, was in den letzten 80 Jahren friedlich aufgebaut worden ist - in Europa und in anderen Weltgegenden - wirklich vor die Hunde gehen. Damit unser europäisches Lebensmodell nicht leichtfertig aufgegeben wird, ist der Blick in die Geschichte so wichtig. Europa war über viele Jahrhunderte der Kontinent der Kriege. Der hundertjährige, der dreißigjährige Krieg, der Erste, der Zweite Weltkrieg. Erst nach 1945 hat sich eine aufgeklärte Politik eines Besseren besonnen. Der von den USA finanzierte Marshall-Plan zum Wiederaufbau Europas hat gleichermaßen Sieger und Besiegte eingeschlossen. Eine wichtige Erkenntnis! Jetzt scheint sich eine Politik der Ausgrenzung, des Hasses, des Gegeneinanders breitzumachen. Und das ist gerade für den europäischen Kontinent mit seiner kriegerischen Vergangenheit kein gutes Zeichen.
Wenn man an Russland und die USA denkt - muss man sich auf eine patriarchale Form der Diplomatie einstellen?
PETRITSCH: Wenn man sich anschaut, wie die Großmächte auftreten, von Washington bis Moskau, da kommt mir schon das Grauen. Dieses narzisstische Angeben, dieses Übertreiben und in einem fort Lügen. Das sollen die politischen Vorbilder sein? Das wird leider zu wenig kritisch hinterfragt, ja und der Populismus wird durch die sozialen Medien in alle Köpfe geblasen. Nun, Europa kann ja nur auf der politisch-diplomatischen Ebene überhaupt etwas erreichen. Wir sind keine Militärmacht. Wir haben uns entschlossen, die EU, die europäische Einigung, als Friedensprojekt anzulegen. Und dieses historisch erfolgreiche Projekt - immer noch unvollendet - muss jetzt verteidigt werden. Natürlich ist man als Diplomat automatisch auch Pazifist. Für mich war immer die Macht des Wortes, die Macht der Überzeugung, das Wesentliche, um Frieden zu erhalten oder zu schaffen. Und wenn etwas nicht gelungen ist, habe ich mich immer gefragt: Habe ich nicht die besten Argumente gefunden? War ich zu wenig engagiert oder habe ich mich nicht genügend mit meinem Gegenüber auseinandergesetzt? Die gegenwärtige amerikanische Diplomatie scheint es darauf angelegt zu haben, mit möglichst wenig Kenntnissen auszukommen. Das gerade Gegenteil von dem, wie ich US-Diplomaten erlebt habe. Heutzutage scheint das einzige Argument die militärische Stärke zu sein. Und dem muss wirklich entgegengetreten werden.
Wie kann das gelingen?
PETRITSCH: Es gilt die alte Erkenntnis: Zerstört ist sehr rasch und wieder aufbauen dauert sehr lang. Das heißt, wir müssen, wo immer wir können, dagegenhalten. Wir müssen besonders in Europa schauen, dass wir die demokratischen Institutionen erhalten. Dass wir den Menschen das Gefühl geben, sie können mitbestimmen. Wenn sie den Eindruck gewinnen, sie sind machtlos, dann werden sie destruktiv. Und wählen auch destruktive Politiker.
Das gestaltet sich in einer Gesellschaft schwierig, die viel komplexer ist als früher.
PETRITSCH: Wir leben in einer pluralisierten Gesellschaft, wie die Wiener Philosophin Isolde Charim in ihren Büchern überzeugend argumentiert. Aber gerade deshalb muss die gesellschaftliche Erneuerung auf demokratischer Basis gelingen. Der Wiederaufbau Österreichs nach 1945 hat ja gezeigt, was man erreichen kann, wenn Zusammenarbeit und sozialer Ausgleich gelingen. Vor 100 Jahren war dieses Land Österreich, die Erste Republik, ein gescheiterter Staat. Die 30er-Jahre mit den fortwährenden sozialen Gegensätzen und den Wirtschaftskrisen, dann die Dollfuß/Schuschnigg Diktatur, der „Anschluss" und der Zivilisationsbruch des Zweiten Weltkrieges und der Shoa. Über Generationen wurde nur zerstört. Nach 1945, es grenzt an ein Wunder, hat sich das von Grund auf verändert. Das dürfen wir jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, sondern müssen tatsächlich eine wehrhafte Demokratie entwickeln. Dazu gehört, auf die Grund- und Menschenrechte immer wieder zu insistieren und sie in der Lebensrealität umsetzen.

Bei der Verleihung des Menschenrechtspreises der Stadt Graz haben Sie die Festrede gehalten - welche Bedeutung hat der Preis einer vergleichsweise kleinen Stadt in diesen Zeiten?
PETRITSCH: Die kommunale Ebene - dort wo Menschen einander täglich begegnen - ist für die praktische Anwendung und damit für die Glaubwürdigkeit der Menschenrechte entscheidend und wird immer wichtiger, je mehr die Menschenrechte in Bedrängnis geraten. Zu glauben, wir müssen Grundrechte nur in Österreich verteidigen, ist ein Irrtum. Menschenrechte sind universell. Wir sollten nicht als Oberlehrer auftreten, sondern einander mit Empathie und Respekt begegnen. Das sorgt auch für ein positives menschliches Klima. Was mehr und mehr abhanden kommt in den internationalen Beziehungen wie auch im Kleinen, ist die zwischenmenschliche Solidarität. Das ist das Problem. Wir müssen mitbedenken, wie es anderen geht. Und wir haben als Weltbürger auch ein bisschen mehr als nur eine familiäre oder staatliche Verpflichtung. Man kann nicht die Welt retten, das ist klar. Aber man kann gerade in der Stadt- und Kommunalpolitik etwas tun - und ich finde, das wird in Graz hervorragend gemacht. Menschen hervorzuheben, die über Jahre Vorbilder sind. Auf diese „Role Models" muss man bewusst hinweisen und das passiert am besten auf städtischer, auf lokaler, auf kommunaler Ebene. Weil die Menschen dort einander kennen. Das vermittelt ein Gefühl, selbst etwas bewegen zu können. Ich halte es für sehr wichtig zu sagen, wir leben in einer Menschenrechtsgemeinschaft und zeichnen jene aus, die das möglich machen. Und Graz setzt da bewusst ein Zeichen der Anerkennung.
Was kann die Politik noch tun?
PETRITSCH: Bei all den rasanten Veränderungen kann festgestellt werden: Die Krise der Politik in Österreich, überall in Europa, in der westlichen Welt, ist auf der kommunalen Ebene am geringsten. Bürgermeisterinnen, Bürgermeister müssen „liefern". Daran werden sie gemessen - und im positiven Fall wiedergewählt. Da hat es die Politik auf nationaler oder gar EU-Ebene schwerer. Die Entscheidungen fallen in einer gefühlten Ferne. Damit steigen auch das Misstrauen und die Verdrossenheit, die Unzufriedenheit, oft auch die Ablehnung alles Politischen. Und das untergräbt die Demokratie und trägt zu Scheinlösungen bei. Das politische Handeln wird tatsächlich schwieriger. Politik muss sich bemühen, näher an den Menschen, an die Bürgerinnen und Bürger heranzukommen.
Ein Blick in die Zukunft, was wird sich Ihrer Meinung nach 2026 bewegen müssen?
PETRITSCH: Wir haben viel über die unglaublichen Veränderungen in der Welt und in Österreich gesprochen. Diese Veränderungen müssen ernst genommen werden, Lösungen rascher erarbeitet als bislang üblich. Für Österreich - und für die EU - gilt, dass die politischen Entscheidungsebenen - Kommunen-Länder-Bund-EU - neu sortiert werden müssen. Eine den geänderten politischen, wirtschaftlichen, sozialen Gegebenheiten adäquate Aufgabenverteilung ist überfällig. Das wird nicht gehen, ohne das politische System wie wir es seit Jahrzehnten kennen und gut damit gefahren sind, einer notwendigen Anpassung - ja, gewiss auch einer größeren Treffgenauigkeit - zu unterziehen. Bei all dem darf das erfolgreiche Modell Wohlfahrtsstaat keinesfalls auf der Strecke bleiben. Es ist stets schwierig, liebgewordene Traditionen aufzugeben und das neue Notwendige für unsere Zeit zu tun. Gerade die Steiermark hat seinerzeit mit den Gemeindezusammenlegungen etwas sehr Mutiges geleistet. Nicht zur Freude aller, da gehört viel dazu. Vor allem die Menschen „mitzunehmen", macht die Kunst der Politik aus. Heute stehen in vielen öffentlichen Bereichen große Fragen an: Gesundheit, Altenpflege, Wohnen, kurz die Leistbarkeit und die Qualität des Lebens. Da muss man schauen, wie man jetzt und heute die Dinge zeitgemäßer für das 21. Jahrhundert aufstellt.
2026 sind Gemeinderatswahlen in Graz - die Wahlbeteiligung könnte stärker sein, wie motiviert man vor allem junge Menschen, zur Urne zu gehen?
PETRITSCH: Die aktive Teilnahme möglichst vieler Bürger:innen - auch jener die nicht die Staatsbürgerschaft besitzen - am öffentlichen Leben ist die Vorbedingung für das gute Gelingen jeder Gemeinschaft. Man muss die Menschen dort abholen, wo sie sich befinden. In der Familie, im Beruf, in den sozialen Räumen. Die Digitalisierung aller Lebensbereiche - die Problematik der sogenannten „sozialen Medien" - hat tiefgreifende gesellschaftliche Folgen. Haben wir anfangs noch gedacht, super, das Leben wird demokratischer, jetzt haben alle Zugang zu allen Informationen, hat sich bald herausgestellt, dass neue zwischenmenschliche Gräben entstehen. Desinformation und „fake news" beherrschen einen immer aggressiver werdenden digitalen Raum. In dieser Situation wird das persönliche Gespräch wieder wichtig. Es wird entscheidend für die Zukunft unseres Zusammenlebens sein, dass die neuen Kommunikationskanäle und Medien in den Dienst des zwischenmenschlichen Austausches gebracht werden. Das halte ich für eine wesentliche Herausforderung für Politik und Gesellschaft - in Graz genauso wie im übrigen Österreich, in Europa und darüber hinaus. Der Jugend aber muss man sagen, beteiligt euch, macht mit, seid kritisch und konstruktiv zugleich. Denn nur so wird es euch gelingen, nicht auf der Speisekarte der Mächtigen zu landen.
Interview: Birgit Pichler
Zur Person
Wolfgang Petritsch wuchs in Glainach/Glinje in Südkärnten auf. Er studierte Geschichte, Germanistik, Politikwissenschaft und Recht in Wien.
Stationen: u. a. Pressesprecher von Bundeskanzler Bruno Kreisky, Direktor der österr. Pressestelle in New York, Bevollmächtigter Minister für Österreich bei den Vereinten Nationen, EU-Chefverhandler bei den Friedensverhandlungen von Rambouillet und Paris, Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, als Botschafter für Österreich bei der OECD in Paris.
Mehr über ihn: wolfgangpetritsch.com